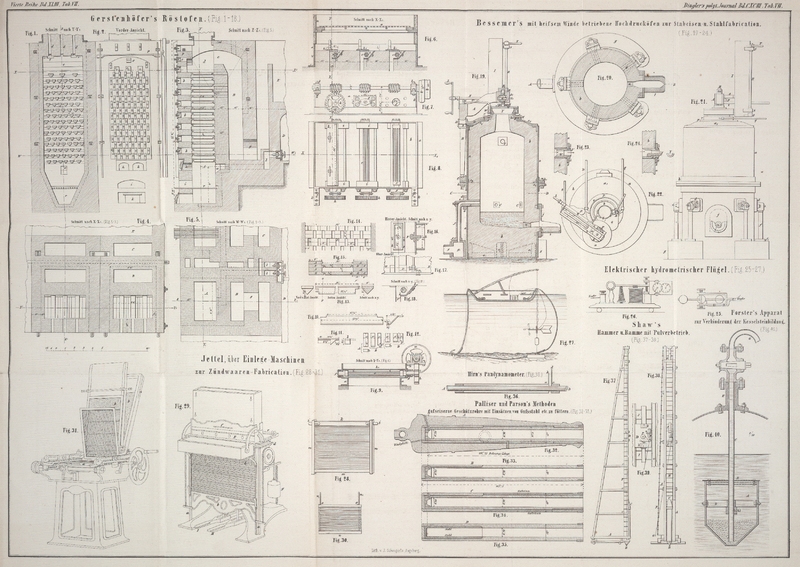| Titel: | Hirn's Pandynamometer. |
| Fundstelle: | Band 193, Jahrgang 1869, Nr. XCIII., S. 354 |
| Download: | XML |
XCIII.
Hirn's
Pandynamometer.
Mit einer Abbildung auf Tab. VII.
Hirn's Pandynamometer.
Auf der letzten Welt-Ausstellung zu Paris hatte Hirn einen Apparat ausgestellt, mit Hülfe dessen sich die bei einer Welle
während der Uebertragung der Kraft entstehende Verdrehung messen ließ. Zu dem Ende
erhält die zu untersuchende Transmissionswelle an jedem ihrer Enden ein
feingezahntes Rad, welche beiden Räder mit gleichen Rädern des Apparates so in
Eingriff gebracht werden, daß an der dem Motor zugekehrten Seite ein directer
Eingriff, an der entgegengesetzten Seite dagegen durch ein Zwischenrad ein
indirecter Eingriff stattfindet. Hierdurch erfahren die Räder des Apparates eine
entgegengesetzte Drehung, welche mittelst conischer Räder an ein drittes dazwischen
befindliches sogenanntes Differentialrad übertragen wird, das lose auf einer Welle
sitzt, welche einen Hebel bildet, der durch ein zwischen den conischen Rädern
angeordnetes Kreuz gehalten wird. Der Ausschlag, welchen der Hebel bei einer
Verdrehung der Transmissionswelle ergibt, ist die Hälfte des Verdrehungswinkels;
durch geeignete weitere Hebelverbindungen wird dieser Ausschlag entsprechend
vergrößert und auf einer mit Papier bespannten Trommel bemerkbar gemacht. Bringt man
nun die Transmissionswelle außer Verbindung mit dem Motor und belastet dieselbe
mittelst zweier Hebel und angehängter Waageschalen so lange, bis auf der Trommel des
Apparates die frühere Marke erreicht ist, so läßt sich aus dem aufzulegenden
Gewichte, dem auf die Aufhängepunkte der Waageschalen reducirten Hebelgewichte, der
Länge des Hebels und der beim ersten Versuche stattfindenden Umdrehungszahl der
Transmissionswelle die übertragene Arbeitsstärke auf die bekannte Weise
berechnen.
Eine einfachere Form dieses Pandynamometers, ebenfalls von
Hirn herrührend, läßt sich in gewissen Fällen in
Anwendung bringen. Ueber die Transmissionswelle A, B,
Fig. 36,
wird ein Eisenrohr geschoben, welches bei A mit der
Welle fest verbunden ist, während das andere Ende lose ohne Reibung geführt wird und mit einem Zeiger
a, b normal zur Rohrachse versehen ist. Am anderen
Ende B der Welle ist ein Arm c,
d fest aufgesteckt, welcher eine Scheibe mit getheilter Scala enthält,
deren Nullpunkt im unverdrehten Zustande der Transmissionswelle in der durch a, b und die Rohrachse gelegten Ebene liegt. Bei
vorkommender Torsion rückt der Nullpunkt aus dieser Ebene und der Verdrehungswinkel,
durch geeignete Hebelverbindungen beliebig vervielfältigt, läßt sich entweder
einfach ablesen oder wird wieder auf einer mit Papier bespannten Trommel bemerkbar
gemacht, so daß bei der späteren Belastung die ursprüngliche Verdrehung mit
Sicherheit wieder erhalten werden kann. – Endlich hat Hirn auch den elektrischen Strom benutzt, um den Verdrehungswinkel ohne
jegliche Hebelverbindung bemerkbar zu machen. Zu diesem Zwecke werden an den Enden
der zu untersuchenden Welle zwei gleich große Riemenscheiben aus einem
nichtleitenden Materiale aufgekeilt, welche auf ihrem Mantel in einer zur
Wellenachse parallel liegenden Geraden mit zwei Metalldrähten versehen sind. Drückt
man nun auf passende Weise die zwei Pole einer elektrischen Batterie an die
Scheibenmäntel, so wird bei jeder Notation ein ganz kurzer elektrischer Strom durch
die Drähte geleitet. Bei dem Leergange der Welle werden beide Ströme gleichzeitig
entstehen, bei einer stattgefundenen Verdrehung dagegen werden die beiden Ströme
getrennt auftreten. Versetzt man nun eine Metallwalze, welche mit chemisch
präparirtem Papiere überzogen ist, mit der Transmissionswelle in gleiche Rotation
und läßt die Drähte von beiden Riemenscheiben in einem Punkte darauf zusammenstoßen,
so werden bei einem gleichzeitigen Strome ein Punkt, bei einem ungleichzeitigen
dagegen zwei solcher Punkte entstehen, deren Entfernung das Maaß des
Verdrehungswinkels ist. Rotirt die Metallwalze drei, vier oder fünf Mal so rasch als
die Transmissionswelle, so erscheint auch das Intervall der Punkte ebenso vielmal
vergrößert, so daß auch hier das Mittel gegeben ist, das Maaß des Verdrehungswinkels
beliebig zu vergrößern und damit die Empfindlichkeit des Apparates zu erhöhen. (Nach
der „Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und
Architektenvereines,“ 1868, S. 107; aus der Zeitschrift des Vereines
deutscher Ingenieure, 1869, Bd. XIII S. 261.)
Tafeln