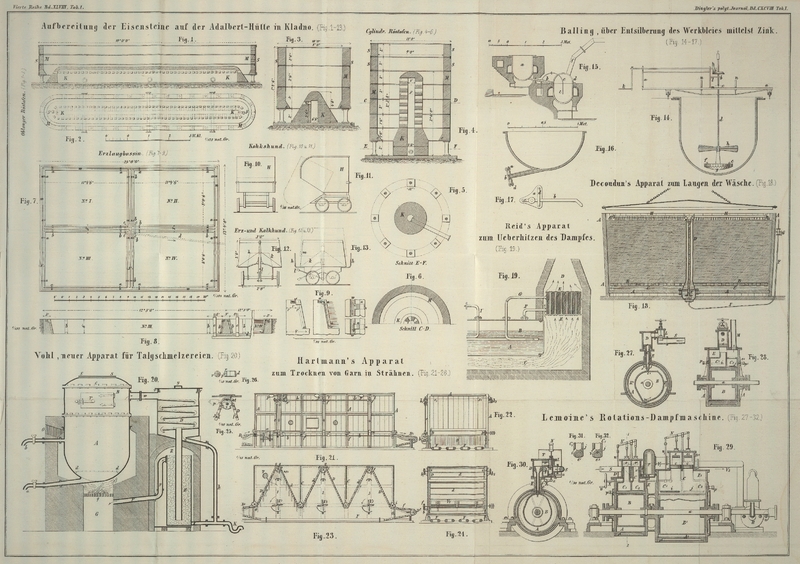| Titel: | Notizen aus der Adalbert-Eisenhütte in Kladno; von Johann Zeman. |
| Fundstelle: | Band 198, Jahrgang 1870, Nr. IX., S. 32 |
| Download: | XML |
IX.
Notizen aus der Adalbert-Eisenhütte in
Kladno; von Johann
Zeman.
Aus den „Technischen Blättern“ 1870 S.
149.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Zeman, über die Adalbert-Eisenhütte in Kladno.
Die Adalberthütte in Kladno
(Böhmen) bietet dem Fachmanne viele sehr interessante Einrichtungen dar. Manche
Anordnungen sind neu und bisher noch nirgends publicirt, andere nach zwar bereits
bekannten Systemen aber derartig durch den Hüttendirector Julius Jacobi modificirt, daß der Hohofenbetrieb in Kladno einen
sehr erfreulichen in den letzten Jahren auffallend günstigen Aufschwung genommen
hat. Die Ursachen desselben sind, abgesehen von der günstigeren Gestaltung der
einheimischen Industrieverhältnisse, gründliche Verbesserungen in der Aufbereitung
der zur Verhüttung gelangenden Erze sowohl als auch rationelle Construction des
Hohofens, worüber nachstehend einige Mittheilungen folgen sollen.
I. Aufbereitung der
Eisensteine.
Ein großer Theil der in den Kladnoer Hohöfen zur Verschmelzung kommenden Erze wird
vorher in Schachten mit eingeschichtetem Brennmaterial geröstet und dann, um den
Schwefel möglichst vollständig zu entfernen, einem Auslaugproceß unterworfen.
Rösten der Eisensteine. – Das Rösten der Erze
erfolgt in 17 in regelmäßigem Betriebe stehenden Oefen. 7 Stück derselben sind nach der in England
gebräuchlichen Form construirt und besitzen bei 14 1/4 Fuß (4,505 Met.) Höhe eine
Gichtöffnung von 20 Fuß (6,322 Met.) Länge und 10 Fuß (3,161 Met.) Weite. 2 Röstöfen
haben die in Figur
1 bis 3 ersichtlich gemachte Gestalt; die Länge beträgt 60 Fuß (18,967 Met.),
die durchaus gleiche lichte Weite 9 Fuß (5,690 Met.), endlich die Höhe 10 1/2 Fuß
(3,319 Met.). Die übrigen 8 Röstöfen sind cylindrisch (Fig. 4 bis 6), 9 Fuß (2,845 Met.)
weit und 15 Fuß 8 Zoll (4,952 Met.) hoch.
Die letzteren zwei Gattungen von Röstöfen (Fig. 1 bis 6) sind nach Jacobi's Plänen sehr einfach
und billig hergestellt und haben sich im mehrjährigen
Betrieb auf's Beste bewährt.
Das Schachtmauerwerk M ist aus feuerfesten Ziegeln in der
Stärke von 1 Fuß (0,316 Met.) hergestellt und wird durch horizontal eingelegte
gußeiserne Platten und verticale Schienen s (Fig. 1, 3 u. 4)
zusammengehalten; unten ruht dasselbe auf einer ringförmigen Gußplatte und mehreren
2 Fuß (0,632 Met.) hohen gußeisernen Füßen, auf welche Weise am ganzen Umfang des
Ofens das Ausziehen der gerösteten Erze ungehindert und gleichmäßig erfolgen
kann.
Die Luftzuführung in den Ofenschacht geschieht durch eine angemessene Unzahl, im
Mantelmauerwerk ausgesparter Oeffnungen – welche in der Zeichnung nicht
angedeutet sind –, ferner durch möglichst viele Canäle in dem am Boden in der
Ofenmitte aufgebauten, hohlen Abrutschkegel K, welcher
mit der Atmosphäre durch Röhren in Verbindung steht.
Dieser Abrutschkegel K hat außerdem noch den Zweck, das
regelmäßige Niedergehen der Erze im Röstofen zu befördern, ebenso wie ein etwa
ungleichmäßiger Gang derselben längs der Ofenwand durch das zufolge Verstärkung des
Mauerwerkes bei e (Fig. 3 u. 4) bewirkte Zusammenziehen
des unteren Theiles des Schachtes verhütet wird.
Die zu röstenden Erze werden in kopfgroßen Stücken abwechselnd mit Brennmaterial
schichtenweise aufgegeben. Das gleichmäßige, gute Durchrösten so großer Erzstücke,
ohne ein Sintern derselben befürchten zu müssen, wird durch die Benutzung des bei
der Kohkskohlenwäsche abfallenden und sonst nicht weiter zu verwendenden
Kohlenschlammes (Schmand) als Brennmaterial erzielt. Dabei ermöglicht auch die feine
Zertheilung des Schmandes das bequeme, vollkommene Abscheiden der gerösteten
Erzstücke von der Asche.
Der cylindrische Röstofen faßt 750 Wiener Ctr. (840 Zoll-Ctr.) und röstet in
einer zwölfstündigen Arbeitsschicht 150 W. Ctr. (168 Z.-Ctr.) Eisensteine;
der oblonge Röstofen hat einen Fassungsraum für 3600 W. Ctr. (4032 Z.-Ctr.)
Erz und werden in gleicher Zeit 600 W. tr. (672 Z.-Ctr.) geröstetes Erz durchgesetzt. Während
demnach im oblongen Ofen viermal so viel als im
cylindrischen Ofen geröstet wird, betrugen die Anlagskosten des ersteren nur das Doppelte jener des
letzteren.
Da der größte Theil der in Kladno gerösteten Erze nach dem Rösten immer noch
bedeutende Mengen, in Wasser aber löslicher
schwefelsaurer Salze enthält, so werden die Eisensteine zunächst auf einem
durch eine Dampfmaschine betriebenen Quetschwalzwerk auf Eigröße zerkleinert und
dann einem durch Director Jacobi zuerst eingeführten
Laugproceß unterworfen.
Auslaugen der gerösteten, schwefelhaltigen Eisensteine.
– Das Nucicer Erz, welches in Kladno des massenhaft billigen Vorkommens wegen
zumeist zur Verhüttung gelangt, enthält roh 1,5 bis 1,8 Procent und auch noch mehr
Schwefel; nach dem Rösten sinkt der Schwefelgehalt im Durchschnitt auf 0,5 bis 0,6
Procent. Eine weitere, nur unbedeutende Kosten verursachende Herabminderung des
Schwefelgehaltes erzielt man durch einen rationell eingeleiteten Auslaugproceß, bei
welchem das geröstete, auf halbe Faustgröße zerkleinerte Erz in eigenen Bassins mit
wechselndem Wasser behandelt wird.
Eine Anlage von vier mit einander in Verbindung stehenden Erzlaugbassins ist in Fig. 7 bis 9 im Grundriß
und Detail veranschaulicht.
Je ein Bassin – im horizontalen Durchschnitt rechteckig – hat eine
obere lichte Länge von 11 Klafter 4 1/2 Fuß (22,286 Met.), eine Breite von 8 Klafter
6 Zoll (15,331 Met.) und eine Tiefe von 6 Fuß (1,897 Met.).Die neueren 6 Bassins sind 7 Fuß (2,213 Met.) tief und fassen je 18000 W.
Ctr. (20160 Z.-Ctr.) Erz. Der Inhalt je eines Bassin
beträgt circa 10000 W. Ctr. (11200 Z.-Ctr.), so
daß die vorhandenen 10 Erzbassins über 150000 W. Ctr. (168000 Z.-Ctr.)
Eisensteine fassen.
Die Erzauslaugbassins sind aus Ziegelmauerwerk hergestellt und mit Cement bekleidet;
der Boden derselben ist aus Beton mit einer etwa zwei-zölligen (0,053 Met.)
Cementschichte.Ein Bassin wurde mit einem Boden aus Sandsteinplatten versehen, da sich die
Cementschicht durch das Erzausschaufeln allmählich ablöste.
Längs der oberen Umfassungsmauern der 4 Bassins geht behufs Wasserzuleitung ein circa 10 Zoll (0,263 Met.) tiefer und ebenso breiter
offener Canal w, welcher mit Bretern ausgefüttert ist.
Von dieser Wasserrinne führen in jede Abtheilung je 4 Canäle a, deren Anordnung aus dem Detail in Fig. 9 zu entnehmen
ist.
Soll frisches Wasser in ein Bassin geleitet werden, so entfernt man den
Abschlußschieber s an der oberen Mündung des Canales a in die Wasserrinne w. In diesem Fall tritt frisches Wasser unten
am Boden in das betreffende Bassin ein.
In den Scheidewänden zwischen je zwei Abtheilungen sind die abschließbaren
Verbindungscanäle b angelegt, durch welche das
Laugwasser aus einem Bassin in das andere, im Sinne der Pfeile (Fig. 8) befördert wird,
wenn in das erstere durch die Canäle a frisches Wasser
zufließt.
Die gänzliche Entfernung des Laugwassers aus einem Bassin wird durch Oeffnen des
betreffenden Abschlusses c bewerkstelligt. Im Boden
jeder Abtheilung ist eine runde Oeffnung, welche jedoch durch einen von oben
stellbaren Stöpsel c (Fig. 8) verschlossen
werden kann. Um bei einem gefüllten Bassin das Nachfallen von Erz zu vermeiden, ist
über die Abzugsöffnung ein unten durchlöcherter Blechcylinder aufgestellt. Die vier
Wasserabzugsöffnungen c communiciren nun mit dem
Ableitungscanal d.
Die Manipulation ist je nach der zur Verfügung stehenden Wassermenge verschieden.
Auf alle Fälle wird das vorher gut geröstete Erz
entsprechend zerkleinert, in die einzelnen Bassins geführt und diese bis nahe dem
oberen Rand gefüllt.
Ist hinlänglich Wasser vorhanden, so wird dasselbe in die
mit Erz angefüllten Abtheilungen eingelassen und nach 1 oder 2 Tagen wieder
abgelassen und durch frisches ersetzt. So verfährt man durch 6 bis 8 Wochen, wobei
die Zeitdauer wesentlich vom Erz abhängt.
Steht jedoch nicht so viel Wasser zur Verfügung, um in der
angezeigten Weise vorzugehen, ist im Gegentheil die äußerste Sparsamkeit mit Wasser
geboten, so läßt man frisches Wasser stets nur in jenes Bassin, in welchem das Erz
bereits am längsten ausgelaugt, d.h. der Schwefelgehalt am kleinsten ist. Das in
diesem Bassin befindliche Wasser wird in die benachbarte Abtheilung mit dem nächst
reinsten – also etwas schwefelreicheren – Eisenstein durch die Canäle
b, b befördert. In dieser Art geht es weiter, bis
das Wasser, welches immer mehr schwefelsaure Salze aus dem Erz aufgenommen hat,
schließlich auf das zuletzt eingefüllte, frischeste Erz kommt und endlich abgeleitet
wird. Die Dauer des Auslaugprocesses wird in diesem Falle selbstverständlich
entsprechend verlängert.Der Vorgang bei diesem Entschwefelungsverfahren läßt sich nachstehend
erklären: Beim Rösten wird der im Erz enthaltene Schwefelkies zersetzt, ein
Theil des Schwefels entweicht, ein anderer Theil bildet mit den vorhandenen
Basen lösliche schwefelsaure Verbindungen. Kommt
nun das durch die Röstung aufgelockerte, also poröse Erz unter Wasser, so
steigt die Luft aus den Poren, welche sich mit Wasseranfüllen; dasselbe
löst die schwefelsauren Salze bis zu seinem Sättigungspunkte auf. Ein
weiterer Erfolg wäre dadurch nicht erreicht, wenn nicht eine
Diffusionsthätigkeit einträte, d.h. das Bestreben der Lösung der
schwefelsauren Salze sich mit dem umliegenden, specifisch leichteren Wasser
zu mischen. Es entsteht hierdurch eine ununterbrochene Strömung von Innen
nach Außen und umgekehrt, bis eine gleichmäßige Concentration der im Erz
enthaltenen und der um dasselbe befindlichen Flüssigkeit hergestellt ist.
Diese wird abgelassen und bei dem nächstfolgenden frischen Wasser wiederholt
sich der Vorgang von Neuem, bis das Lösliche im Erz gänzlich weggeführt ist.
– Um die Zusammensetzung des Rückstandes mitzutheilen, welchen man
beim Abdampfen des Laugwassers erhält, so wurden im Hüttenlaboratorium 5000
Gramme gut geröstetes Nucicer Erz mit destillirtem Wasser durch 48 Stunden
behandelt, das Laugwasser bis zur Trockne eingedampft und der Rückstand
– 54,5 Gram. – analysirt. Derselbe enthielt:Fe²O³0,57Al²O³0,61SiO²1,51CaO13,28MgO12,28SO³50,60PO³0,14HO21,09––––––Summa100,08
Eine besondere Beaufsichtigung erfordert das richtige Circuliren des Wassers in den
einzelnen Abtheilungen, indem es sonst geschehen kann, daß unreineres Wasser zu
bereits stark ausgelaugtem Erz geführt wird.
Eine sehr bequeme Controlle wurde zu diesem Behufe in der Weise eingeführt, daß aus
jedem Bassin täglich eine Wasserprobe genommen und nach dem Absetzen eventuell
Filtriren derselben eine 10 Millimet. weite, graduirte Glasröhre von etwa 200 bis
250 Kubikcentimeter Inhalt angefüllt wird. Für jede Abtheilung dient eine eigene
Controlröhre.
Die in jeder Probe enthaltene Schwefelsäure kann nun einfach durch Chlorbaryum
– nach vorangegangenem Zusatz einiger Tropfen Salzsäure – vollständig
gefällt und die Höhe des entstehenden, im nöthigen Fall durch etwas Klopfen
zusammenzuführenden Niederschlages an der Scala abgelesen werden.
Wenn auch keine absolute Schwefelbestimmung, so dient dieser Vorgang als vollkommen
sichere und sehr schleunige Controlle gegen Unregelmäßigkeiten in der Wasserführung,
weiter aber auch zur annähernden Bestimmung des Zeitpunktes, in welchem der
Laugproceß in einer Abtheilung dem Ende nahe ist.
Von welcher Bedeutung das geschilderte Entschwefelungsverfahren der Eisensteine für
die Adalberteisenhütte ist, erhellt aus den Mittheilungen, daß früher, bei einem
Schwefelgehalt von 0,5 Procent, aus dem Nucicer Erz, welches nebstbei noch Phosphor
enthält, kein graues, sondern nur kaltflüssiges, mattes weißes Roheisen zu erblasen war.
Nachdem der Schwefelgehalt dieser Erze auf 0,1 ProcentDas in Kladno zum Auslaugen verwendete Grubenwasser ist selbst etwas
schwefelhaltig; es kann daher mit reinem Wasser
der Schwefelgehalt noch unter die oben angegebene Grenze reducirt
werden. herabgemindert werden konnte, so wurde bei gleichem
Kohksverbrauch im Hohofen ein ganz grobkörnig graues, dem
schottischen ähnliches Roheisen erblasen, welches sich vorzüglich für die
Gießerei eignet, indem es einen ganz weichen Guß ergibt. Wird zufällig einmal der
Schwefelgehalt auf nur 0,2 bis 0,25 Procent reducirt, so erhält man nur halbirtes Roheisen.
Aus unausgelaugtem Nucicer Erz bleibt die Erblasung von grauem Roheisen selbst bei
hohem Kohks- und Kalksatz eine Unmöglichkeit.
Die Aufbereitungskosten des Erzes werden durch Jacobi's
Entschwefelungsverfahren nur um einen Neukreuzer – 0,01 fl. öst. W.
– pro
Wiener Centner Erz erhöht.
Was nun noch die Anlagskosten für die Auslaugbassins anlangt, so stellten sich
dieselben für das aus 4 (je 6 Fuß tiefen) Abtheilungen bestehende Bassin auf 4743,78
fl. öfter. W. und für das aus 6 (je 7 Fuß tiefen) Abtheilungen bestehende Bassin auf
9007,64 fl. öster. W.
(Der Schluß folgt im nächsten Heft.)
Tafeln