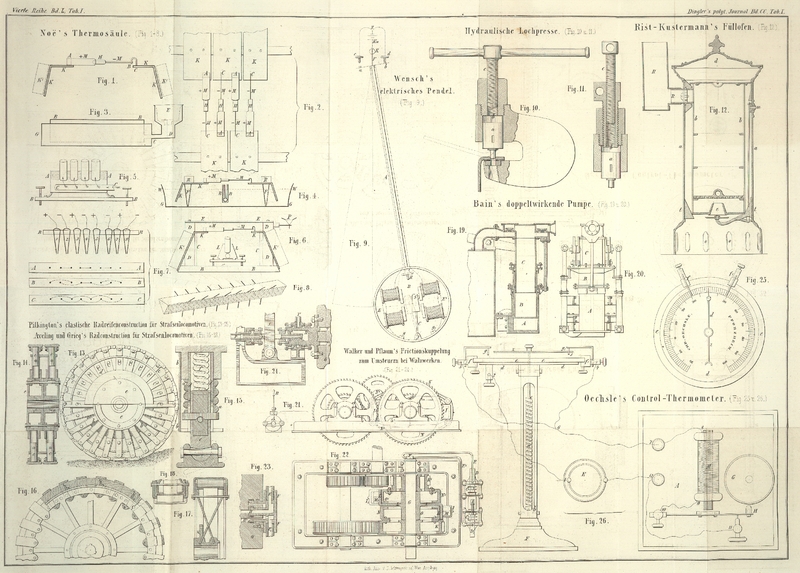| Titel: | Rist-Kustermann's patentirte Regulir-Füllöfen. |
| Fundstelle: | Band 200, Jahrgang 1871, Nr. X., S. 24 |
| Download: | XML |
X.
Rist-Kustermann's patentirte
Regulir-Füllöfen.
Mit einer Abbildung auf Tab. I.
Rist-Kustermann's
Regulir-Füllöfen.
Die Füllöfen haben in jüngster Zeit durch Rist und Kustermann eine
wesentliche Aenderung dadurch erfahren, daß das Gefäß –
in welchem bekanntlich ein größeres Quantum Brennmaterial auf
einmal eingebracht, angezündet und der Brand mittelst eines, von
unten durch das Brennmaterial durchgeführten Luftzuges von oben
nach unten geführt wird – transportabel gemacht, und mit
einer leicht zu handhabenden Regulirklappe in Verbindung
gebracht worden ist.
Ein solcher Ofen – welchen Bergbaudirector Hailer im bayerischen
Industrie- und Gewerbeblatt, 1870 S. 360 beschreibt
– ist in Fig.
12 dargestellt. a, a ist
der gußeiserne cylindrische Mantel, der unten am Fuß viereckige
Oeffnungen o, o hat, durch welche
die kalte Zimmerluft einströmt, um zwischen dem Füllgefäß b, b und dem Mantel aufzusteigen;
dabei erwärmt sich die Luft am Füllgefäß und tritt oben beim
durchbrochenen Deckel d, d des
Mantels in das Zimmer aus. Das cylindrische Füllgefäß kann
mittelst eines Henkels ausgehoben und eingesetzt werden, und
ruht auf den unten am Mantel angegossenen vier Tatzen t, t. In diesem Füllgefäß liegt der
Rost, welcher in dreierlei Höhen eingelegt werden kann, wie dieß
in der Zeichnung durch punktirte Linien angedeutet ist. Das
Füllgefäß faßt bis zum unteren Rost 19 1/2 bis 20 Pfd., bis zum
mittleren Rost 14 bis 14 1/2 Pfd., bis zum oberen Rost 7 bis 7
1/2 Pfd. Kohle. Am Boden des Füllgefäßes gelangt durch die
conische Oeffnung e die Zimmerluft
unter den Rost, je nachdem man die Klappe k, welche mittelst eines einfachen Mechanismus, der am
Mantel befestigt ist und bei m durch
einen Schlüssel in Bewegung gesetzt wird, von dieser conischen
Oeffnung mehr oder weniger entfernt, oder auch ganz verschließt.
Die Asche, welche durch den Rost fällt, sammelt sich am Boden
des Füllgefäßes rings um diese conische Oeffnung und kann, weil
der Rost oberhalb der letzteren geschlossen ist, durch dieselbe
nicht herausfallen. Ist die Kohle verbrannt, so wird die Asche
sammt dem Füllgefäß ausgehoben, ausgeleert und letzteres wieder
beliebig mit Kohlen gefüllt. Die Verbindung des Füllgefäßes mit
dem an den Mantel befestigten Rauchrohransatz R, R ist äußerst einfach und aus der
Abbildung leicht ersichtlich. – Auf die Kohlen, welche
das Rauchrohr etwas überragen dürfen, werden Holzstückchen und
Papier gelegt, angezündet, und nachdem durch die
Casserolringe oben nach Bedarf der Verschluß hergestellt worden
ist, wird die Klappe geöffnet, und nun durch die letztere der
Brand mehr oder weniger beschleunigt, also die Wärme im Zimmer
gesteigert oder vermindert.
Der wesentliche Vortheil dieser Aenderung der Füllöfen besteht
darin, daß man 1) das Brennmaterial nicht im Zimmer
einzuschütten und die Asche etc. nicht im Zimmer herauszunehmen
braucht, und 2) mit der einfachen Klappe den Brand völlig in
seiner Gewalt hat. Schon im Winter 1869/70 erfreuten sich diese
Oefen einer sehr bedeutenden Nachfrage; über Effect und
Brennmaterialverbrauch derselben theilt Bergbaudirector Hailer eine ausführliche
Zusammenstellung mit, nach welcher die Heizungskosten bei
Anwendung dieser Oefen sich sehr niedrig stellen (bei Anwendung
oberbayerischer Würfelkohlen von mittlerem und kleinem Korn
betrugen dieselben für 5 verschiedene Locale von 2815 bis 22830
Kubikfuß Inhalt in den Wintermonaten 1869/70 zwischen 2,4 und
10,5 Kreuzer). In keinem Local war mehr als zweimalige Füllung
des Ofens pro Tag nothwendig. Da
diese Oefen wegen ihrer geringen Anschaffungskosten gewiß auch
den minder bemittelten Classen leichter zugänglich gemacht
werden können, so versuchte Hailer
die Abfälle von Holz, Torf und Kohle zu ihrer Heizung zu
verwenden und bewährten sich dabei Gemenge gleicher Raumtheile
Kohlengries, Torfabfälle und Holzsägespäne, sowie von 1/2
Kohlengries, 1/4 Torfabfälle und 1/4 Sägespäne ganz gut, während
bei dem Verhältnisse von 3/5 Kohlengries, 1/5 Torfabfälle und
1/5 Sägespäne der Brand nicht durchgeführt werden konnte und die
Gluth bald erlosch.
Tafeln