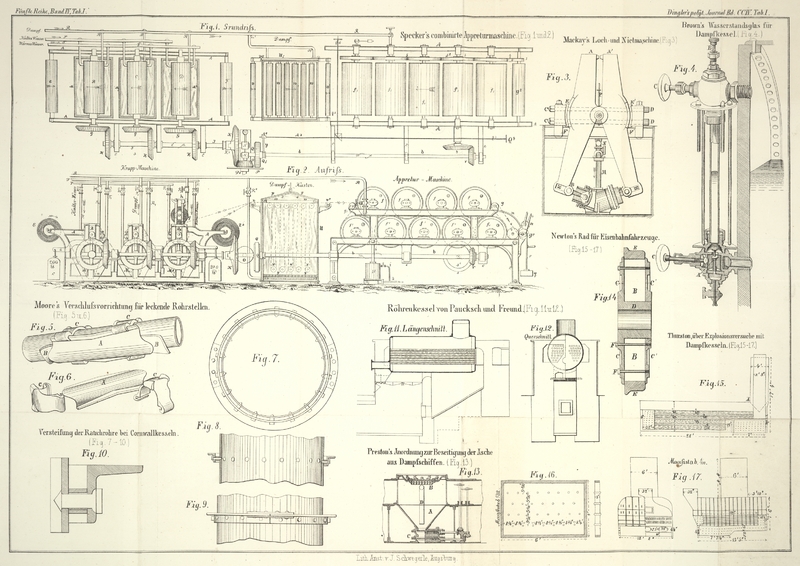| Titel: | Combinirte Appreturmaschine von Carl A. Specker in Wien, zum Krappen, Färben, Spülen, Dämpfen und Trocknen der Gewebe; mitgetheilt von Ingenieur Gustav Meißner. |
| Autor: | Gustav Meißner |
| Fundstelle: | Band 204, Jahrgang 1872, Nr. IX., S. 21 |
| Download: | XML |
IX.
Combinirte Appreturmaschine von Carl A. Specker in Wien, zum Krappen, Färben, Spülen, Dämpfen und
Trocknen der Gewebe; mitgetheilt von Ingenieur Gustav Meißner.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Specker's combinirte Appreturmaschine zum Krappen, Färben, Spülen
und Trocknen der Gewebe.
Die vollständige Appretur der wollenen und halbwollenen glatten Gewebe umfaßt eine
Reihe von Manipulationen, welche bis jetzt mit Hülfe einer Anzahl für jede einzelne
Manipulation besonders eingerichteter Maschinen ausgeführt wurden.
Die erwähnten Gewebe werden nämlich erst gekreppt, dann gefärbt, gedämpft und
getrocknet, und für jeden dieser Processe mußte eine besondere Maschine vorhanden
seyn, und die Gewebe mußten von einer Maschine auf die andere übertragen werden, was
um so mehr mit Zeitversäumniß verbunden war, als jede dieser einzelnen Maschinen
(welche überdieß öfter in verschiedenen Localen aufgestellt wurden) meistens einen
bis zwei Arbeiter zur Bedienung erforderte.
Die Maschinenfabrik von Carl A. Specker in Wien hat
deßhalb in Nachahmung
einer hervorragenden englischen Firma, welche Vorzügliches auf dem Gebiete des
Appreturmaschinenbaues leistet, eine Maschine construirt, welche die früher einzeln
ausgeführten Manipulationen bei der Appretur halbwollener und wollener Waaren in einem Zuge verrichtet, wodurch außerordentlich viel an
Arbeitskraft, Raum und Material gespart wird.
Diese Maschine ist in Figur 1 und 2 im Grundriß und Aufriß
dargestellt, mit Weglassung der zu ihrem Betriebe dienenden Dampfmaschine.
Die zu appretirende Waare gelangt vom Webstuhl weg auf eine mit E bezeichnete Welle, auf welcher sie lose in die am
vorderen Ende der Maschine angebrachten Lager A
eingelegt wird.
Diese Welle kann mit Hülfe einer Bremsscheibe und eines hölzernen Bremsklotzes mit
Hebel und angehängtem Gewichte nach Erforderniß gebremst werden, so daß die Waare
mit gehöriger Spannung durch die Maschine geht.
Die erste Operation, welche das Gewebe durchzumachen hat, ist eine Befreiung
desselben von allen fetten Theilen, welche der Wolle beim Spinnen und Weben zugefügt
werden müssen, um sie leichter verarbeiten zu können.
Dieses Entfetten wird allgemein mit dem Namen Kreppen oder Krappen
bezeichnet und der Apparat an unserer vorliegenden Maschine, welche dieses Entfetten
bewirkt, heißt die Krappmaschine.
Die Waare gelangt bei derselben von der Walze E in einen
gußeisernen, mit heißer Sodalauge gefüllten Kasten M und
über eine im letzteren angebrachte Leitwalze n zwischen
ein über dem Kasten angebrachtes starkes gußeisernes Quetschwalzenpaar B, und nachdem sie von rechts nach links zwischen den
Walzen durchgegangen ist, wobei der größte Theil der ihr anhängenden Sodalauge
ausgepreßt wurde, passirt sie um die obere Quetschwalze herum in einen zweiten mit
Farbflotte gefüllten Kasten M₁, geht zwischen
einem zweiten Quetschwalzenpaare B₁ hindurch,
gelangt in einen dritten mit siedendem Wasser gefüllten Kasten M₂, und nachdem sie schließlich durch ein drittes
Quetschwalzenpaar B₂ ausgepreßt worden ist, läuft
sie über eine Leitwelle v in den hölzernen Kasten U, wo sie gedämpft wird.
Das Dämpfen der Waare hat einen doppelten Zweck, indem es einerseits die
niedergequetschten Haare der Waare ausrichtet und derselben dadurch Glanz verleiht,
und andererseits die dem heißen Wasserdampfe ausgesetzten Gewebe beim späteren
Naßwerden im Regen nicht mehr so stark eingehen. Dieser Proceß des Dämpfens wird mit dem Namen Mobsiren,
Decatiren, Finischiren bezeichnet.
Der Dämpfkasten besteht aus einem hölzernen Kasten U,
welcher ringsum geschlossen und mit einer Anzahl Leitwalzen w und x versehen ist, über welche sich die
Waare in der aus der Zeichnung ersichtlichen Weise bewegt.
Unter den Leitwalzen x ist eine Querwand y angebracht, welche mit vielen Löchern versehen und mit
einem Filztuche belegt ist.
Aus dem unteren Theile des Kastens, in welchen der Dampf durch ein Kupferrohr z geführt wird, gelangt derselbe durch die Löcher und
die Filzdecke an das über die Walzen x laufende
Gewebe.
Der Kasten II ist mit hölzerner Decke p versehen, welche
leicht abgehoben werden kann, um die Waare zwischen den Leitwalzen durchzuziehen.
Natürlich schließt der Deckel p an der Ein- und
Austrittsstelle des Gewebes nicht fest an den Kasten an, sondern läßt eine Spalte
für das Gewebe frei.
Damit das in der Decke sich ansammelnde Condensationswasser nicht auf die Waare
tropfen kann, ist innerhalb des Deckels p eine demselben
parallele Decke o aus Zinkblech angebracht, in welcher
sich der Dampf leichter niederschlägt und sodann in die seitlichen Holzrinnen
abfließt.
Wie aus dem Grundrisse der Zeichnung ersichtlich ist, kann die hintere Wand u₁ des Dämpfkastens um Scharniere aufgeklappt
werden, um das Durchziehen des Gewebes am Anfange der Arbeit zu erleichtern.
Ueber eine Leitwalze v₂ gelangt die gedämpfte und
nasse Waare nun zu einem Trockenapparate, welcher aus neun übereinanderliegenden mit
Dampf geheizten Kupfertrommeln f, f₂ besteht, um
welche sich das Gewebe in der aus der Zeichnung ersichtlichen Weise bewegt, um
schließlich über eine Leitwalze g zu einer Glättwalze
g₂ zu gelangen und sich auf der auf letzterer
liegenden Welle n aufzuwickeln.
Die Glättwalze g₂ hat eine durch Räder
hervorgebrachte voreilende Bewegung, reibt sich deßhalb auf dem Gewebe und ertheilt,
da sie stark mit Dampf geheizt ist, demselben einen bemerkenswerthen dauernden
Glanz.
Die Aufwindwalze n liegt auf der Walze g₂ auf, wird durch die an ihre Zapfen gehängten
Gewichte q fest auf dieselbe gepreßt und hebt sich in
ihren gabelförmigen Lagern in dem Maaße als das Gewebe sich auf ihr aufwickelt.
Die ganze Maschine wird von einer 4pferdigen zweicylindrigen Dampfmaschine in Betrieb
gesetzt, welche an der Welle P₂ angreift.
Der Antrieb auf die Krappmaschine geschieht von der Welle P₂ aus durch die conischen Räder K und O, die Welle J und die conischen Räder G und H.
Der Betrieb der Trockenmaschine geschieht mittelst einer glatt abgedrehten
Planscheibe P und dem auf der Vorgelegewelle b sitzenden Papier-Würtel Q. Das Lager N₁ wird sammt der Welle
b und dem Würtel Q durch
einen Winkelhebel und das angehängte Gewicht fest gegen die Planscheibe gepreßt.
Wenn das Gewebe beim Uebergang von der Krappvorrichtung zur Trockenmaschine nicht
reißen, sondern genau dieselbe Spannung beibehalten kann, muß die Geschwindigkeit
der Trockenmaschine während dem Gange verstellbar und so regulirt seyn, daß sie
immer etwas vorzueilen strebt.
Dieß wird dadurch erreicht, daß der Würtel Q auf der
Planscheibe durch Drehen einer Schraube A₃
verschoben werden kann. Auf dieser letzteren befindet sich ein Halter A₂, welcher mit seinem Arme y in die ausgedrehte Nuth Q₁, der Würtelnabe eingreift. Beim Drehen der Schraube A₃ mittelst des Handrades Q₁ verschiebt sich der Halter A₂
auf der Schraube und zieht den Würtel mit sich, welcher so dem Centrum oder dem
Umfange der Planscheibe beliebig genähert werden kann, wodurch aber auch die
Umfangsgeschwindigkeit des Würtels und somit diejenige der Trockentrommeln f verändert wird. Der Würtel wird nun so eingestellt und
das Gewicht, welches denselben an die Planscheibe preßt, so regulirt, daß die
Trockenmaschine etwas voreilen mühte, wenn nicht in Folge der dadurch
hervorgerufenen Spannung der Waare ein theilweises Gleiten der Planscheibe auf dem
Würtel entstehen würde, wobei die Spannung des Gewebes beständig genau dieselbe
bleibt.
Von der Welle b aus wird die Bewegung durch die conischen
Räder r und s und die
Stirnräder 4 und 5 auf die Trockencylinder f
übertragen.
Die Kästen M, M₁, M₂ der Krappvorrichtung sind jeder mit Dampfzuleitung R₁, Warmwasserleitung T und Kaltwasserleitung S versehen.
Für den Fall daß das gekrappte und gefärbte Gewebe nicht gedämpft werden soll, ist
auf dem letzten Quetschwalzenpaare B₂ der
Krappmaschine eine Aufwindvorrichtung angebracht, wo das Gewebe sich auf einer Walze
g aufwickeln kann. Der rechte Arm f des Gabellagers h dieser
Welle kann in horizontale Lage heruntergeklappt werden, um die Welle g leicht und bequem herausnehmen zu können.
Ebenso kann solche Waare, welche bloß gedämpft und getrocknet werden soll, auf eine
Kaule Z₃ aufgewickelt in die Lager A eingelegt werden.
Die Geschwindigkeit der Waare in ihrem Laufe durch die Maschine beträgt 4 bis 8 Meter
per Minute, und es liefert die Maschine bei 10
Arbeitsstunden somit täglich 2400 bis 4800 Meter Waare.
Tafeln