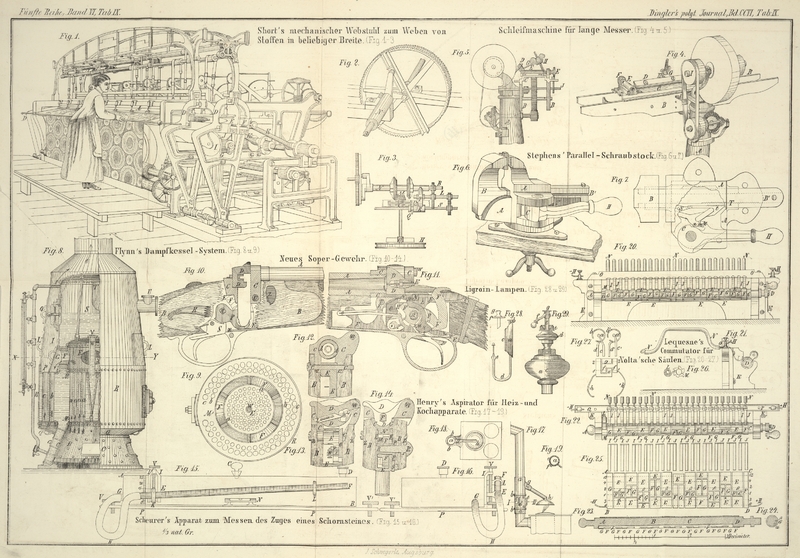| Titel: | Short's mechanischer Webstuhl zum Weben von Stoffen in beliebiger Breite. |
| Fundstelle: | Band 206, Jahrgang 1872, Nr. CXVII., S. 431 |
| Download: | XML |
CXVII.
Short's mechanischer Webstuhl zum Weben von Stoffen in beliebiger
Breite.
Aus dem Scientific American, November 1872, S.
303.
Mit Abbildungen auf Tab.
IX.
Short's mechanischer Webstuhl zum Weben von Stoffen in beliebiger
Breite.
Der Webstuhl von James Short in New Brunswick, N. J.,
welcher am 16. Juli 1872 in den Vereinigten
Staaten von Amerika patentirt wurde, ermöglicht die Anfertigung von Teppichen,
Shawls, Tüchern oder gröberen Fabricaten von beliebigem Muster in jeder Breite, und
verdient in Anbetracht seiner sinnreichen Construction und der ausgezeichneten
Resultate welche durch ihn bereits erzielt worden sind, den hervorragenden
Erfindungen auf dem Gebiete der neueren Weberei-Mechanik beigezählt zu
werden. Als Beispiel seiner Leistungsfähigkeit führen wir nur an, daß er
Bodenteppiche für mehr oder minder geräumige Zimmer in einem Stück und ohne Saum eben so wohlfeil und weit rascher liefert, als
der seitherige Webstuhl Teppiche von gewöhnlicher Breite.
Fig. 1 stellt
die Maschine in perspectivischer Ansicht dar. Der Mechanismus welcher die Lade A vor- und rückwärts bewegt, steht mit der
rotirenden Welle B, Fig. 2, in Verbindung.
Letztere enthält an ihrem äußersten Ende eine Kurbel C,
deren Zapfen mittelst eines Gleitblockes in der diametralen Rinne eines großen
Zahnrades gleitet. Der Mittelpunkt dieses Rades, welches seine Bewegung von der
Haupttreibrolle herleitet, ist bezüglich der Achse der Welle B insofern excentrisch, als die Kurbel sich nicht geradezu bis zur Mitte
des Zahnrades, sondern etwas darüber hinaus erstreckt. Die auf diese Weise auf die
Welle B übertragene Rotation ist nicht gleichförmig,
indem die Drehung der Kurbel C, wenn ihr Zapfen in der
Rinne weiter außen sich befindet, bei gleichförmiger Drehung des Zahnrades weit
rascher erfolgt, als wenn sie dem Centrum näher liegt. Die Welle B vollführt demnach einen Theil ihrer Rotation sehr
rasch, den anderen Theil dagegen so langsam, daß sie beinahe still zu stehen
scheint. In Folge dieser Anordnung gestaltet sich die Thätigkeit des
Zwischenmechanismus so, daß die Lade A, um den Einschuß
festzuschlagen, zuerst rasch vorwärts, dann rückwärts sich bewegt und schließlich
ruhen bleibt, um für das Durchschießen der Schütze Raum zu geben.
Zu den wichtigsten Organen des Apparates gehören die dreieckigen Gestelle oder Rahmen D, D, welche, um ihre unteren Enden drehbar, zu beiden
Seiten des Webstuhles angeordnet sind. Diese Rahmen enthalten oben zwei Zellen oder
Canäle E und F von derselben
Querschnittsform wie die Schützenführung in der Lade. Es ist klar, daß durch die
Bewegung der Rahmen D, D der eine oder der andere dieser
Canäle an das Ende der Lade gebracht werden kann, so daß er eine Fortsetzung oder
Verlängerung der letzteren bildet. Bevor wir jedoch den Mechanismus der Rahmen D, D weiter verfolgen, müssen wir die Bewegung des zum
Antrieb der Schütze dienenden Riemens G näher
erläutern.
Dieser Riemen leitet seine Bewegung von einer Rolle H
(Fig. 3)
her, welche vorn unterhalb der Mitte des Webstuhles gelagert, in Fig. 1 jedoch nicht
sichtbar ist. I (Fig. I) ist eine der unterhalb der
Canäle E, F angeordneten Rollen, von welchen der Riemen
abwärts läuft. Die Zahl der in irgend einer Periode verwendeten Schützen und Treiber
ist um Eins weniger als die Zahl der Canäle in den Rahmen oder Gestellen D, D zusammen. Wenn daher jedes Endgestell, wie in der
Abbildung, mit zwei Canälen versehen ist, im Ganzen also von solchen vier vorhanden
sind, so können drei Treiber und Schützen angewendet werden.
Die Verbindung zwischen dem Riemen G und dem
Schützentreiber wird durch einen an ersterem befestigten Ansatz J (Fig. I) vermittelt. Letzterer greift nämlich in eine
entsprechende an der unteren Seite des Treibers befindliche Nuth. Nach erfolgtem
Schusse bleibt die Schütze in einem der Kästen der Gestelle D, D, worauf der Ansatz J die Nuth des
Treibers verläßt, indem der Riemen über die Rolle hinweg seinen Weg nach unten
nimmt. Mittlerweile kommt ein zweiter Riemenansatz mit einem Treiber an der anderen
Seite des Webstuhles in Eingriff, worauf der Riemen, welcher seine Bewegung in der
nämlichen Richtung fortsetzt, auch auf diesen Treiber in der erwähnten Weise wirkt.
Die beiden Schützen folgen daher von der nämlichen Seite der Maschine aus auf
einander. Wenn nun, nachdem der erste Treiber seine Bewegung ausgeführt hat, die
Bewegung des Riemens rückgängig wird, so würde der Treiber begreiflicher Weise nach
seinem Ausgangspunkt zurückgeführt werden, wenn nicht vor dem Beginn dieser
rückgängigen Bewegung durch eine Schwingung der Rahmen D,
D eine andere Zelle, also auch eine andere Schütze in die Richtung des
gebildeten Faches gebracht und nun diese andere Schütze durch den Riemenansatz
zurückgeführt würde.
Es ist einleuchtend, daß vermittelst einer zweckdienlichen Bewegung der
Rahmengestelle D, D, welche irgend einen der vier Kästen
oder Canäle in die Schußlinie bringt, die eine oder die andere der drei Schützen mit
dem Riemen in Verbindung gebracht und durch das Fach geschnellt werden kann. Eben so ist es
klar, daß die Verschiebung der genannten Rahmen sich dergestalt anordnen läßt, daß,
je nachdem es das Muster verlangt, die Schützen abwechselnd arbeiten oder eine und
dieselbe Schütze in Thätigkeit bleibt.
Es erübrigt jetzt nur noch die Erläuterung zweier Fragen: erstens, welches sind die
Mittel, durch deren Einfluß die Schwingung der Rahmen D,
D im richtigen Momente erfolgt, und zweitens, wie wird der Schützenriemen
G in Uebereinstimmung mit den übrigen Organen des
Webstuhles nach der einen oder der entgegengesetzten Richtung in Bewegung
gesetzt?
Zunächst ist es die Kurbelwelle L, welche mittelst der
Schubstange K den Rahmen D,
D die vorgeschriebene Bewegung ertheilt. Diese Welle selbst erhält ihre
Drehung durch ein an der linken Seite der Maschine befindliches, in Fig. 1 durch andere
Maschinentheile verdecktes Räderwerk, welches mit der Welle B (Fig.
2) in Verbindung steht. Es wurde oben erwähnt, daß die Rotation der
letzteren eine abwechselnd rasche und langsame sey. Vermöge dieser Bewegung erfolgt
der Wechsel der Schützen in der Zeit, in welcher die Lade die Schußfäden
festschlägt, um alsdann einige Zeit still zu stehen. Die Durchmesser der Räder
welche die Bewegung von der Welle B auf die Welle L übertragen, verhalten sich wie 1:2, damit eine
Umdrehung der Welle L auf zwei Umdrehungen der Welle B komme. Diesem Umstande, in Verbindung mit einer
geeigneten Anordnung der Kurbeln, ist es zuzuschreiben daß die Rahmen D, D erst vorwärts schwingen, während eines Schlages der
Lade pausiren, dann zurückschwingen und während des darauf folgenden Schlages
abermals pausiren, so daß die beiden Schützenkästen bei jedem Schusse abwechselnd
mit der Lade in Linie treten.
Fig. 3 dient
zur Erläuterung des Mechanismus womit die Bewegung des Riemens im Zusammenhange
steht. H ist die oben bereits erwähnte Riemenrolle,
deren Achse an ihrem Ende ein conisches Rad M trägt.
Letzteres erhält seine Bewegung von dem einen oder dem anderen der beiden conischen
Räder, deren gemeinschaftliche Welle N eine Röhre
bildet, welche die Achse B lose umschließt. Die Achse
des Riemenrades liegt bei O in einem drehbaren und bei
P in einem verschiebbaren Lager, so daß das Getriebe
M mit dem einen oder dem anderen der genannten
Winkelräder in Eingriff gebracht werden kann, und daher die Riemenrolle H abwechselnd nach der einen und der anderen Richtung
sich dreht. An dem verschiebbaren Lager P befindet sich
eine Hervorragung Q, welche in eine Rinne des die Welle
S lose umfassenden Muffes R tritt. Ein an der Achse L sitzendes Excenter
F drückt bei erfolgender Rotation abwechselnd gegen die Lappen U (wovon nur einer sichtbar) des Muffes R. Die Folge ist eine Verschiebung des Muffes, mithin
auch des Lagers P, wodurch das Getriebe M abwechselnd mit dem einen oder dem anderen Winkelrad
in Eingriff gebracht wird. Die lose Röhre N endigt sich
in eine Kurbel, deren Zapfen in der nämlichen diametralen Rinne des Zahnrades, wie
derjenige der Kurbel C der Welle B, nur auf der anderen Seite derselben, gleitet. Die Röhre N muß daher, wie die Welle B, abwechselnd schnell und langsam sich drehen; aber ihre Bewegung ist von
derjenigen der Welle B insofern verschieden, als
jedesmal der Schützenriemen in Bewegung ist, wenn die Lade still steht, und
umgekehrt.
Die in Rede stehende Maschine, obgleich von großen Dimensionen und stark gebaut, läßt
sich leicht mittelst eines dreizölligen Treibriemens in Gang setzen. Gewöhnliche
Bodenteppiche werden bekanntlich in geringen Breiten angefertigt. Sie müssen
zerschnitten und dem Raum angepaßt werden, eine Procedur welche nicht ohne
bedeutenden Abfall stattfindet, und wegen der Vereinigung in ein einziges Stück mit
viel Arbeit verbunden ist. Dazu kommt noch der Verlust wegen der Ausschnitte, welche
hier und dort nöthig sind, um den Teppich den Ecken und Conturen der Hervorragungen
anzupassen. Hierzu rechne man die Kosten welche das Legen des Teppiches veranlaßt,
erwäge ferner, wie schnell derselbe an den Nähten schadhaft und wie leicht ein
hübsches Muster durch ungeschicktes Aneinanderfügen verunstaltet wird, und
vergleiche endlich die Totalkosten mit den Kosten eines nach vorstehender Methode in
einem Stücke angefertigten Teppiches. Der von uns in
Augenschein genommene Webstuhl, einer der ersten welche angefertigt worden sind,
liefert ein 4 1/2 Yards breites Gewebe; er kann aber, wie man uns versichert, für
noch größere Breiten gebaut werden. Es eröffnet sich die günstige Gelegenheit,
schönere Muster, als seither, einzuweben, auch lassen sich nöthigenfalls Teppiche
für die Zimmer eines erst auf den Plänen des Architekten existirenden Gebäudes
anfertigen; und doch kommt ein solcher. Teppich nicht theurer zu stehen, als ein
gewöhnlicher, wie er heut zu Tage in Gebrauch ist.
Tafeln