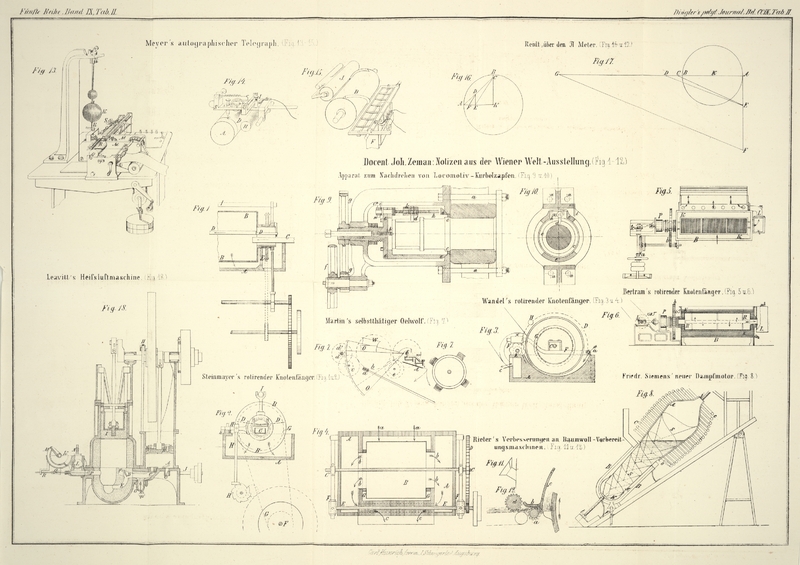| Titel: | Heißluftmaschine von C. C. Leavitt. |
| Fundstelle: | Band 209, Jahrgang 1873, Nr. XV., S. 95 |
| Download: | XML |
XV.
Heißluftmaschine von C. C. Leavitt.
Aus der Revue
industrielle, Mai 1873, S. 263.
Mit einer Abbildung auf Tab. II.
Leavitt's Heißluftmaschine.
Diese Maschine,Man vergl. über dieselbe die Notiz im polytechn. Journal Bd. CCVIII S. 153
(zweites Aprilheft 1873). deren Erfinder bei der letzten Ausstellung in New-York in Anbetracht
seines Verdienstes um die Verbesserung der Heißluft-Motoren eine Medaille
erhielt, ist in Fig. 18 im Verticaldurchschnitte abgebildet. Sie hat eine Höhe von 1,30
Met. und eine Breite von 1 Met. Der Cylinderdurchmesser und ebenso der Kolbenhub
beträgt 0,152 Met.; die Treibwelle macht 150 Umdrehungen per Minute. Die Maschine entwickelt angeblich eine Kraft von 20
Kilogrammmetern per Secunde (4/15 Pferdekraft) bei einem
Verbrauch von 570 Grammen Kohle per Stunde, oder
ungefähr 2,1 Kilogrm. per Pferdekraft, und der Erfinder
behauptet mit kräftigeren Maschinen noch eine vortheilhaftere Verwerthung des
Brennmateriales zu erzielen.
A ist das Klappenventil, durch welches die Luft in den
Apparat gelangt; B ist der Kolben der Luftpumpe; C und D sind die Ventile zur
Oeffnung und Schließung des Luftcanales zwischen der Luftpumpe und der unmittelbar
unter dem Cylinder angebrachten Feuerbüchse. Dieser Canal theilt sich in zwei Arme,
wovon der eine E sich unterhalb der Feuerbüchse endigt,
der andere F aus dem Cylinder nach dem Ausgang G führt. Das Ventil, welches den letzteren öffnet oder
schließt, wird durch ein
auf eine senkrechte Stange wirkendes Excenter H in
Thätigkeit gesetzt. I ist der Kolben des
Heißluftcylinders. Derselbe ist mit Speckstein bekleidet, und zwar so, daß zwischen
ihm und den Cylinderwänden ein schmaler ringförmiger Raum bleibt, mit Ausnahme des
oberen Theiles, wo er dem Cylinder genau und luftdicht sich anschließt. Auch der
untere Theil des letzteren, sowie die Feuerbüchse sind mit Speckstein ausgefüttert.
Der metallene Theil des Cylinders ist mit einem Mantel umgeben, in welchem kaltes
Wasser circulirt. Es scheint aber, daß die Hitze nicht intensiv genug ist, um
letztere Anordnung unumgänglich nothwendig zu machen. Die Welle J, welche ihre Rotation durch Vermittelung eines
Transmissionsriemens von der Schwungradwelle herleitet, setzt einen automatischen
Apparat zur Speisung der Feuerbüchse in Thätigkeit. Die Kohle wird nämlich in den
halbkugelförmigen Behälter K geschüttet, in welchem eine
halbkreisförmige Stange M um einen Zapfen oscillirt.
Diese Stange nimmt bei jeder Oscillation eine gewisse Quantität Kohle mit, welche
von einer Drahtbürste N in die Vertheilungsbüchse L gestreift wird. Letztere schüttet die Kohle in einen
horizontalen Cylinder, und ein Kolben P schiebt sie
sofort in die Feuerbüchse. Die Vertheilungsbüchse ist so construirt, daß bei keiner
ihrer Lagen eine Luftentweichung stattfinden kann. Ist die Feuerbüchse voll, so
findet der Kolben einen solchen Widerstand, daß er den Vertheilungsmechanismus in
Stillstand setzt.
Unterhalb der Klappe A der Luftpumpe befindet sich in
den: Einlaßrohr ein Drosselventil, welches mit einem von der Rolle S aus in Bewegung gesetzten (in der Abbildung nicht
sichtbaren) Regulator in Verbindung steht. Wenn nun unter dem Einflusse des
letzteren das Drosselventil sich schließt, so entsteht in dem Pumpenstiefel
unterhalb des Kolbens ein luftverdünnter Raum, wodurch das Aufsteigen des Kolbens
erschwert und der Gang der Maschine verlangsamt wird. Das Spiel der letzteren ist
nun folgendes.
Die Kurbeln des Luftpumpenkolbens und Heißluftkolbens sind rechtwinkelig gegen
einander gestellt. Wenn daher der Heißluftkolben, wie in der Abbildung, an dem
oberen Ende seines Hubes sich befindet, so ist der Luftpumpenkolben in der Mitte
seines aufwärtsgehenden Hubes angelangt. Es beginnt alsdann die Luftentweichung.
Befindet sich der Heißluftkolben in der Mitte seines Niederganges, so beginnt auch
der Luftpumpenkolben seinen Niedergang, und indem er die kalte Luft fortdrückt,
welche gleichzeitig mit der heißen Luft entweicht, bewirkt er eine Erniedrigung der
Temperatur. Schließlich tritt die kalte Luft allein aus, und reinigt dabei die
Ausströmungsöffnung vollständig. Letztere schließt sich unmittelbar, bevor der
Treibkolben seinen Hub vollendet hat und unmittelbar, bevor der Luftpumpenkolben in der Mitte
seines Niederganges sich befindet, was eine leichte Compression zur Folge hat.
Da der Pumpenkolben rasch niedersteigt, während der Kolben des Treibcylinders nach
dem Durchgang durch den todten Punkt sich langsam erhebt, so wird die Luft in Folge
der Schwungradwirkung comprimirt; es entsteht also unterhalb der beiden Kolben eine
Compression von ziemlich kurzer Dauer. Während nun der Heißluftkolben, sobald er den
unteren todten Punkt passirt hat, sich schnell erhebt, preßt der Pumpenkolben die
kalte Luft in die Feuerbüchse, wo sie sich rasch ausdehnt, durch die erlangte
Expansivkraft den Heißluftkolben aufwärts drückt und so die Rotation der Treibwelle
bewirkt. Das Klappenventil A ist aus Bronzeguß und mit
Leder garnirt; dasselbe wird durch ein kleines, auf einen Hebedaumen wirkendes, in
der Abbildung jedoch nicht sichtbares Excenter in Thätigkeit gesetzt. Die beiden
anderen Ventile C und D
bieten nichts Bemerkenswertes dar. Der Luftpumpenkolben ist mit einer Lederpackung
ausgestattet, die nur eines zeitweisen Einfettens mit Schweinefett, Talg oder Seife
bedarf. Die Maschine ist leicht in Gang zu setzen und arbeitet mit einem
verhältnißmäßig kleinen Schwungrade sehr regelmäßig.
Tafeln