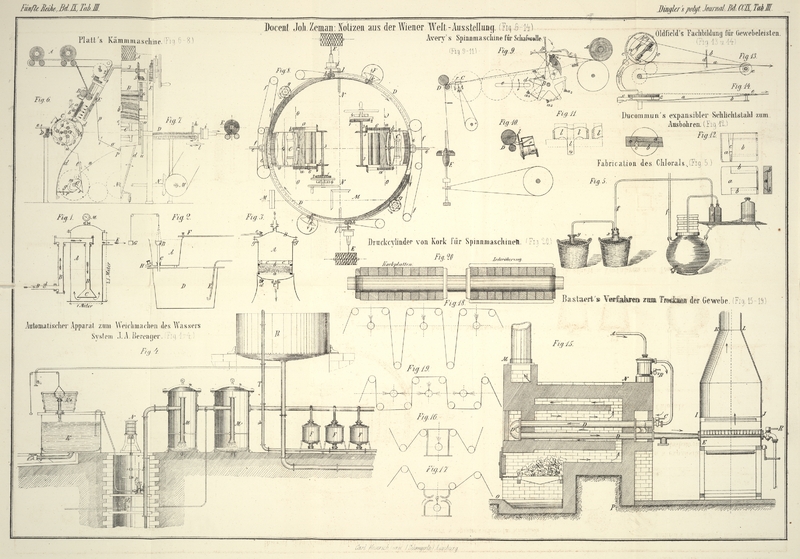| Titel: | Ueber die Fabrication des Chloralhydrates; von Gust. Detsènyi. |
| Fundstelle: | Band 209, Jahrgang 1873, Nr. XXXVI., S. 224 |
| Download: | XML |
XXXVI.
Ueber die Fabrication des Chloralhydrates; von
Gust. Detsènyi.
Mit einer Abbildung auf Tab. III.
Detsènyi, über die Fabrication des
Chloralhydrates.
Die außerordentliche Preiserniedrigung welche das Chloralhydrat seit dem Jahre 1869
erlitten hat – von 90 Thlrn. per Kilogramm auf 3
Thlr. – ist erklärlich wenn man den kolossalen Aufschwung in Betracht zieht,
welchen, dem Consum entsprechend, die Production dieses Präparates genommen hat. Zu
Anfang des Jahres 1869 führte Dr. Liebreich, in Berlin das Chloralhydrat in die Medicin ein und gab dadurch den Impuls zu
einfacheren, billigeren Darstellungsmethoden; heute stehen dieselben auf einer
solchen Stufe der Vollkommenheit daß eine Verbesserung derselben im Wesentlichen
undenkbar ist. Vor drei Jahren konnte man kaum während einiger Wochen einige Pfund
chemisch reines Chloralhydrat darstellen; heute liefern einige Fabriken Deutschlands
ununterbrochen täglich bis 500 Pfd. davon.
Das Hauptmoment bei der Darstellung ist das Einleiten von Chlor in mindestens
96procentigen Alkohol. Das Chlor wird am einfachsten aus Salzsäure und Braunstein
dargestellt.
In der bezüglichen Abbildung Figur 5 sehen wir einen 4
bis 5 Fuß hohen, starken thönernen Topf, der bei a zur
Hälfte mit Braunstein gefüllt wird. Die Salzsäure fließt bei b in den Topf. Das sich entwickelnde Chlor wird, nachdem es in einer Woulff'schen Flasche c Wasser
passirt hat, durch Combinationen von Blei- und Glasröhren in den Ballon x geleitet, der 120 bis 150 Pfd. 96procentigen Alkohol
enthält. Mit diesem Ballon steht unter gutem Verschluß ein anderer Ballon y in Verbindung, der zur Aufnahme der sich entwickelnden
Salzsäure dient.
Das Tag und Nacht ununterbrochen fortdauernde Einleiten des Chlors währt 12 bis 14
Tage, bis der Alkohol sich auf 60 bis 75° erwärmt hat und eine Dichte von
41° nach Baumé besitzt.
Diese Operation bildet die eine Hälfte der Fabrication und erfordert umsichtige,
gewissenhafte und erfahrene Arbeiter. Besondere Aufmerksamkeit muß der Verkittung
und der erneuten Füllung des Topfes gewidmet werden. Die Verkittung des Apparates
geschieht mit einem Gemisch von Kleienmehl und Wasser. Außerdem wird der Deckel des
Topfes auch noch mit Gewichten beschwert.
Bevor der Topf neuerdings mit Braunstein gefüllt wird, was je nach der Erfahrung circa alle Monate ein Mal geschieht, wird die bei der
früheren Operation entstandene Chlormanganlösung bei e
abgelassen, nachdem das noch etwa im Topfe befindliche Chlor durch die Röhre f einige Klafter über dem Gebäude in's Freie entwichen
ist.
Solcher Apparate sind z.B. in der chemischen Fabrik auf Actien in Berlin 40 in einem
Raume aufgestellt, die ununterbrochen täglich 3 Ballons Chloral liefern.
Die Reinigung des Chloralhydrates bildet den anderen Theil der Fabrication.
Zu diesem Behufe wird der als Endproduct gewonnene gechlorte Alkohol in 300 bis 400
Pfd. fassende, innen verbleite kupferne Blasen gebracht und mit gleichen
Gewichtstheilen englischer Schwefelsäure, die partiell hinzugegeben werden, über freiem Holzkohlenfeuer
vorsichtig zum Sieden erhitzt. Dabei entweicht eine nicht unbeträchtliche Menge
Salzsäure, während die Chloraldämpfe in einem aufsteigenden Kühlrohre condensirt
werden. Diese Behandlung wird so lange fortgesetzt, bis die Entwickelung von
Salzsäure aufhört. Gewöhnlich dauert dieß bei 150 Pfd. Chloral 7 bis 8 Stunden.
Bemerkenswerth ist, daß bei dieser Operation das als Verunreinigung geltende
Chloralalkoholat gänzlich zerstört wird.
Nun wird der Kühler abgenommen, und das freie Chloral, nachdem die Blase mit einem
Thermometer versehen ist, daraus abdestillirt. Anfangs siedet die Flüssigkeit bei 95
bis 96° C. Wenn das Thermometer auf 100° gestiegen ist, unterbricht
man die Destillation, da dann alles Chloral schon übergegangen ist. Das Destillat
wird einer erneuten Rectification unterworfen. Zu dieser gebraucht man kleinere, 150
bis 180 Pfd. fassende, innen ebenfalls verbleite kupferne Blasen, die mit
empfindlichen Thermometern versehen sind. Vor der Destillation wird noch die sich im
Chloral befindende freie Salzsäure mit geschlämmter Kreide neutralisirt. Das
destillirende Chloral wird in Glaskolben aufgefangen und, nachdem je 4 Pfunden 5 1/2
Loth destillirtes Wasser zugefügt wurden, durch fortwährendes Schütteln rasch
gekühlt; es wird dann je nach Bedarf entweder zur Krystallisation in eine zum
Dritttheil mit Chloroform gefüllte Kruke oder in große, ebene Porzellanschalen
geschüttet, in welchen letzteren es nach einer halben Stunde zu den besonders in
Amerika sehr verlangten Platten erstarrt. Diese werden in kleinere Stücke
zerschlagen und in Steingutkruken verpackt in den Handel gebracht.
Die Krystallisation mit Chloroform erfordert mindestens 8 Tage. Die Krystalle werden
auf Centrifugen von der anhaftenden Lauge befreit und in dazu eingerichteten, mit
Dampfleitung erwärmten Schränken getrocknet. Die abgeschüttete Mutterlauge kann
immer statt Chloroform für neue Portionen verwendet werden.
Nachdem hiermit die Massenproduction des Chlorals skizzirt ist, sind noch die
Nebenproducte, welche eine große Rolle spielen, zu berücksichtigen.
In riesigen Mengen tritt das Chlormangan auf, welches leider in der Technik sehr
wenig Verwendung findet. Bei Schering in Berlin hatten
sich während zwei Jahren circa 5000 Ballons mit
Chlormanganlösung angesammelt, die bloß im Werthe der Gefäße kein geringes Capital
verschlangen, so daß man sich zuletzt entschließen mußte, die Flüssigkeit
wegzuschütten.
Das zweite Nebenproduct ist die beim Einleiten des Chlors und bei der ersten Destillation
gewonnene Salzsäure, die neuerdings in den Topf geschüttet wird.
Interessant ist die im Ballon unter der Salzsäure sich ansammelnde ätherische
Flüssigkeit, welche nach Untersuchungen des Prof. Krämer
in Berlin ein Gemisch von Aethylen- und Aethylidenchlorid ist. Beide sind
werthvolle Producte, die in der Medicin Anwendung finden. Das Aethylidenchlorid
wurde ebenfalls von Dr. O. Liebreich als Anästheticum in
die Heilkunde eingeführt. Die Fractionirung dieser beiden Aether geschieht nach
allgemein bekannten Methoden durch Destillation aus kupfernen Blasen. Natürlich muß
die freie Salzsäure enthaltende Flüssigkeit erst mit Soda oder Potasche neutralisirt
und auf Chlorcalcium getrocknet werden. Obgleich die Differenz dieser Aether in den
Siedepunkten 23° C. beträgt, gelingt es doch kaum, dieselben in größeren
Quantitäten absolut zu trennen.
Als drittes Nebenproduct bleibt die zur Austreibung der Salzsäure gebrauchte
Schwefelsäure, die um billigen Preis an andere technische Anstalten verkauft wird,
bei denen die Verunreinigung nichts schadet, z.B. an Sodawasser-Fabriken.
(Ackermann's Gewerbe-Zeitung, 1873 S. 28.)
Tafeln