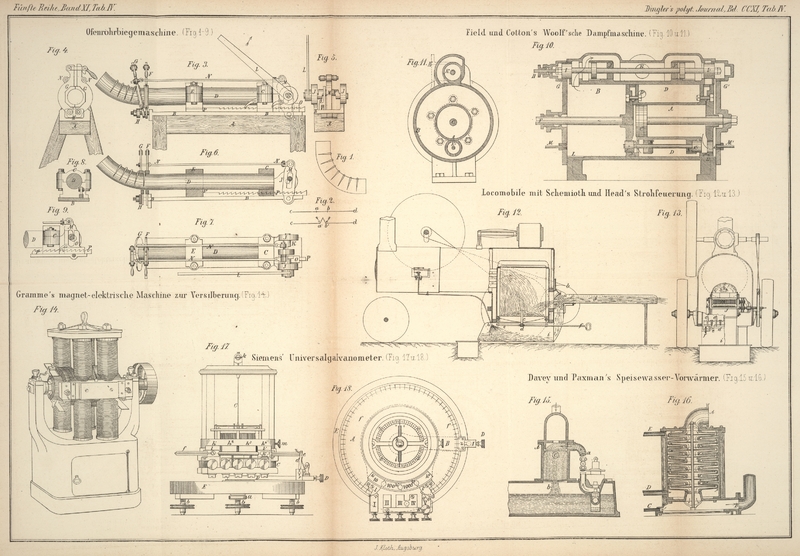| Titel: | Siemens' Universalgalvanometer. |
| Fundstelle: | Band 211, Jahrgang 1874, Nr. LI., S. 263 |
| Download: | XML |
LI.
Siemens' Universalgalvanometer.
Aus dem Telegraphic Journal, Januar 1874, S.
46.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Siemens' Universalgalvanometer.
So viel verschiedenartiger Instrumente man sich auch seither bedient hat, um die
Intensität und elektromotorische Kraft einer Batterie auf elektrischem Wege zu
messen oder den Widerstand eines Leiters zu finden, so wurde doch immer noch ein
Instrument vermißt, welches die für alle diese Operationen nothwendigen Anordnungen
in sich vereinigt, und dem Telegrapheningenieur die Anstellung der üblichen Versuche
erleichtert. Siemens' Universalgalvanometer nun, welches
diese Lücke ausfüllt, dient zu folgenden Zwecken:
1) zur Messung elektrischer Widerstände;
2) zur Vergleichung elektromotorischer Kräfte;
3) zur Messung der Stromintensitäten.
Behufs der Messung elektrischer Widerstände ist das Instrument als Wheatstone'sche Brücke eingerichtet; zur Vergleichung
elektromotorischer Kräfte dient Prof. Du
Bois-Reymond's Modification von Poggendorff's Compensationsmethode, und zur Messung der Stromintensität
vertritt es die Stelle eines Sinusgalvanometers. – Dasselbe besteht aus einem
empfindlichen, in einer horizontalen Ebene drehbaren Galvanometer, verbunden mit
einer Widerstandsbrücke (deren Draht, anstatt gerade zu seyn, rings über einen Theil
eines Kreises gespannt ist). Das Galvanometer besitzt eine an einem Coconfaden
aufgehängte astatische Nadel und eine mit feinem Drahte umwickelte flache Spule. Die
Nadel schwingt über einem in Grade getheilten Zifferblatt aus Kartenpapier. Da aber
beim Gebrauch des Instrumentes die Ablenkung der Nadel nie abgelesen, sondern die
letztere immer auf Null gestellt wird, so sind, in einem Abstande von circa 20° zu beiden Seiten von Null, zwei
Anschlagstifte aus Elfenbein angebracht.
Das Galvanometer ist über einer graduirten Schieferscheibe befestigt, um welche der
Platindraht gespannt ist. Unterhalb dieser Scheibe sind drei Widerstandsspiralen
– im Werth von 10, 100 und 1000 Siemens'schen
Einheiten auf einen hohlen Holzblock gewunden, welcher an der einen hervorstehenden
Seite die Klemmschrauben zur Aufnahme der von der Batterie und dem unbekannten
Widerstande herkommenden Leitungsdrähte enthält. Die drei verschiedenen
Widerstandsspiralen ermöglichen die Messung sowohl großer als auch kleiner Widerstände, und zwar mit
genügender Genauigkeit.
Das ganze Instrument ist, um seine Achse drehbar, auf einer mit drei Schraubenfüßen
versehenen Holzscheibe angeordnet. An der nämlichen Achse ist ein Hebel befestigt,
welcher an seinem Ende einen senkrechten Arm mit einem Contactröllchen trägt.
Letzteres wird mit Hülfe einer auf den besagten Arm wirkenden Feder gegen den rings
um den Rand der Schieferscheibe laufenden Platindraht angedrückt, und vermittelt die
Verbindung zwischen den Widerständen A und B einer Wheatstone'schen
Brücke. Diese Widerstände werden durch den Platindraht zu beiden Seiten des
Contactröllchens gebildet, während eine der drei Widerstandsspiralen den dritten
Widerstand der Brücke repräsentirt.
Fig. 17
stellt das in Rede stehende Instrument im Aufrisse, Fig. 18 im Grundrisse
dar. G ist das Galvanometer, K ein geränderter Kopf, von welchem die Nadeln herabhängen und durch
dessen Drehung die letzteren sich heben und senken lassen; m, der Kopf einer Schraube, welche die Nadel, wenn sie in Bewegung ist,
aufhält oder frei läßt. h₁, h₂, h₃, h₄, sind die Endplättchen der drei um den
Holzblock C gewickelten Widerstandsspiralen von 10, 100
und 1000 Einheiten. Diese Plättchen können mit Hülfe von Stöpseln mit einander
leitend verbunden und daher nach Verlangen einer oder mehrere Widerstände in die
Kette eingeschaltet werden. f ist die vom Platindraht
umspannte, graduirte Schieferscheibe. Dieser Platindraht ist in einer kleinen am
Scheibenrande angebrachten Rinne so eingefügt, daß er noch um seinen halben
Durchmesser über den Umfang der Scheibe hervorsteht. Die Enden des Platindrahtes
sind an zwei messingene Schlußplatten l und l¹ gelöthet, welche die Ecken des Einschnittes
der Schieferscheibe bilden, und wie bei der gewöhnlichen Widerstandsbrücke die
Verbindung zwischen A, n und dem Galvanometer auf der
einen Seite, und B, x und dem Galvanometer auf der
anderen Seite des Parallelogrammes herstellen. Die Endplatte l ist durch einen dicken Kupferdraht oder Metallstreifen mit der Endplatte
h₁ permanent verbunden, und eben so die
Endplatte l₁ mit der Endplatte III.
Als Material für die Scheibe f wurde Schiefer gewählt, weil dieser erfahrungsgemäß sich als
das gegen Witterungs- und Temperaturveränderungen unempfindlichste Material
herausgestellt hat. Die Schieferscheibe ist an ihrem oberen Rande auf eine
Bogenlänge von 300° graduirt. In der Mitte der Theilung befindet sich der
Nullpunkt, und zu beiden Seiten desselben erstrecken sich 150 Grade bis zu den
Endplatten l und l¹
des Brückendrahtes.
In der Mitte der auf drei Schraubenfüßen b, b, b ruhenden
kreisrunden Scheibe E aus polirtem Holze ist eine Metallbüchse eingelassen.
In dieser Büchse dreht sich, genau einpassend, der verticale Bolzen a, welcher das Instrument trägt. An dem um den Bolzen
a sich drehenden Arm D,
D ragt dicht hinter dem Griffe g ein kleiner
Arm d in die Höhe, der sich zwischen zwei
Schraubenspitzen r dreht und in einem an seinem oberen
Ende befindlichen Einschnitte ein kleines um eine Verticalachse drehbares
Platinröllchen enthält. Dieses Röllchen bildet den beweglichen Contactpunkt längs
des Brückendrahtes, gegen den dasselbe mittelst einer auf den Arm d wirkenden Feder angedrückt wird. Der Arm D, D ist gegen die übrigen Theile des Apparates isolirt,
und steht mit dem Endplättchen I in permanenter
Verbindung. An dem oberen Ende des Armes d ist ein
Zeiger oder Nonius z befestigt, welcher über den oberen
Rand der Schieferscheibe greift, und die Grade zeigt. An den Bolzen a ist eine ungefähr 1 Zoll dicke kreisrunde Scheibe C von polirtem Holz befestigt, in deren Umfang eine
Rinne zur Aufnahme der die Widerstände repräsentirenden isolirten Drähte gedreht
ist. Die Scheibe C besitzt eine Hervorragung, welche die
5 isolirten Endplättchen I, II, III, IV, V trägt. Die Plättchen III und IV können
durch einen Metallstöpsel, die Plättchen II und V durch den Contactschlüssel K mit einander verbunden werden. Das Endplättchen I
steht mit dem Hebel D, D in Verbindung.
Die Art und Weise, wie das Universalgalvanometer anzuwenden ist, wird einleuchten,
wenn man sich den Platindraht zwischen l, l¹ als
den in zwei Theile getheilten Draht der Wheatstone'schen
Brücke vorstellt.
Tafeln