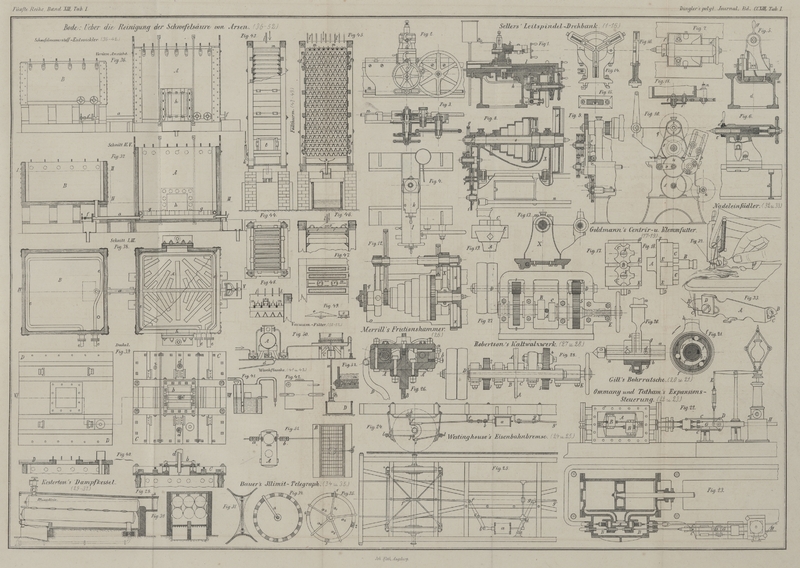| Titel: | Die Reinigung der Schwefelsäure von Arsen auf den königl. sächsischen Hüttenwerken bei Freiberg; von Friedrich Bode in Harkorten bei Haspe (Westphalen). |
| Autor: | Friedrich Bode |
| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. XIV., S. 25 |
| Download: | XML |
XIV.
Die Reinigung der Schwefelsäure von Arsen auf den
königl. sächsischen Hüttenwerken bei Freiberg; von Friedrich Bode in Harkorten bei
Haspe (Westphalen).
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Bode, über die Reinigung der Schwefelsäure von Arsen.
Die Beseitigung des Arsens aus Schwefelsäure, welche aus arsenhaltigen Schwefelkiesen
und sonstigen ebensolchen Schwefelmetallen gewonnen wurde, obgleich unter gewissen
Verhältnissen ein vollständig gelöstes Problem, bildet gleichwohl noch vielfach den
Gegenstand reiflichen Nachdenkens und mehr oder minder kostspieliger Versuche. So
beschäftigt sich noch neuerdings der Engländer H. A. Smith in seiner Schrift Chemistry of Sulphuric Acid
Manufacture
Die Chemie der Schwefelsäürefabrikation von H. A.
Smith; aus dem Englischen übersetzt und mit
Anmerkungen versehen von Friedr. Bode. 126 S. in
gr. 8. Pr. 4 Mark. (Engelhardt'sche Buchhandlung.
Freiberg 1874.)Die Red. in einem ziemlich umfangreichen
Capitel mit verschiedenen Methoden zur Beseitigung des Arsens aus der Schwefelsäure,
worüber er sich ohne Zweifel viel kürzer ausgelassen hätte, wenn ihm die
diesbezüglichen Einrichtungen der Freiberger Hüttenwerke
bekannt gewesen wären.
Es dürfte daher manchem Fachgenossen willkommen sein, wenn ich im Folgenden diese
Einrichtungen näher beschreibe. Vorweg möchte ich jedoch noch bemerken, daß meine
Ausführungen mit der Beschreibung, welche Schwarzenberg in
Bolley's Handbuch der chemischen Technologie (1869; Bd. II; Gruppe 1;
Lieferung 2) über den nämlichen Gegenstand gibt, nicht zu verwechseln sind, da dort
eine jetzt nicht mehr bestehende Einrichtung abgehandelt wird. Dennoch dürfte es
nicht überflüssig sein,
das frühere wenigstens mit einigen kurzen Worten ins Gedächtniß zurückzurufen; es
werden dann die Vortheile der neuen Anlagen um so deutlicher in die Augen springen
und derjenige, welcher in dieser Beziehung sich zu Versuchen angeregt fühlen sollte,
wird alsdann davon absehen, mit den letzteren an die abgethanen Einrichtungen
anzuknüpfen.
Wenn man Kammersäure von Arsen mittels Schwefelwasserstoffgas befreien will –
denn auf diese Weise erfolgt dieser Proceß auf den Freiberger Hütten –, so hat man zwei getrennte Operationen zu
unterscheiden, nämlich einerseits die Darstellung von Schwefelwasserstoff,
andererseits die Behandlung der Schwefelsäure mit diesem Gase. Processe, bei welchen
diese Trennung nicht vorhanden ist, bei welchen insbesondere die Darstellung des
Schwefelwasserstoffes sogleich mittels und in der
Schwefelsäure, welche man reinigen will, durch Zusatz geeigneter Substanzen erfolgt,
mögen zwar in einzelnen beschränkten Fällen brauchbar sein, sind aber immer dem
Vorwurfe ausgesetzt, daß das Arsen zwar ausgefällt, dafür aber eine andere
Verunreinigung in die Säure gebracht wird, welche in gewissen Fällen nicht
nachtheilig sein mag, in anderen aber schadet und auf alle Fälle besser nicht darin
vorhanden wäre.
Nach der früheren Einrichtung erfolgte die Behandlung der Schwefelsäure mit
Schwefelwasserstoff in einem Bleicylinder von circa 2,4
Meter Höhe und 0,75 Meter Durchmesser. Dieser Cylinder wurde durch den Deckel aus
höher stehenden Gefäßen mit der zu reinigenden Säure in der Art gespeist, daß
dieselbe in einem Rohr bis zum Boden des Cylinders niedergeführt wurde, wo man ihr
gestattete, durch eine Anzahl (8 Stück) im Kreise angeordneter Düsen in den mit
Schwefelwasserstoff erfüllten Cylinder auszutreten. Dieser Austritt erfolgte
selbstverständlich ganz nach Art eines Springbrunnens.
Die wieder niedergefallenen Säurestrahlen flossen am Boden des Cylinders mit
hydraulischem Verschluß in Gefäße aus. Da aber die Berührung von Säure und Gas auf
diese Weise nicht vollständig genug erfolgte, als daß alle arsenige Säure in
Schwefelarsen umgesetzt worden wäre, so mußte man die Schwefelsäure mit dem bereits
vorhandenen Niederschlage noch einige Male heben und in vorbeschriebener Weise
wiederholt behandeln. Durchschnittlich war eine dreimalige Behandlung in dem
Fällcylinder nöthig, um alles Arsen auszuscheiden.
Die Darstellung des Schwefelwasserstoffgases fand in Thontöpfen statt, von welchen
über zwanzig aufgestellt waren und welche mit besonders erschmolzenem Rohstem und
Schwefelsäure beschickt wurden. Es waren aber die Posten an Rohstem für einen
solchen Topf so klein, – soviel ich mich erinnere etwa dreißig (Zoll-)
Pfund – daß man täglich eine Anzahl Töpfe frisch beschicken und vorrichten mußte,
was umständlich war und viel Lohnausgabe verursachte.
Alle diese Umstände erschwerten, wie man sieht, die Reinigung großer Mengen
Schwefelsäure. Die Massenproduction an Schwefelsäure machte aber ein Verfahren
nothwendig, mit welchem man auch große Mengen reinigen konnte, da das ungereinigte
Product ungleich schwieriger verkäuflich ist, andererseits die Verunreinigung auch
so bedeutend war, daß die Gewinnung des Schwefelarsens, welches in der bestehenden
Arsenhütte für sogenanntes rothes Arsenglas Verwendung fand, zu einem lohnenden
Geschäft wurde.
Man hatte früher in der Kammersäure 1/4 bis 1/2 Procent arsenige Säure, von welcher
übrigens, beiläufig bemerkt, schon sehr bedeutende Mengen in gemauerten
Flugstaubkammern und langen Canälen vor dem Eintritt in
die Schwefelsäurekammern zurückgehalten wurden. Durch Vermehrung und Vergrößerung
dieser und ähnlicher Räume, insbesondere durch Aufstellung von Flugstaubkammern aus
Blei, welche wegen besserer Abkühlung auch besser auf die Condensation der arsenigen
Säure Wirten, ist man aber mit der Zeit dahin gelangt, den Gehalt der Kammersäure an
arseniger Säure auf etwa 0,05 Procent herabzumindern.
Man hat dadurch dreierlei Vortheile erzielt. Zunächst bedarf man nämlich weniger
Schwefelwasserstoff zur Ausfällung der geringeren noch in der Kammersäure
rückständigen Menge Arsens. Sodann erhält man von der gesammten in den verrösteten
Erzen enthaltenen Menge Arsen einen größeren Theil als arseniger Säure, welche sich,
wenn auch verunreinigt, besser in verkäufliches Product umwandeln läßt, als das
ausgefällte gelbe Dreifach-Schwefelarsen, welches als Zusatz für rothes
Arsenikglas angewendet dessen Fabrikation erschweren soll. Endlich braucht man auch
weniger Niederschläge von Schwefelarsen zu filtriren und auszuwaschen.
Smith gibt a. a. D. den durchschnittlichen Gehalt der
Schwefelsäure (? Bé.), welche aus hartem norwegischem Schwefelkies erzeugt
ist, auf 1,05 Procent an. Ich lasse dahingestellt sein, ob ein solcher Gehalt
hinreicht, um die Kosten für eine Reinigung mit Schwefelwasserstoff nach der Freiberger Methode zu decken, schreite vielmehr sofort
zur näheren Beschreibung der neuen Apparate selbst.
1. Darstellung von
Schwefelwasserstoff.
(Schwefelwasserstoff-Entwickler in Figur 36–42.)
Zur Darstellung des Schwefelwasserstoffes wird eigens nach Bedarf Rohstein
erschmolzen, welcher in der Hauptsache aus Eisenmonosulfuret besteht. Er enthält aber aus den
zu seiner Darstellung verwendeten Materialien auch noch etwa 5 Pfundtheile Silber,
welcher Gehalt sich in den unlöslichen Rückständen von der
Schwefelwasserstoffdarstellung auf etwa das dreifache angereichert vorfindet. Man
erzielt in diesem Falle mit der Schwefelwasserstoffdarstellung also nicht blos
Eisenvitriollaugen (die auf Vitriol versotten werden), sondern man bewirkt damit
auch gleichzeitig eine Silberconcentration.
Die Schmelzarbeit findet in einem Schachtofen mit sieben Formen statt; die
Beschickung ist ungefähr folgende:
16,1
Proc.
Stuffkies, mit 33 Proc. Schwefel im Mittel;
0,3
„
gerösteter Stuffkies;
0,6
„
Abbrände von der Schwefelarsensublimation, mit
durchschnittlich 20
Proc. Schwefel;
83,0
„
Bleischlacken, mit gegen 30 Proc. Kieselsäure.
––––––––
100,0
Von der so zusammengesetzten Beschickung lassen sich in dem siebenförmigen
Schachtofen in 24 Stunden 400 bis 425 Ctr. durchsetzen und ist hierbei der Aufwand
an Coaks 75 bis 80 Ctr. oder 19 Procent der Beschickungsmasse. Man erhält von dem
vorgelaufenen Erz gegen 80, von der vorgelaufenen Beschickung aber gegen 13 1/2
Procent Schwefeleisen, und es beziffern sich die Schmelzkosten auf den Centner der
vorgelaufenen Masse mit 25 bis 30 Markpfennige.
Der siebenförmige Ofen, welcher bei dieser Operation in Gebrauch ist, hat seine
sämmtlichen sieben Formen in der Rückwand und er ist als Sumpfofen zugestellt, wird
aber als geschlossener Ofen benützt in der Weise, daß man eine Schlackendecke im
Vorherd bildet, unter welcher die flüssigen Schlacken in Tiegel abgelassen
werden.
Die Höhe des Ofens von den Formen bis zur Gicht beträgt etwa 3,70 Meter; die Tiefe
von den Formen bis zur Sohle ist 50 Centimeter; der Abstand von Formmittel zu
Formmittel beläuft sich auf etwa 35 Centim. Die gesammte Breite des Ofens ist 2,40
Meter und die Weite vom Tümpeleisen bis zu den Formen mißt 94 Centim. Der innere
Ofenschacht ist durch 2 Scheider der Höhe nach in 3 Schächte getheilt; diese
Scheider gehen bis zu etwa 2 Meter Höhe über die Formen herab. Die Brustwand ist
senkrecht, die Rückwand mit beiläufig 15 Centimeter Rücklage aus feuerfesten Steinen
aufgeführt, die Sohle mit Gestübbe ausgeschlagen. – Die bei dem Schmelzen
resultirenden Schlacken enthalten im Mittel 36 bis 37 Procent Kieselsäure.
Der Rohstein wird in faustgroße Stücke zerschlagen und in die
Schwefelwasserstoff-Entwickler gebracht. Die Entwickelungsgefäße erhalten 80 bis 100 Ctr. Rohstem
auf ein Mal, welche Menge 8 bis 10 Wochen lang für den täglichen Verbrauch an
Schwefelwasserstoff vorhält. Nachdem der Apparat angestellt ist, fügt man im Anfange
schwache Schwefelsäure von 30 bis 40° B. zu, welche man beim Auswaschen der
erhaltenen Niederschläge von Schwefelarsenik erhält. Man geht dann, nachdem die
Entwicklung genügend eingeleitet ist, mit der Stärke der zuzusetzenden Säure auf
20° B. herunter (ebenfalls saures Wasser vom Auswaschen der Niederschläge)
und geht später wieder zu stärkerer Säure bis zu 40° B. über. Man kann
annehmen, daß ein Apparat 5 Centner saures Wasser von 20° B. täglich
bedarf.
Aus 100 Centner Rohstein erhält man etwa 145 Ctr. Eisenvitriol, dessen Gewinnung aus
den schwachen Laugen in der bekannten Weise erfolgt.
Die Einrichtung eines Schwefelwasserstoff-Entwicklers ist aus den beigegebenen
Figuren
36 bis 42 ersichtlich.
Derselbe besteht aus zwei Holzkästen A und B aus 2 1/2 sächs. Zoll (59 Millim.) starken Bohlen,
welche mit Bleiblech ausgeschlagen und durch ein Bleirohr a mit einander verbunden. Der Kasten A (im
Grundriß 6 zu 6 Fuß [1,699 Meter] und 5 Fuß 6 Zoll [1,557 M.] hoch wird bei
vollständig abgenommenem Deckel C (Fig. 39 und 40) mit
Rohstein beschickt, was zur Nachhilfe eventuell auch durch das Mannloch b geschehen kann. Nach erfolgter Beschickung wird der
Deckel aufgesetzt und durch die dreißig Schrauben, welche sich an seinem Umfange
befinden, gedichtet, nachdem zuvor ein Gummistrick zwischen Deckel und
Gefäßwandungen gelegt ist. Die Schwefelsäure wird durch das Rohr c im Mannlochdeckel eingefüllt.
Das Gefäß B ist ebenfalls mit abnehmbaren Deckel D versehen, braucht aber nicht mit Gummischnur gedichtet
zu sein. Es hat lediglich den Zweck, die gebildeten Laugen von Eisenvitriol
aufzunehmen, welche durch den Druck des im Apparate vorhandenen Gases durch das
Verbindungsrohr a hinübergetrieben werden. Dieser Druck
ist vorhanden, theils weil das Schwefelwasserstoffgas in dem Waschapparate (Schnitt
und Draufsicht in Fig. 41 und 42) eine Wassersäule zu
passiren hat, theils weil der Verbrauch an Gas durch ein Hartbleiventil mit
Gummiplatte absichtlich in der Weise regulirt wird, daß man im Entwicklungskasten
stets einige Pression hat. Dieselbe wird durch ein Quecksilbermanometer angezeigt,
für welches sich ein entsprechender Rohransatz z im
Deckel C des Gefäßes A
vorfindet.
Ist nun z.B. die Gasentwicklung sehr stürmisch und der Verbrauch an Gas der
Entwickelung nicht entsprechend, so treibt die vermehrte Pressung des Gases eine
entsprechende Menge Lauge und Säure aus dem Entwickler in das Nebengefäß 6, eine
entsprechende Menge Rohstem wird blos gelegt und nicht mehr von Säure benetzt, daher
die Gasentwickelung nachläßt; sie nimmt aber wieder zu, sobald die Spannung im
Entwickler A durch den Verbrauch an Gas abgenommen und
demgemäß aus B neuerdings wieder Säure in den Entwickler
zurückgetreten ist. Obschon der Deckel D des
Nebengefäßes ohne Dichtung aufgesetzt wird, so könnte gleichwohl der Fall vorkommen,
daß er durch zu starkes Aufschrauben luftdicht schließt. In diesem Falle würde die
im Nebengefäße eingeschlossene Luft comprimirt werden und hierdurch die vorher
beschriebene Regulirung der Gasentwicklung zum Theil vereiteln. Es ist daher zur
Sicherheit in den Deckel D eine Oeffnung angebracht,
durch welche in diesem Falle beim Steigen der Laugen die Luft austreten kann.
Die Zeichnungen ergeben, daß der Kasten A nebst Deckel
sehr solid armirt ist. Die Ecken sind mit Winkeleisen versehen und auf allen vier
Seiten umfassen starke Schrauben und Streben den Kasten. Der Deckel ist außerdem
durch zwei Säulen d (Fig. 39) gegen die
Balkenlage des Gebäudes abgespreizt. Die in das Innere der Kästen hineinragenden
Eisentheile, wie Schraubenköpfe und dergleichen, sind selbstverständlich besonders
überbleit und gegen das Bleifutter der Kastenwände verlöthet.
Um die etwa vorkommende Bildung von Eisenvitriolkrystallen beim Vorhandensein starker
Laugen schnell wieder beseitigen zu können, sind in beiden Kästen A und B Dampfrohre e am Boden oder nahe am Boden angebracht. Die
Beseitigung der Laugen erfolgt durch die Rohransätze f,
welche für gewöhnlich mit Bügelschrauben verschlossen sind.
Unmittelbar auf dem Boden des Entwicklers A liegt eine
Schicht säurefester Chamottesteine, in welcher nur in der Mitte eine Rinne
freigelassen ist, als deren Fortsetzung beiderseits die Laugenrohre a und f zu betrachten sind.
Auf dieser Schicht sind strahlenartig und in Absätzen wiederum Chamottesteine
gelegt, welche einem aus vier Theilen bestehenden Siebe g aus starkem Bleiblech zur Unterlage dienen. Auf das Sieb wird der
Rohstein bei frischer Ladung des Apparates gebracht. Um zuvor den Apparat zu
reinigen, entfernt man die vier unverbundenen Theile des Siebes g und kratzt die silberhaltigen Rückstände aus, indem
man die beiden seitlichen Mannlöcher h öffnet, welche
für gewöhnlich ebenfalls mit Gummidichtung versehen sind.
Ueber die Leistung dieses Schwefelwasserstoff-Entwicklers ist bereits das
Nöthige gesagt und sei nur noch angeführt, daß man auf 100 Ctr. Kammersäure
durchschnittlich 150 Pfund Rohstein für die Ausfällung des Arsens zu rechnen
hat.
2. Ausfällung des Arsens.
(Fällthurm in Figur 43 bis 49.)
Die Kammersäure von 50° B. im Mittel wird unverdünnt und ohne Erwärmung der
Behandlung mit Schwefelwasserstoff unterzogen. Der Fällapparat, wie er sogleich
beschrieben werden wird, reinigt täglich bequem 300 Ctr. Kammersäure, welche bei einmaliger Behandlung mit Schwefelwasserstoff von
arseniger Säure befreit ist.
Der Fällapparat, welcher in den Figuren 43 bis 49 dargestellt
ist, bildet einen viereckigen Thurm von 4 Fuß (1,133 M.) Breite und 6 Fuß (1,699 M.)
Tiefe und einer wirksamen Höhe von 17 1/2 Fuß (4,956 M.). Wegen Abflusses der
behandelten Säure in die hierzu bestimmten Gefäße sind unter dem Bleiboden des
Thurmes noch circa 6 1/2 Fuß (1,840 M.) Höhe frei
gelassen, so daß sich die Oberkante des Thurmes 24 Fuß (6,796 M.) über die
Gebäudesohle erhebt. Die vier Ecken des Apparates werden durch kräftige hölzerne
Säulen gebildet, welche unten und oben durch je einen Rahmen zusammengehalten
werden. Auch sind einige Eisen mit Schraubengewinde an einem Ende durch die
Ecksäulen gezogen, welche die letzteren ebenfalls zusammenhalten. Zwischen den
Ecksäulen sind Riegel und Bohleneinstriche eingeschoben, welche theils das
Ausbauchen und Durchbiegen der Bleiwände verhindern sollen, theils zum Halten und
Aufhängen derselben dienen. Dieses Aufhängen erfolgt, wie in der Ansicht Fig. 43 und im
Grundriß Fig.
44 angedeutet, mittels Bleilaschen, die an die Wände angelöthet und an die
Riegel angenagelt sind. Die Bleiwände, jede aus einem Stück bestehend (zu 10 Pfund
per rhein. Quadratfuß resp. 0,1 Qu. M.) sind an der
Außenseite des oberen Rahmens angenagelt und in den Ecken durch vier stehende
Lothnähte verbunden. In den kurzen Seiten des Thurmes befinden sich auch einige
Mannlöcher t, welche die Zeichnung (Figur 43 und 45)
angibt.
Der Schwefelwasserstoff tritt unten bei k in den Thurm
ein. Hätte man es nur mit diesem Gase allein und nicht
auch mit Luft aus dem Entwickler, sowie mit Wasserdampf zu thun, welch' letzterer
trotz der Waschung bei dem Gase verbleibt, so würde man den Apparat ganz geschlossen
halten können und man würde auch nur soviel Schwefelwasserstoff zuzuführen haben,
als zur Ausfällung der arsenigen Säure eben nöthig ist. Da jedoch diese
Voraussetzung nicht zutrifft, so muß man den Thurm auch noch mit einem
Abführungsrohre versehen, welches freilich auch etwas Schwefelwasserstoff mit ins
Freie abführen wird. Es ist dieses Rohr im obersten Theile des Apparates
angesetzt.
Der Fällthurm ist mit 24 Reihen von Λförmigen Bleidächern ausgefüllt, welche 6
Zoll (142 Millim.) Höhe und Basis haben. Die beiden Dachseiten sind in der Spitze
zusammengelöthet und bestehen aus Walzblei von 10 Pfund per rhein. Quadratfuß resp. 0,1 Qu. M. Die unteren Seiten der Dächer sind
beiderseits sägeblattartig (nicht zu grob) ausgezackt, wie dies im
Detail-Längenschnitt Fig. 46 angedeutet ist.
Dadurch wird verhindert, daß die zu reinigende Säure in Strahlen und Fäden von Dach
zu Dach im Thurme niederrinnt und so zu wenig der Einwirkung des
Schwefelwasserstoffes ausgesetzt würde. Vielmehr wird die Säure von den Zacken nur
Tropfen um Tropfen niederfallen, welche durch den Aufschlag auf das nächst tiefere
Dach verspritzen und zerstäuben und so für intensive Einwirkung des Gases die
nöthigen großen Oberflächen darbieten. In jeder Reihe befinden sich 9 solcher Dächer
unter einander derart versetzt, daß der DurchgangstelleDer Durchgang beträgt 2 Zoll (47 Millim.); an den beiden Seitenwänden des
Thurmes nur 1 Zoll (24 Millim.). zwischen je zwei Dächern in der nächst tieferen Reihe ein Dachfirst
entspricht, daher die abfallenden Tropfen jedesmal wieder eine neue Dachfläche
vorfinden, auf welcher sie zerspritzen oder sich ausbreiten. Diese Anordnung bedingt
auch, daß in jeder zweiten Horizontalreihe an den Seitenwänden des Thurmes nur
Dachhälften liegen. Die Länge der Dächer ist 3 Fuß 8 Zoll (992 Mm.) und sie sind
beiderseits lose (ohne jede Befestigung) aufgelegt auf dreiseitige hölzerne Leisten,
welche vor ihrer Anbringung an den Seitenwänden des Thurmes besonders überbleit
sind. Diese Leisten ragen einschließlich des Bleiüberzuges etwa 3 Zoll (70 Mm.) vor,
so daß jedes Dach beiderseits je 1 Zoll (24 Mm.) Auflage hat. Der senkrechte Abstand
der Leisten ist 7 1/2 Zoll (177 Mm.); es bleiben somit bei 6 Zoll (142 Mm.) Höhe der
Dächer 1 1/2 Zoll (35 Mm.) Zwischenraum zwischen den Reihen der Dächer.
Der Zulauf der Säure in den Apparat findet oben bei 1 an der Decke desselben durch 9
besondere Bleirohre statt, die oberhalb in Trichter endigen, in welche die Säure
– durch Hähne regulirt – eintritt.Statt dieser etwas umständlichen Regulirung, bei welcher die Controlle sowohl
über möglichst gleichmäßigen Durchgang bei den einzelnen Hähnen als über den
Durchgang der gesammten Säuremenge zu führen ist, könnte man zweckmäßiger
ein Reactionsrad anwenden. Der Zulauf in dasselbe brauchte nur aus einem
Hahne zu erfolgen und man würde dasselbe in die Mitte eines durch neun
radial gelegter Bleistreifen in gleiche Sectoren getheilten Bleitellers
stellen. Die in dieser Weise hergestellten Abtheilungen, welche beim Gange
des Reactionsrades stets gleiche Säuremengen auffangen, würde man mit
Abflußröhren versehen, welche in den Fällthurm führen. Diese ganze
Einrichtung könnte ohne jeden Nachtheil abseits vom Apparate aufgestellt
werden, wodurch man nur etwas längere Zulaufröhren erhalten, die Decke des
Apparates aber sonst vollkommen frei behalten würde.
Die Decke des Thurmes ist
durch etwa 4 1/2 Zoll (106 Mm.) hohe Scheider m von
Bleiblech in 9 Abtheilungen getheilt, die in demselben Sinne laufen, wie die Dächer
in den Thurm gelegt sind. Dem Mittel einer solchen Abtheilung entspricht jedesmal
ein First der obersten Dachreihe im Apparate. Innerhalb einer jeden von diesen 9
Abtheilungen ist ein viereckig geformter Bleikasten i
aufgelöthet, welche mit den vorhergenannten Scheidern m
und mit den senkrechten Bleiwänden des Thurmes die Ränder eines hydraulischen
Verschlusses bildet. Dieser Verschluß selbst wird bewirkt durch neun Kapseln n, deren Ränder in die einfließende Säure
eintauchen.
In die Mitte jeder Kapsel n ist ein Schaukel- oder
Kipptrog o (Fig. 46 und 49)
aufgesetzt, dessen Achslager aus Hartblei bestehen und an den Seiten der Kapsel
angelöthet sind. Die Schaukeltröge werden durch die bereits erwähnten neun
Zuleitungsrohre 1 mit Säure gespeist, welche gleichförmig vertheilt durch die 2
Reihen feiner Löcher (von etwa 2 Millim. Weite) im Boden der Kästen 1 in das Innere
des Thurmes eintropft und hier sofort auf die oberste Dachreihe auffällt.
Einer der aus Blei hergestellten Schaukeltröge n ist in
der Figur 49
besonders dargestellt. Die beiden Stücke, welche die Achse und den Trog mit einander
verbinden, bestehen aus Hartblei. Die Achse selbst wird durch ein Glasrohr oder
einen Glasstab gebildet. An denjenigen Stellen, wo der Kipptrog n auf den Deckel der Wasserverschlußkapsel beiderseits
aufschlagen würde, ist ein Stück Gummi r (Fig. 46 und
47)
aufgelegt, welches durch vier Bleistreifen gehalten wird, die man auf den äußeren
Seiten an den Deckel selbst anlöthet, während die inneren Seiten vorläufig aufrecht
stehen bleiben und, nachdem die Gummiplatte an ihren Platz gelegt ist, niedergebogen
werden, um ein Verschieben derselben zu verhindern. Jede Kapsel ist noch mit 2
Handgriffen versehen, weil man die Kapseln von Zeit zu Zeit entfernen muß, um die
kleinen Löcher zum Einlauf der Säure wieder frei zu legen, insofern sich dieselben
nämlich nach einiger Zeit mit dem Niederschlage von Schwefelarsen versetzen.
Die ziemlich schwere Decke des Fällthurmes muß gut unterstützt werden, um das Reißen
der Löthnähte zu verhüten. Diese Unterstützung erfolgt durch 8 überbleite
Flacheisen, welche man unterhalb der Scheider m
einzieht. Diese Träger finden zu beiden Seiten durch überbleite dreiseitige Leisten
von Holz ihre Unterstützung. Zu den Kapseln muß man steifes Bleiblech, nicht unter
15 Pfund per rheinischen Quadratfuß (0,1 Qu. M.) nehmen,
zu den Laschen genügt Bleiblech mit 6 Pfund per rhein.
Quadratfuß, zur Decke solches von 10 Pfund und zu den Scheidern m auf der Decke und zu den Rändern der hydraulischen
Verschlüsse ebenso starkes.
Die Bleidächer im Thurme dürfen nicht angelöthet werden, da es wenn auch selten
vorkommt, daß Ballen und Klumpen von Schwefelarsen zwischen den Dächern sich
festlegen. Bisweilen gelingt es in einem solchen Falle die Freilegung der Durchgänge
durch Einlassen von Dampf in den Apparat zu bewirken. Oftmals aber schmelzen und
sintern bei diesem Vorgang die Schwefelarsenklumpen fest und alsdann ist die
Instandsetzung des Thurmes nur um so umständlicher und unangenehmer.
3. Filtriren und Auswaschen des
Schwefelarsens.
(Vacuumfilter in Figur 50 bis 52.)
So einfach auch das Abfiltriren der Säure vom Niederschlag, sowie das Auswaschen des
letzteren erscheinen mag, so führen diese Operationen doch zu Umständlichkeiten und
Kosten, wenn man mit großen Mengen Säure zu thun hat und den Zweck lediglich durch
Absetzenlassen und Decantiren erreichen will. Man bedarf in diesem Falle großer
Mengen Wasser, sehr vieler Gefäße und einer großen Grundfläche, um diese letzteren
aufzustellen. Dabei dauert dennoch das Aussüßen der Niederschlage ziemlich lange und
erfordert unausgesetzte Bedienungsmannschaft. Je schneller man daher filtriren und
aussüßen kann, desto mehr vermindert sich der Lohnaufwand, desto weniger Gefäße sind
nöthig, desto weniger Raum bedarf man zur Unterbringung derselben. Die Freiberger Anlagen leisten in diesen Beziehungen
Vorzügliches, und es wird sich daher um so mehr verlohnen, sie noch näher zu
beschreiben, als das hier befolgte Princip (ja vielleicht der Apparate selbst mit
nur geringen Abänderungen) in der Technik noch weiter zu ähnlichen Zwecken
angewendet werden kann.
Es ist dies, soviel mir bekannt, unabhängig von den Freiberger Einrichtungen auch bereits in einem speciellen Falle geschehen;
denn der Apparat, welchen Rosenstiehl zum Filtriren von
Farben construirt und letzthin beschrieben hatVergl. Dingler's polytechn. Journal 1873, Bd. CCX
S. 446., beruht ebenfalls auf dem Filtriren mittels Luftdruck. Der einzige, übrigens
unbedeutende Unterschied zwischen beiden Einrichtungen besteht darin, daß man in
Freiberg zur Erzeugung des Vacuums Wasserdampf anwendet, während Rosenstiehl, soviel ich mich entsinne, die Luft aus dem
Raume unter der Filtrirschicht besonders wegsaugen läßt. Es würde aber leicht sein,
den Rosenstiehl'schen Apparat ebenfalls mit Dampf zu
betreiben, wie aus der folgenden Beschreibung von selbst erhellen wird.
Der Apparat ist in den Figuren 50 bis 52
dargestellt. A ist der Vacuumkessel; B das Gefäß, in welchem filtrirt und ausgewaschen werden
soll.
Als Vacuumkessel hat man einen kleinen ausrangirten Dampfkessel von etwa 2 Fuß (566
Mm.) Durchmesser und 6 Fuß (1,699 M.) Länge verwendet. Je größer man den
Vacuumkessel anwendet, desto mehr Dampf verbraucht man zur Erzielung des Vacuums,
desto weniger leicht geht aber auch das Vacuum durch Luftzutritt zurück. Ein Kessel
von dem angegebenen Inhalte dürfte auch noch größeren Anforderungen genügen, als der
Freiberger Betrieb stellt.
Man setzt durch den Hahn a den Vacuumkessel A mit einem Dampfkessel in Verbindung und läßt, indem
man den Hahn d öffnet (während c geschlossen bleibt) Dampf eintreten, welcher die Luft zum Theil
verdrängt. Dieselbe entweicht mit dem Condensationswasser durch d. Man schließt
sodann den Hahn b, nachdem einige Minuten auch Dampf mit
durch denselben ausgeblasen hat; schließt hiernach auch a und läßt darauf den Vacuumkessel kurze Zeit sich abkühlen, damit der
eingeschlossene Dampf condensire.
Nächstdem öffnet man den Hahn c, welcher den Vacuumkessel
mit dem Raume unterhalb der Filtrirschicht im Kasten B
verbindet. Derselbe ist bereits mit der zu filtrirenden Säure angefüllt, von der man
auch in dem Maße, als sich das Niveau derselben senkt, immer neue Mengen zutreten
läßt, damit in der sonst frei bleibenden Schicht von
Schwefelarsen keine Risse und Sprünge entstehen, durch welche Luft
einströmen und das Vacuum vernichtet würde. Durch Oeffnen des Hahnes c stellt sich in A und
unterhalb der Filtrirschicht gleiche Spannung her und das Quecksilber in dem
gläsernen Manometerrohr o steigt um einen gewissen
Betrag über das Niveau in der Flasche. Man schließt nun wiederum c, öffnet a, darauf auch b und verdrängt wiederum die in A vorhandene Luft durch Dampf. Sodann schließt man neuerdings b, stellt mittels a den
Dampf ab, läßt den Kessel A abkühlen, öffnet wiederum
c und erhöht damit abermals das Vacuum unter der
Filtrirschicht, was man an dem Rande des Quecksilbers im Manometerrohr erkennen
kann. Derart wird fortgefahren, bis man am Manometer etwa 2/3 bis 3/4 Atmosphäre
Ueberdruck der äußeren Luft ablesen kann. Man hat dann nur noch dafür zu sorgen, daß
immer genügender Zufluß von Säure in das Gefäß 8 stattfindet.
In dieser Weise kann man eine große Anzahl von Gefäßen B,
B₁, B₂... zugleich betreiben,
sowohl filtriren, wie aussüßen, ohne daß die Arbeit von B gestört zu werden braucht. Ist nämlich in Bezug auf B der gewünschte Ueberdruck der äußeren Luft hergestellt, so schließt man
den Hahn c und richtet mittels der entsprechenden Hähne
c₁, c₂...
einzeln nacheinander oder mehrere zusammen die übrigen Gefäße B₁, B₂, B₃... in vorbeschriebener Weise vor. Bei dieser Anordnung kann man
somit gleichzeitig filtriren oder Auswaschen und frisches
Vacuum erzeugen.
Die Hähne a, b und c:
c₁, c₂... tauchen in mit Wasser
gefüllte Gefäße ein, damit bei etwaigen Undichtigkeiten der Hähne und Zutritt von
Luft das Vacuum im Kessel nicht vernichtet werde. Das Gefäß für den Hahn d ist mit einem Ablaufhahn versehen, welcher das
Condensationswasser durchläßt, das durch die Leitung d
weggeführt wird.
Die Filtrirkästen B haben folgende Einrichtung. Die
Kästen selbst, aus 2zöllig. (47 Mm. starken) Bohlen hergestellt und mit Bleiblech
ausgeschlagen sind etwa 2 Fuß (566 Mm.) hoch und haben 4 auf 6 Fuß (1,133 ×
1,699 Meter) Grundriß. Zu größerer Sicherung gegen den Luftdruck sind die
Seitenwände des Kastens am Boden rundum noch durch eine Bohle e (Fig.
52) verstärkt, welche verhindert, daß die Bleiwand des Gefäßes durch den
äußeren Luftdruck abgedrängt und deformirt werde. Diese Bohlen e sind mehrmals gut mit heißem Theer bestrichen; sie
könnten aber auch statt dessen überbleit sein. Durch eine Anzahl von Schrauben,
deren Köpfe man in letzterem Falle durch Ueberbleien besser vor der Säure schützen
kann und welche durch die Gefäßwandungen hindurchgehen, sind diese Bohlen e gegen äußere Verstärkungsbohlen gehalten. Zwischen e und der Kastenwand bringt man eine Schicht von
Theerkitt, der unter gelindem Erwärmen des Theers beim Eintragen des Thonmehles
bereitet wird und welcher beim Erkalten langsam zu einer dichten steinharten Masse
erhärtet. Auf den Boden des Gefäßes legt man ein Pflaster von säurefesten
Chamottesteinen und auf dieses Pflaster kommt eine zweite Schicht von eben solchen
Steinen, welche zwischen sich enge, kaum halbzöllige (12 Millim. weite) Fugen
freilassen, in denen die durchfiltrirte klare Säure nach einer mittleren Hauptrinne
abläuft; in dieselbe mündet das mit dem Bleiboden verlöthete Abflußrohr 1. Dieses
Rohr 1 mündet, luftdicht verlöthet, in das Zwischengefäß C, von dessen Deckel aus auch das Verbindungsrohr mit dem Manometer o, sowie das Verbindungsrohr mit dem Kessel A, in welches der Hahn c
eingeschaltet ist, ihren Ausgang nehmen.
Bei dieser Anordnung kann keine Säure und kein saures Wasser weder in das Manometer,
noch in den Kessel gelangen – vorausgesetzt, daß das Abflußrohr m des Zwischengefäßes bis zu seinem Eintritt in das
Ablaufgefäß n über dem Sammelbassin D länger ist, als die Höhe einer von dem
Atmosphärendrucke emporgetriebenen Wassersäule.
Auf der zuletzt bemerkten Steinschicht liegt im Kasten B
bis zur Höhe der Bohlen e eine Schicht n von gepochten Quarz, unten aus gröberen Theilen bis
zur Größe einer wälschen Nuß, oben aus feineren Graupen bestehend. Ueber dieser
Quarzschicht n findet sich ein fein gelochtes Bleiblech
und oberhalb desselben ist noch eine Schicht m von
gepulvertem Schwefelarsenik – Abfälle vom Läutern des rothen Arsenikglases
ausgebreitet.
Beim Einlassen von Säure in die Gefäße muß man Sorge tragen, daß diese oberste
Schicht (deren Oberkante etwa 12 Zoll [283 Millim.] über dem Boden des Gefäßes
liegt) durch Aufschlagen des Säurestrahls nicht beschädigt werde, weshalb man, bis
ein gewisser Säurestand sich angesammelt hat, ein Bleiblech unterhalb der
Ausflußöffnung der Säure einlegt.
Wenn man bemerkt, daß Filtriren und Auswaschen trotz genügender Luftverdünnung unter
der Filtrirschicht nur noch langsam von statten gehen, so muß man die Schichten n und m, sowie das Sieb aus
dem Gefäß B entfernen und die Quarzbrocken sowie das
Schwefelarsen durch Spülen in Wasser von dem anhaftenden Niederschlag befreien. Eine
solche Reinigung der Filtrirschichten ist alle 14 Tage bis 3 Wochen nöthig.
Es erübrigt nunmehr noch, einige Worte anzufügen über die Aufstellung, welche man den
im Vorhergehenden beschriebenen Apparaten zu geben hat, damit man die einzelnen
Operationen möglichst wenig umständlich durchführen kann.
Hat man natürliche Niveaudifferenzen des Terrains, so stelle man die ganze hier
beschriebene Einrichtung unterhalb der Bleikammern und oberhalb der etwa vorhandenen
Concentrationspfannen und zwar deshalb, damit man einerseits die gereinigte und
geklärte Säure womöglich direct in die letzteren abfließen lassen kann und
andererseits, damit man die aus den Kammern kommende ungereinigte Säure in die
Gefäße über dem Fällthurm möglichst wenig hoch zu heben braucht.
Sind Niveaudifferenzen nicht vorhanden, so muß die gereinigte Säure neuerdings auf
ein oberhalb der Concentrationspfannen liegendes Niveau gedrückt werden. In Freiberg
wird die ausgefällte Säure, wie sie aus dein Fällapparate kommt, also mit dem
Niederschlag von Schwefelarsen Zusammen, auf ein um eine Etage über dem Fällthurme
befindliches Niveau gedrückt, wo das Vacuumfilter aufgestellt ist (dessen Kessel
übrigens keineswegs im gleichen Niveau zu stehen braucht). Man kann hierbei die
geklärte Säure und die Waschwässer in einem solchen Niveau sammeln, daß man für
erstere noch Fall nach den Abdampfpfannen behält, während man die letzteren im Niveau der
Entwickler, eine Etage hoch, zum Gebrauch disponibel hat. Man könnte den
Entwickelungsapparat auch in's Parterre stellen, hätte dann aber keinen Fall mehr
zum Abführen der Eisenvitriollaugen.
Mehrere Monte-jus und eine kräftige Luftpumpe sind bei der ganzen Einrichtung
unumgänglich nöthig.
Tafeln