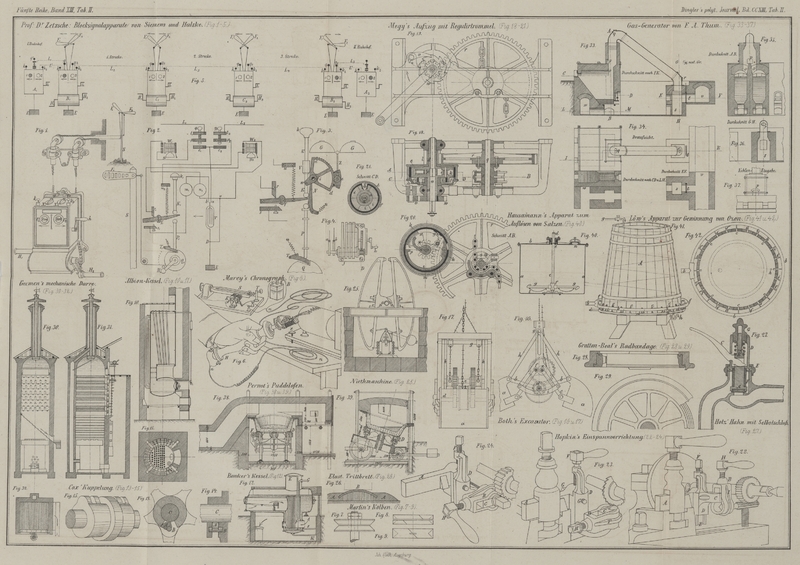| Titel: | Ueber den Aufzug mit Regulirtrommel (System Mégy): mitgetheilt von R. Neuhaus. |
| Autor: | R. Neuhaus |
| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. XXVIII., S. 108 |
| Download: | XML |
XXVIII.
Ueber den Aufzug mit Regulirtrommel (System Mégy): mitgetheilt von R. Neuhaus.
Mit Holzschnitt und Abbildungen auf Tab. II.
Neuhaus, über Mégy's Aufzug etc.
Dieser Aufzug, welcher auf der Wiener Weltausstellung nicht unbedeutendes Aufsehen
erregt hat, findet nun auch in deutschen Fabriken und Werkstätten eine zunehmende
Anwendung, nachdem man seine Vortheile neben einfacher Handhabung und Sicherheit im
Betriebe kennen gelernt hat.
Diejenigen Eigenschaften, durch welche sich dieser Aufzug vortheilhaft vor anderen
gebräuchlichen auszeichnet, sind etwa folgende:
1. Es kann nur bis zu einer bestimmten
Maximallast gehoben werden, also der Apparat durch zu große Belastung
weder direct beschädigt, noch dauernd überangestrengt werden, so daß demselben
eine große Dauerhaftigkeit gesichert erscheint.
2. Sobald die Kraft aufhört zu wirken, steht die Last
still.
3. Die Förderlast kann mit einer nach Belieben regulirbaren
Geschwindigkeit fallen, welche jedoch niemals über einebestimmte Maximalgeschwindigkeit hinausgehen kann; das Anhalten
der Last erfolgt dagegen momentan ohne Stoßerzeugung, so daß auch hierdurch
Unfälle für das Personal vermieden werden.
4. Da beim Niedergehen der die Kurbel nicht leergeht sondern stille steht, so ist das Bedienungspersonal vor
Unglücksfällen, wie dieselben bei andern Winden so häufig vorkommen,
gesichert.
5. Die Manipulationen beim Aufwinden sowohl als beim Niederlassen
sind bedeutend einfacher, wie bei ähnlichen Winden, da eine besondere Bremse nicht vorhanden ist und ein
Aus- und Einrücken der Sperrklinke wegfällt.
Textabbildung Bd. 213, S. 108
Wir wollen nun sehen, in welcher Weise diese Bedingungen von dem neuen Aufzuge
erfüllt werden, dessen Einrichtung nachfolgende ist.
Mit einer Kurbelwelle ist eine mit Leder garnirte kreisförmige Feder verbunden,
welche gegen den inneren Umfang einer glatt gedrehten Trommel einen bestimmten
Expansivdruck ausübt. Beim Vorwärtsdrehen der Kurbel wird diese Trommel mit
herumgenommen und durch eine Zahnradübersetzung sowie mittels einer sogenannten Nuß
eine Kette angezogen, und so die Last gefördert. Eine Sperrklinke verhindert beim
Loslassen der Kurbel das Niedersinken der Last. Um die Last zum Sinken zu bringen,
bedarf es nur einer Vorrichtung, um die Kreisfeder außer Berührung mit der Trommel
zu bringen, wodurch letztere frei wird und die Last in Folge ihres Gewichtes sinkt.
Wird nun die erwähnte Feder mehr oder weniger zusammengezogen, d.h. deren Lederband
weniger oder mehr in Berührung mit der Trommel gelassen, so wird die Last schneller
oder langsamer sinken; auf diese Weise hat man es daher in der Hand die
Fallgeschwindigkeit der Last zu reguliren. Wird die Vorrichtung zum Zusammenziehen
der Feder losgelassen, so preßt die Feder durch ihre Expansivkraft gegen die Trommel
und bewirkt dadurch ein sofortiges Bremsen derselben, bezieh. den Stillstand der
Last.
Damit das Niedersinken der Last nicht mit einer zu großen Geschwindigkeit
stattfindet, befindet sich in dem Apparat ein Centrifugal-Regulator. Dieser
besteht aus Bleisectoren, welche durch eine ebenfalls mit Leder garnirte Kreisfeder
zusammengehalten werden; bei der Rotation wird alsdann durch die Centrifugalkraft
der Sectoren die Feder auseinander gebogen, und mit der Ledergarnirung gegen einen
feststehenden Rand gepreßt; durch die entstehende Reibung wird somit ein
gleichförmiges Niedersinken bewirkt.
Verständlicher wird die Erklärung des Apparates mit Zuhilfenahme der Abbildungen in
Figur
18–21; Fig.
18 stellt einen solchen Aufzug im Horizontalschnitt, Fig. 19 in der
Vorderansicht, Fig.
20 im Schnitt A B und Fig. 21 im Schnitt C D dar.
Auf die Kurbelwelle a wird die Kurbel bei b aufgesteckt; etwa in der Mitte ist die Welle
vierkantig zur Aufnahme eines Daumens c. Die Kurbelwelle
bewegt sich in einer gußeisernen Büchse d d, welche im
Gestelle passend gelagert ist, und die sich in der Mitte zu einem Gehäuse e erweitert, welches den Daumen c einschließt. Seitlich von e befindet sich
ein Rand f, der glatt polirt ist und gegen welche der
Centrifugal-Regulator seine Wirkung ausübt. Auf dem einen Ende der Büchse d sitzt ein Sperrrad w, in
welches eine Sperrklinke v eingreift, deren Bewegung begrenzt ist. Um das
Gehäuse e legt sich die mit Leder garnirte Kreisfeder
k und zwar so, daß das eine Ende in den Umfang des
Gehäuses e eingreift, daselbst also einen Stützpunkt
hat, während das andere Ende bei g durch eine kleine Gall'sche Kette, die über eine Rolle im Gehäuse e geht, mit dem Daumen c in
Verbindung steht. Man ist daher durch Rückwärtsdrehen der Kurbel –
entgegengesetzt der Pfeilrichtung – im Stande, die Feder k zusammenzuziehen.
Von der einen Seite ist über die Büchse d eine glatt
polirte Trommel m mit angegossenem Getriebe l (Fig. 18) aufgeschoben,
gegen welche die erwähnte Kreisfeder k durch ihre
Expansivkraft drückt dergestalt, daß beim Vorwärtsdrehen der Kurbel die Trommel in
der Richtung des Pfeiles mitgenommen wird. Auf der Büchse d befindet sich ferner noch die Scheibe n,
welche den Centrifugal-Regulator aufnimmt. Dieser Regulator besteht aus 7
Bleisectoren i (Fig. 21), die auf n aufgelegt sind und durch eine ebenfalls mit Leder
garnirte Kreisfeder t zusammengehalten werden. Ein Stift
o nimmt die Bleisectoren bei der Rotation mit. Sinkt
die Last, so rotiren die Bleisectoren und überwinden durch ihre Centrifugalkraft die
Spannkraft der Feder. Beim Ueberschreiten einer gewissen Geschwindigkeit aber
drücken sie das Lederband t gegen den beim Niedergehen
der Last feststehenden Ring f an, wodurch die
entstehende Reibung eine Zunahme der Geschwindigkeit verhindert, und die Last
gleichförmig niedergelassen wird. Durch die Trommel m
und Deckel n wird in dieser Weise der ganze innere
Mechanismus verschlossen und vor Staub geschützt. m und
n sitzen lose auf der Büchse d und können sich frei bewegen, wenn die Feder k zusammengezogen ist.
In das Zahnrad l greift das Rad r ein, welches auf einer schmiedeisernen, im Gestelle gelagerten Welle q aufgeschoben ist. Mit dem Rade r ist die sogenannte Nuß verbunden, welche das Anziehen der Lastkette
besorgt. Die Nuß s ist ein besonderes Gußstück, welches
4 Vertiefungen für die Kettenglieder enthält; sie ist von dem Kettenführer u umgeben, der ein Ausweichen der Kette verhindert und
für eine gute Ableitung derselben sorgt. Durch diese Einrichtung wird die Kette sehr
sicher erfaßt, so daß ein Rutschen derselben unmöglich ist. Es ist jedoch nöthig,
daß dieselbe immer angezogen ist, weshalb ein Kugelgewicht dicht oberhalb des
Hakens, an welchem die Last hängt, angebracht ist. Dieses Kugelgewicht dient denn
auch zum Niederlassen, wenn die geförderte Last oben abgenommen ist.
Die Handhabung des Apparates ist nun folgende:
Zum Heben der Last dreht man die Kurbel in der Richtung des Pfeiles (Fig. 19); dadurch stößt
der Daumen c mit der Kante x
gegen Vorsprünge an dem
Gehäuse e, in Folge dessen dasselbe gedreht wird, ebenso
wie die durch die Expansivkraft der Feder k mitgenommene
Trommel m. Durch die Zahnräder l,
r und die Nuß s wird die Bewegung auf die Kette
übertragen und die an derselben hängende Last gehoben. Da die Feder k mit einem bestimmten Drucke gegen die Trommel m drückt, so wird man mit einem bestimmten Apparate nur
eine gewisse Maximallast zu fördern im Stande sein, indem bei einer größeren Last
die Federgarnirung an der Trommel einfach gleiten muß. Der Apparat ist demnach vor
zu großer Belastung geschützt.
Hört die Kraft auf die Kurbel auf zu wirken, so verhindert der Sperrhaken v die Zurückbewegung; daher Stillstand der Last.
Um die Last zum Sinken zu bringen, braucht man die Kurbel nur ein wenig
zurückzudrehen, wodurch mittels der Gall'schen Kette die
Feder k zusammengezogen, die Trommel m also frei gemacht wird. Ein zu starkes Zusammenziehen
der Feder ist durch Anschlag des Daumens mit seiner Kante z gegen den Vorsprung p im Innern des Gehäuses
e verhindert; dadurch ist auch die kleine Gall'sche Kette vor einer etwaigen zu großen
Inanspruchnahme geschützt. Bei einer gewissen Geschwindigkeit fängt alsdann der
Centrifugal-Regulator an seine Wirkung auszuüben, indem derselbe durch
Bremsen an dem feststehenden Rande f jede Zunahme der
Geschwindigkeit verhindert. Mittels der Kurbel kann man nun die Fallgeschwindigkeit
der Last bis zu einer bestimmten, nicht zu großen Geschwindigkeit variiren. Zieht
man nämlich die Kurbel nur wenig zurück, so wird die Last langsam sinken, jedoch
immer gleichförmig, so lange die Trommel m mit der
Federgarnirung k in Berührung bleibt; zieht man die
Kurbel stärker zurück, so wird die Last schneller sinken.
Bei großen Fallhöhen kann man den Druck auf die Kurbel durch ein angehängtes Gewicht
hervorbringen, wodurch das Sinken der Last automatisch geschieht.
Soll die Last wieder zum Stillstand gebracht werden, so braucht man nur die Kurbel
loszulassen, indem alsdann die Feder k durch ihre
Expansivkraft sich ausdehnt und ihre Ledergarnirung gegen die Trommel m preßt, auf diese Weise also eine Bremsung, somit
Anhalten der Last ohne Stoßwirkung hervorbringt.
Aus dem Vorhergehenden ist nun ersichtlich, daß zunächst die Eingangs erwähnten drei
ersten Eigenschaften dem Apparate thatsächlich zukommen; ebenso folgt auch aus der
Beschreibung, daß die Kurbel während des Niedersinkens der Last stille steht, und
ein Rücken der Sperrklinke nie stattfindet. Ferner dient zum Anhalten der sinkenden
Last derselbe Mechanismus wie zum Aufwinden, und da dieser nur von der Kurbel aus
gehandhabt wird, so ergibt sich die ganze Manipulation des Apparates als sehr
einfach, nämlich kurz wiederholt:
Vorwärtsdrehen der Kurbel – Steigen der Last.
Loslassen der Kurbel – Stillstand der Last.
Geringes Rückwärtsdrehen der Kurbel – Sinken der
Last.
Dabei Loslassen der Kurbel – Stillstand der Last.
Wird also die Kurbel unvorsichtiger Weise einmal losgelassen, so
können nie Unglücksfälle eintreten, da die Last sofort zum Stillstande kommt.
Sehr leicht läßt sich dieser Aufzug zum Transmissionsbetriebe einrichten, indem man
eine Riemenscheibe aufsetzt; gewöhnlich macht man dazu in diesem Falle Sperrrad w und Riemenscheibe aus einem Stück. An Stelle der
Kurbel tritt ein Handrad, mit welchem das Niederlassen der Last bewirkt wird.
Der ganze Apparat läßt eine zweckmäßige Construction erkennen: große Lagerflächen der
schnell rotirenden Theile, somit geringe Abnützung derselben, leichte Aufstellung
und Befestigung. Ebenso ist durch passend angebrachte Schmierlöcher für eine gute
Oelung der inneren Theile vorgesorgt, welche gegen Verstaubung vollkommen geschützt
sind.
Was die Abnützung der Lederbänder anbelangt, so hat sich bisher schon ergeben, daß
sich die Garnitur der Feder k fast gar nicht abnützt,
und daß die Abnützung des zum Regulator gehörigen Lederbandes nur sehr unbedeutend
ist. Ebenso kann die Abnützung der Kettennuß s klein
gehalten werden, wenn für gute Schmierung derselben und vor allen Dingen der Kette
selbst gesorgt wird. Eine Verlängerung der einzelnen Kettenglieder – und
demzufolge schlechtes Einlegen der Kette in die Nuß – wird nicht so sehr zu
befürchten sein, da die Constructeure für ihre verschiedenen Aufzüge die Kette viel
stärker ausführen, als dies gewöhnlich der Fall zu sein pflegt. Beispielsweise ist
die Kette für den 6 Centner Aufzug 8 Millim. stark, für den 12 Centner Aufzug 10,5
Millimeter.
Alle erwähnten Vortheile haben sich durch eingehende Versuche an vorhandenen
Apparaten auch bewährt befunden, so daß die Zuverlässigkeit dieses Aufzuges außer
Zweifel steht, und derselbe einer vielfachen Anwendbarkeit fähig ist.
Der Aufzug ist in allen deutschen Staaten inclusive Preußen und in verschiedenen
anderen Ländern patentirt. Die Ausführung erfolgt in verschiedenen Größen von 3, 6,
12, 20, 30, 40 Centner Tragfähigkeit und darüber; sie sind entweder horizontal und vertical
verwendbar, oder auch zur Befestigung an eine Wand eingerichtet.
Die Vertretung für das deutsche Reich hat Ingenieur Stauffer in Magdeburg übernommen.Hrn. Ingenieur Stauffer ist es gelungen, die
Construction des oben beschriebenen Aufzuges wesentlich zu Vereinfachen und
dadurch auch dessen Preis etwa um 1/3 des bisherigen zu reduciren. Wir
hoffen in Kürze über den verbesserten Aufzug (System Stauffer-Mégy) referiren
zu können. Die Red.
Tafeln