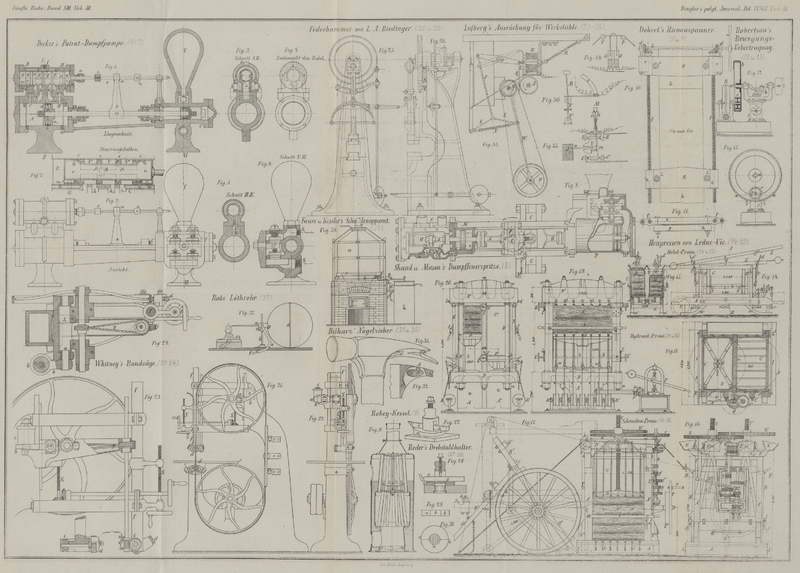| Titel: | Lufbery's selbstthätige elektrische Ausrück-Vorrichtung für Wirkmaschinen. |
| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. LVI., S. 200 |
| Download: | XML |
LVI.
Lufbery's selbstthätige elektrische Ausrück-Vorrichtung für
Wirkmaschinen.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Lufbery's selbstthätige elektrische
Ausrück-Vorrichtung für Wirkmaschinen.
Seit der Vorrichtung von Radiquet und Lecêne, welche auf der Pariser Ausstellung 1867 zu
sehen warBeschrieben in diesem Journal, 1870 Bd. CXCV S. 304 und 480., sind weitere Versuche zur Erreichung selbstthätiger Auslösungen des Triebes
mechanischer Wirkstühle nicht bekannt geworden. Es sind indeß seit einiger Zeit in
einer Wirkwaarenfabrik in Langlée bei Montargis (Frankreich) Ausrückapparate
in Verwendung, welche sich sehr gut bewähren und jedenfalls weitere Verbreitung
verdienen. Im Allgemeinen ist dabei die Einrichtung so getroffen, daß für eine
Anzahl Stühle eine elektrische Batterie oder eine magnet-elektrische
Maschine einen Strom liefert, und daß dieser durch die einzelnen möglichen
Zufälligkeiten: Fadenbruch, Einlaufen zu starker Fäden und Verbiegen der Nadeln,
welche große Störung in der Production und langen Aufenthalt des Arbeiters
verursachen, sofort einem in der Nähe der Triebwelle befindlichen Elektromagneten
mitgetheilt wird, welcher dann die Maschine zum Stillstande bringt.
Die Wirkung des Elektromagneten auf den Antrieb der Wirkmaschine wird mit Hilfe der
Figur 33
deutlich. A ist die Transmissionswelle, welche durch
eine Reibscheibe die Rolle B umdreht, und diese bewegt
durch einen Riemen die Antriebsscheibe D des
Wirkstuhles. Die Achse von B liegt in einer oben
gegabelten Stange W, welche um die Achse der
Antriebsscheibe D ausschwingen, also die Rolle B nach A hin oder von A hinweg schieben kann. Die beiden Stäbe E, E sind zusammen mit der Stange F und einzeln, der eine mit der Stange W und
der andere mit einem drehbar aufgehängten Arme H
verbunden. F hängt wiederum an dem zweiarmigen Hebel G, welcher eine Platte Q
trägt und in der Regel die durch die punktirte Linie angedeutete Lage einnimmt, in
welche sein vorderes Ende auf dem Nahmen L aufliegt und
Q hoch gehoben, F aber
hinabgedrückt wird. Dabei entsteht durch E, E eine
Kniehebelwirkung und die Rolle B wird an A angedrückt, um genügende Reibung zur Mittheilung der
Bewegung zu erzeugen. Damit dieser Druck elastisch bleibt, ist die Feder M eingeschaltet, welche den Arm H rechts hinzieht, so daß er eine immerhin nachgiebige Stütze des
Kniehebels bildet. L ist nun ein um sein unteres Ende
beweglicher Rahmen, welcher von dem Elektromagneten K
angezogen, also oben nach rechts hin verschoben wird, wenn das weiche Eisen des
letzteren durch den hindurchgehenden elektrischen Strom zum Magneten wird. Wird
daher die Leitung geschlossen, also der Strom nach K
geleitet, so rückt L oben nach rechts, der Hebel G fällt herab und die Platte Q fällt gerade auf A und B auf – und zwar an der Stelle, an welcher beide
Scheiben an einander gedrückt werden. Diese in Richtung der Pfeile sich drehenden
Scheiben erfassen nun die Platte Q, welche darauf von
der Betriebskraft selbst noch weiter abwärts gezogen wird, so daß der Hebel G rechts sich senkt und links mit F sich hebt und die Stange W nach links zieht.
Hierbei endlich wird die Scheibe B von A abgezogen und an einen mit Kautschuk ausgefütterten
Bremsklotz angedrückt, so daß sie – und der Wirkstuhl natürlich mit ihr
– sofort still steht. Soll der Stuhl wieder eingerückt werden, so muß man die
Platte Q heben, also die Stange F senken und die Kraft der Feder N überwinden,
so daß die Stangen E, E sich ausspreizen und die Rolle
B an A andrücken.
Am Stuhle selbst sind die in den Figuren 34 bis 36
gezeichneten kleinen Vorrichtungen angebracht, welche den Strom in den
Elektromagneten K senden, wenn der Faden zerrissen oder
eine Nadel verbogen oder ein erheblich stärkerer Faden als gewöhnlich eingeführt
worden ist. Jeder zu verarbeitende Faden liegt nahe an der Stelle, an welcher er in
die Nadeln eingeführt und kulirt wird, auf zwei Rollen P
(Fig. 34)
und trägt zwischen beiden eine Drahtgabel, deren Enden je in ein Gefäß G mit Quecksilber reichen, letzteres aber für gewöhnlich
nicht berühren. Bis zu den beiden Gefäßen sind ferner die Leitungen von der Batterie
und vom Elektromagneten K (Fig. 33) geführt; wenn
nun der Faden reißt, so fällt die Gabel in das Quecksilber, schließt die Leitung und
der Stuhl bleibt sofort stehen.
Für gebogene, d.h. aufwärts stehende oder abwärts gezogene Nadeln, oder für zu dick
eingeführtes Garn (wenn der laufende Faden von der Spule mehrere Lagen Garn mit
fortreißt), ist an einer Stelle des Stuhles der in Fig. 35 in der
Seitenansicht und in Fig. 36 in der
Vorderansicht gezeichnete Apparat angebracht. Man hat dabei namentlich eine
Verwendung für französische Rundstühle im Auge gehabt, und es stellt d die Nadelbarre oder den Nadelkranz und a eine Nadel vor. Die Nadeln sind horizontal im Kranze
befestigt und rotiren um dessen Mittelachse; dicht über und unter ihrer Reihe sind
die leicht beweglichen Platten V und V' angebracht und mit der Schwingungsachse der oberen
Platte V ist ein hammerähnlicher Hebel M verbunden, dessen Arm m
außerhalb der Nadelreihe und (wie Fig. 36 zeigt) links bis
über V' hinabreicht, – wenn die Drehungsrichtung
des Nadelkranzes eine solche von rechts nach links ist. Kommt nun eine, nach oben
oder unten gebogene Nadel, oder eine solche, auf welcher ein sehr dicker Faden
liegt, an diese Stelle, so streift sie entweder an V
oder V', schwingt eine dieser Platten zu Seite und
bewegt den Arm m nach links (Fig. 35), also den Hammer
M nach rechts, so daß der Hammerkörper zwischen die
Endenschienen e der elektrische Leitung eintritt, beide
berührt und sie also mit einander verbindet. Damit wird aber der Strom nach dem
Ausrückapparat übersendet und der Stuhl zum Stillstande gebracht. Ein größerer
Rundstuhl, welcher vielleicht vier Systeme hat, braucht einen Ausrückapparat (Fig. 33), vier
Apparate (Fig.
34) (für jeden Arbeitsfaden einen) und einen oder vielleicht zwei Apparate
der letzten Art (Fig. 35 und 36), um an zwei Stellen
des Stuhles die Nadellage und Fadenstärke controlliren zu können. Hierdurch wird es
möglich, einem Arbeiter die Aufsicht über mehrere, bis vier Stühle zu übertragen,
während er bis jetzt mit einem genug zu thun hatte. In der erwähnten französischen Fabrik ist anstatt
der elektrischen Batterie eine magnetelektrische Maschine verwendet, welche einen
zur Benützung für 150 Stühle hinreichenden Strom liefert. (Aus der Revue industrielle,
Februar 1874 S. 8 durch die deutsche Industriezeitung, 1874 S.
263.)
G.
W.
Tafeln