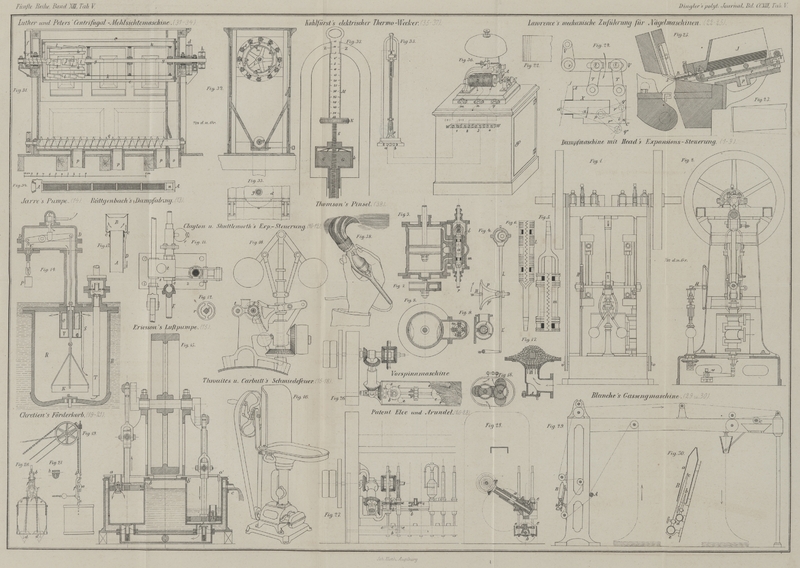| Titel: | Luther und Peters' Centrifugal-Mehl-Sichtemaschine; von Hermann Fischer in Hannover. |
| Autor: | Hermann Fischer |
| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. XCV., S. 387 |
| Download: | XML |
XCV.
Luther und Peters' Centrifugal-Mehl-Sichtemaschine; von Hermann Fischer in
Hannover.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Fischer, über Luther und Peters'
Mehl-Sichtemaschine.
Die von dem Mühlenbaumeister Lucas in Dresden
erfundeneDingler's polytechn. Journal, 1863 Bd. CLXVII S. 19. und von verschiedenen Constructeuren verbesserte sogenannte
Centrifugal-Sichtemaschine hat sich so vortrefflich bewährt, daß sie wohl
bald die bisherige Sichtemaschine, die sogenannten Cylinder, verdrängen wird.
Ich bin in der Lage, in Figur 31 bis 34 eine genaue
Zeichnung der Construction von Luther und Peters in Wolfenbüttel zu bringen. Es ist Figur 31 ein verticaler
Längenschnitt, Fig.
32 ein Querschnitt, Fig. 33 eine theilweise
Ansicht von der Antriebsseite und Figur 34 die
Detail-Darstellung eines sogenannten „Rähmchens.“
Der Behälter zur Aufnahme des zu sichtenden Mahlgutes besteht aus zwei gußeisernen
Scheiben a und b mit
angegossenen Hohlzapfen, aus den diese beiden Scheiben verbindenden sechs
┴förmigen Eisen c und den zwischen diesen
angebrachten, mit Seidengaze überzogenen Rähmchen A
(Figur
34).
Die beiden Böden a und b und
die Eisen c bilden das starre Gerüst dieses den
sogenannten Siebcylindern ähnlichen und die Sichtefläche tragenden sogenannten
Mantels. Die Hohlzapfen der gußeisernen Böden drehen sich in passenden Lagern; der
Zapfen von d ist soweit über sein Lager verlängert, daß
Platz zur Anbringung der Betriebsriemenrolle d
vorhanden; der Zapfen von a ist bis in den Körper e verlängert, in welchen durch Vermittelung des
Holzrohres f das zu sichtende Mahlgut fällt.
Die Rähmchen A sind an ihrer schmalen, geraden Seite mit
Seidengaze bezogen; nachdem sie an dem Orte ihrer Bestimmung befestigt, bildet ihr
Gazebezug ein glattes, 12 eckiges Prisma, welches (wie der Durchschnitt Fig. 32 zeigt)
von dem ursprünglich beabsichtigten Cylinder nur wenig abweicht.
In der Mitte dieses Prisma dreht sich in besonderen Lagern die Welle g, welche durch die Riemenrolle h gedreht wird. Auf dieser Welle g sind 4
gußeiserne Radsterne i befestigt, die ihrerseits
Flachschienen k tragen. Jede dieser 5 Flachschienen k ist mit 8 Flügeln oder Schaufeln l ausgerüstet, die mit je einer Schraube m (Fig. 32) festgehalten
werden. Auf g ist ferner eine Schnecke angebracht,
welche sich in dem Hohlkörper e dreht. Die Welle g dreht sich (im Durchschnitt Fig. 32 gesehen) rechts
herum und macht circa 300 Umdrehungen in der Minute. Der
mit Seidengaze bezogene Mantel dreht sich dagegen in umgekehrter Richtung und macht
nur circa 30 Umdrehungen pro
Minute.
Das durch die Zuführung nach e gefallene Mahlgut wird
durch die Schnecke der Welle g in den Mantel gezogen und
von den Schaufeln l in nahezu tangentialer Richtung
gegen die Siebfläche geschleudert. Da die Flügel l gegen
die Welle g geneigt sind, so bewirken sie gleichzeitig
eine Verschiebung des Mahlgutes in der Längenrichtung, so daß der Rest desselben
zuletzt bei dem Boden b anlangt, wo er Gelegenheit hat,
durch die nicht mit Gaze bezogene Partien n der Rähmchen
(siehe Fig.
34) in das Kleienrohr o zu fallen. Das durch
die Seidengaze gefallene Mehl wird dagegen durch die Schnecke q den Mehlröhren p zugeführt.
Aus der angegebenen Einrichtung geht hervor:
1) daß die Schrottheilchen viel gleichförmiger und dabei
energischer gegen die Siebflächen geführt werden;
2) daß, da in dem fortwährend bewegten Schrot die Theilchen
desselben sich nach ihrer specifischen Schwere gruppiren, das Mehl also mehr,
die leichteren mit Kleietheilen behafteten Partikelchen aber weniger mit der
Siebfläche in Berührung kommen, dagegen energischer durch die Flügel l nach rechts transportirt werden als das schwerere
Mehl.
Daraus folgen die durch die Erfahrung bestätigten Eigenschaften der
Centrifugal-Sichtemaschine:
a) dieselbe Größe der Siebfläche
bearbeitet ein weit größeres Mahlquantum als bei dem alten Cylinder. Die hier
gezeichnete Maschine bewältigt mit Bequemlichkeit – wenn, wie es
neuerdings fast allgemein geschieht, eine Vorsichtekiste zur Trennung der groben
Kleientheilchen von dem übrigen Schrot angewendet wird – den Schrot von zwei flott
arbeitenden Flachmahlgängen, also in der Stunde circa 500 Kilogrm. Während bei gewöhnlichen
„Cylindern“ höchstens Gaze Nr. 12 oder 13 verwendet
wird, so kann hier Seidengaze Nr. 14 oder 15 zur Anwendung kommen.
b) Das Mehl wird weniger leicht bunt als
bei gewöhnlichen „Cylindern.“
c) Die Gaze nützt sich rascher ab. Da
indessen – wie schon erwähnt – überhaupt weniger Gaze nöthig ist,
so gleicht sich dieser Uebelstand wieder aus.
Die vorliegende Maschine bietet außer den hier genannten Vortheilen noch einige für
den Müller werthvolle Vortheile. Bei wechselndem Getreide ist es erwünscht, das zu
Sichtende rascher oder weniger rasch durch die Maschine passiren zu lassen, oder mit
anderen Worten den Schrot weniger oder kräftiger zu behandeln; ja zuweilen wird es
nothwendig, mit den Gazenummern zu wechseln. Beides erlaubt die
Centrifugal-Sichtemaschine, ohne daß große Mühe angewendet zu werden
brauchte.
Ist ein zweiter Satz Rähmchen vorhanden, welche mit den anderen Gazenummern bezogen
sind, so können diese Rähmchen binnen kurzer Zeit in die Maschine eingesetzt werden.
Ebenso ist es leicht, bei irgend einer Beschädigung der Gaze ein Rähmchen mit
unverletzter Gaze einzuschalten. Oben wurde erwähnt, daß jede der Schaufeln l mittels einer Schraube m
auf den Flachschienen k befestigt sei. Diese eine
Schraube genügt zur Fixirung der Schaufel nicht vollständig. Es sind vielmehr in den
Schienen k für jede Schaufel noch zwei Stifte rr (Fig. 31) befestigt,
welche in entsprechende Löcher der Schaufeln greifen. Jede Schaufel enthält aber 6
Löcher, so daß eine Aenderung der Neigung der Schaufeln zu erreichen ist: durch
Lösen der erwähnten Schraube, geringes Abheben der Schaufel und Aufstecken auf die
Stifte unter Benützung zweier anderer correspondirender Löcher der Schaufel. So kann
mit leichter Mühe eine größere oder kleinere Zahl der Schaufeln in eine andere Lage
gebracht werden, womit jede gewünschte Veränderung in der Durchgangsgeschwindigkeit
des Schrotes zu erreichen ist.
Der Preis der Centrifugal-Sichtemaschinen weicht nur wenig ab von demjenigen
gleichwertiger sogenannter Cylinder.
Hannover, im August 1874.
Tafeln