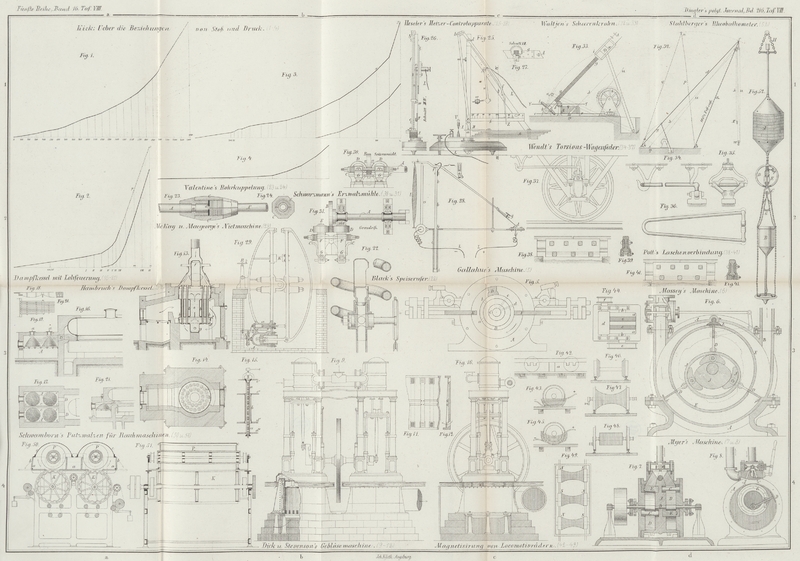| Titel: | Dampfkesselanlage für Feuerung mit nasser Lohe, Sägspänen &c.; von Schedlbauer. |
| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 395 |
| Download: | XML |
Dampfkesselanlage für Feuerung mit nasser Lohe,
Sägspänen &c.; von Schedlbauer.
Mit Abbildungen auf Taf.
VIII [a/3].
Schedlbauer, über Dampfkessel mit Lohefeuerung.
Die in Fig. 16
bis 21
abgebildeten Dampfkesselanlagen mit Lohefeuerungen sind in der
Actien-Lederfabrik Giesing (München) seit einigen Jahren in Anwendung und haben
sich bei unausgesetztem Betriebe vollkommen bewährt.
Fig. 16 und
17 zeigt
eine Dampfkesselanlage, welche nur für Feuerung mit nasser Lohe bestimmt ist.
Dieselbe besteht aus zwei neben einander liegenden Vorfeuern (Oefen) A, A, wovon jedes im lichten
2m,4 lang, 1m breit und 0m,75 hoch ist und
einen Rost hat, wie er in Fig. 18 bis 20 angedeutet
ist.
Die Beschickung des Rostes geschieht durch zwei Löcher a,
welche von oben durch das feuerfeste Ofengewölbe angebracht sind, und zwar wird die
Beschickung in der Weise ausgeführt, daß die Lohe abwechselnd vor eines der beiden
Fülllöcher des Ofens auf einen Haufen oben aufgeworfen und hierauf der Deckel des
betreffenden Loches entfernt wird, so daß die Lohe schnell auf den Rost fällt und so
einen Haufen bildet. Nach vollendeter Beschickung sind die betreffenden Oeffnungen
sogleich wieder zu schließen.
Der Dampfkessel hat eine Gesammtheizfläche von 33qm. Das Feuer zieht vom Roste aus durch
zwei Oeffnungen D nach dem Hauptkessel, unter diesem
nach hinten, fällt hier nach abwärts, zieht, die Außenwände der beiden Siederöhren
bestreichend, nach vorne, woselbst angelangt es in einen verticalen Canal herabfällt
und durch den Fuchscanal in den Schornstein entweicht. Am hinteren Theile der
Kesselanlage befindet sich eine Grube, in welcher sich die Flugasche sammelt, und
woraus sie leicht entfernt werden kann. Die auf den Rost fallende Lohe bildet
ziemlich regelmäßige Kreiskegel, und es würden sich daher bei c freie Rostflächen ergeben, welche mit feuerfesten Ziegeln zu bedecken
sind.
Bei der Dampfkesselanlage, welche in Fig. 21 dargestellt ist,
wird Lohe mit Kohlenklein vermischt als Heizmaterial angewendet. Der Kessel hat hier
nur eine Gesammtheizfläche von 7qm, eine Rostfläche von 1qm und daher auch nur einen Ofen als
Vorfeuerung mit auch nur einer Beschickungsöffnung a. Im
Uebrigen ist die Dampfkesselanlage dieselbe wie die vorher beschriebene.
Der nassen gebrauchten Lohe, wie sie aus den Gruben kommt, wird vor Benützung als
Brennmaterial mittels Walzenpressen (vergl. z. B. 1869 192 188) der größte Theil ihrer Feuchtigkeit entzogen. (Im Auszug aus dem
bayerischen
Industrie- und Gewerbeblatt, 1875 S. 81.)
Tafeln