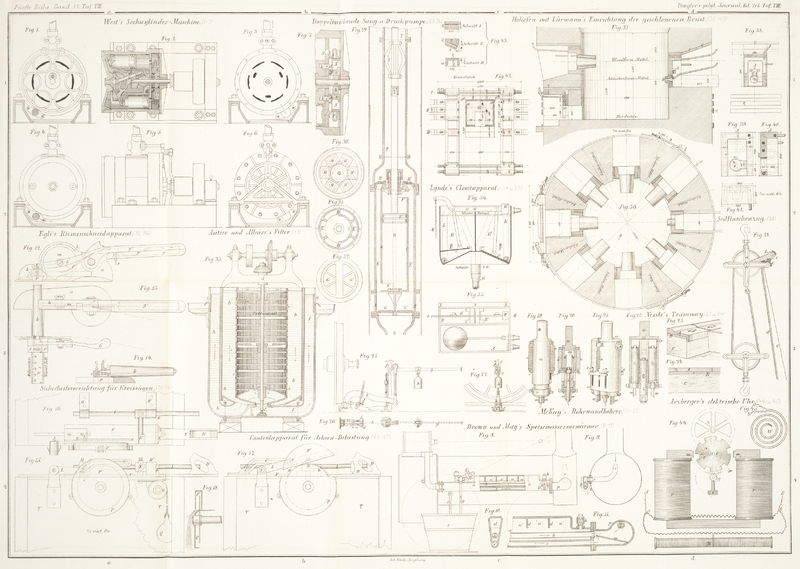| Titel: | McKay's Rohrwandbohrer. |
| Fundstelle: | Band 217, Jahrgang 1875, S. 454 |
| Download: | XML |
McKay's Rohrwandbohrer.
Mit Abbildungen auf Taf.
VIII [c.d/3].
McKay's Rohrwandbohrer.
Die Idee, zum Ausbohren weiter Löcher (wie z.B. bei Rohrplatten) solche Bohrwerkzeuge
zu verwenden, welche ohne Vorbohren eines kleineren Loches direct angewendet werden
können, ist nicht neu. Referent erinnert da nur an Webster's Rohrwandbohrer (beschrieben 1869 193
446), bei welchem die Bohrerspitze in dem Maße nachgibt, als die Bohrerschneide
tiefer in das Blech eindringt, aus welchem eine Scheibe (der abfallenden Späne
wegen) von etwas kleinerem Durchmesser, als die Lochweite beträgt, geschnitten
wird.
Der vorliegende, von der Maschinenfabrik Menzies und Blagburn in Newcastle-on-Tyne nach McKay's Patent ausgeführte Bohrer ist nach demselben
Princip, aber in seiner Einrichtung viel praktischer construirt als der oben
erwähnte, dürfte daher bald eine allgemeine Verbreitung erlangen.
Ein einfacher McKay'scher Rohrwandbohrer für Löcher mittlerer Weite ist in Fig. 19 und
20
dargestellt. Die Bohrerspitze i, welche in den
vorgekörnten Mittelpunkt des zu bohrenden Bleches eingestellt wird, ist (analog wie
bei Webster) getrennt vom eigentlichen Bohrer m, welcher
mit seiner Einspannbüchse l concentrisch über die
Spindel i der Bohrerspitze geschoben ist.
Das obere Ende der Spindel i ist kolbenartig in die
Einspannbüchse l eingepaßt, welch letztere selbst wie
ein Kolben in dem hohlen Bohrfutter a eingelassen ist.
(Die erforderliche Dichtung von i und l ist durch Lederstulpen erzielt.) Die Einspannhülse 1
erhält durch zwei Stifte c, c in Schlitzen des Futters
a eine verticale Führung und wird durch zwei
kräftige, an c, c angreifende Spiralfedern n, n stets nach aufwärts gezogen. Da nun der Hohlraum des
Bohrfutters a mit Flüssigkeit (Oel oder Wasser, welches
durch das Schraubenloch s eingeführt wird) vollgefüllt
ist, so nimmt in der Ruhelage die Bohrerspitze i die
tiefste, der Bohrer mm aber die höchste Stellung
ein.
Wird nun das Werkzeug in der Bohrmaschine befestigt und zum Bohren einer Platte
eingestellt, so rückt die Bohrerspitze i nach Maßgabe
der Zuschiebung der Maschinenbohrspindel in das Hohlfutter a hinein. In Folge dieses Aufganges drückt aber die Flüssigkeit den Bohrer
m um ebensoviel nach abwärts, bis endlich aus der
Blechplatte eine runde Scheibe herausgebohrt, das Loch also vollendet ist, worauf
die Spiralfedern n, n das Werkzeug in den Normalzustand
zurückführen, so daß der Bohrer zum Bohren eines anderen Loches ohne weiteres bereit
ist.
Zum Bohren größerer Löcher wählt man einen Rohrwandbohrer mit zwei Messern m, m, welche in gleichem Abstand von der Bohrerspitze
i festgeschraubt werden. Es erhält dann das Werkzeug
die Einrichtung, wie sie nach Vorstehendem ohne weitere Beschreibung aus Fig. 21 und
22
deutlich genug hervorgeht.
J. Z.
Tafeln