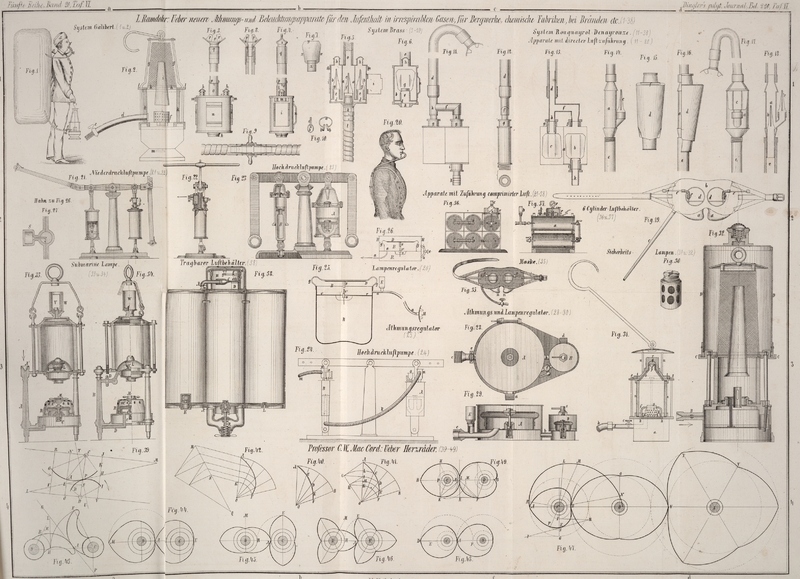| Titel: | Faure und Kessler's Platinschale. |
| Autor: | Friedr. Bode |
| Fundstelle: | Band 220, Jahrgang 1876, Nr. , S. 334 |
| Download: | XML |
Faure und Kessler's
Platinschale.
Mit Abbildungen auf Taf. V [a.
b/1].
Faure und Keßler's Platinschale.
Engineering bringt in seiner Nummer vom 25. Februar d.
I. neben einer Beschreibung der Platinschalen von Faure und Keßler zum Concentriren von Schwefelsäure auf 66°
B. auch den interessanten Auszug der Verhandlungen eines
Processes, welcher wegen des Schalenapparates zwischen den
Erfindern und dem englischen Fabrikanten H. Wallace in Battersea zum Austrage
gekommen und zu Gunsten der Ersteren entschieden worden ist. Ich
füge der Beschreibung des Apparates diejenigen Bemerkungen aus
jenen Verhandlungen bei, welche die Construction des Apparates
betreffen. Die frühere Anordnung der Schalen kann hier
übergangen werden, da dieselben von mir in diesem Journal (*1874
211 26) *1874 213 204) bereits beschrieben
sind.
Figur 10 zeigt einen Längenschnitt von zwei zu einander
gehörigen Schalen, Figur 11
einen Querschnitt der neuern Anordnung; Figur 12
gibt eine perspectivische Ansicht zweier wiederum etwas
abweichend bedeckter Schalen; Figur 13
veranschaulicht die Verbindung zwischen Schale und Bleikranz.
Diese letztere Figur ist den Proceßverhandlungen beigegeben. Man
sieht aus den Schnitten, daß die flachen Schalen a frei über dem Feuer hängen und sich
auf einen eisernen Ring k stützen,
welcher auf der Oberkante des Mauerwerkes n liegt (die Buchstaben beziehen sich auf Figur
13). Jede Schale ist völlig eingeschlossen von einer
bleiernen Glocke f. Die in den
Schnitten dargestellten Schalen haben ca. 72cm
Durchmesser und 13cm Tiefe; die Oberkante der
Schale ist abwärts gekrempt. Unter der Umkrempung befindet sich
ein bleierner ringförmiger Wulst c,
welcher die Innenkante eines flachen kreisförmigen Bleikranzes
abgibt. Der äußere und obere Theil dieses Kranzes hat zwei
concentrische Flanschen, die bei p
einen Wasserverschluß bilden, in welchen die innen hohle Glocke
f eintaucht. Der ganze Bleikranz, in
welchen sich schwache Destillatsäure d ansammelt, deren Standhöhe sich nach der Höhe des
Ablaufröhrchens g richtet, ist durch
zwei eiserne Ringe i und m unterstützt; davon befindet sich i auf verstellbaren Trägern l, während m
durch im Mauerwerk sitzende Keile gehalten wird. Die Glocken
haben für die obigen Schalen 1m,05 äußern Durchmesser und
besitzen in drei Absätzen ringförmige Wassermäntel. Zwischen
jedem Absatz ist um die Glocke zur Versteifung ein eisernes Band
gelegt; an diesen sind auch die Stücke angebracht, welche die
Bänder mit verticalen Trägern verbinden, die die schwebende
Glocke tragen.
Die Höhe des cylindrischen Theils der Glocke ist 1m,30;
sie endigt in einem kurzen conischen Stück mit einer rohrartigen
Oeffnung, um welche ein hydraulischer Verschluß gebildet ist. In
letztern taucht das Rohr, welches die etwa noch nicht
condensirten Dämpfe nach den Bleikammern abführt.
Mit Hilfe eines Dampfstrahles, der in dieses Rohr eingeblasen
wird, ruft man ein Ansaugen von Luft hervor, welche zwischen der
Umkrempung der Schale a und dem
Wulst c unter die Glocke tritt und
die Dämpfe aus derselben verdrängt. Ein Strahl Wasser läuft
fortwährend auf den obern Theil der Glocke und geht von da nach
und nach in die drei Wassermäntel. Der Auslauf g für die Destillatsäure ist in solcher
Weise angeordnet, daß die Unterkante des umgekrempten
Schalentheils noch einen hydraulischen Verschluß bilden kann
— derart jedoch, daß die Höhe der Säureschicht nur gering
ist und der Dampfstrahl eine solche Verdünnung hervorbringen
kann, daß die äußere Luft durch den Verschluß hindurch doch noch
in die Glocke dringt.
Die obere Schale steht 12cm höher als die untere, und
ein Platinrohr gibt aus jener die Säure in diese ab. Ebenso
fließt die concentrirte Säure durch ein Platinrohr in den Kühler
ab. Die Leistung der Schalen ist 6100k 66°-Säure in 24
Stunden; der Kohlenaufwand zur völligen Concentration ist 12k,5
pro 50k 66°-Säure.
Die perspectivische Ansicht Figur 12
zeigt eine etwas abweichende Anordnung der Glocken und eine
Uebersicht der ganzen Einrichtung. Hier sind b die viel niedriger gehaltenen Glocken
mit den conischen Enden a., oberhalb
derselben die Wasserverschlüsse d
mit den Abführungsrohren e,
unterhalb derselben der hydraulische Verschluß c des Bleikranzes. Es sind ferner f die eisernen Träger der hier (im
cylindrischen Theile) nur 41cm hohen Glocken, g die Unterstützungen des Bleikranzes,
h ein Topf mit der heißen
60°-Säure aus den Pfannen, n
der Kühler für heiße concentrirte Säure, m ein Sammelgefäß, aus welchem abgezogen wird.
Der in Figur 12
dargestellte Apparat leistet 7140k 66°-Säure in 24
Stunden, und seine Schalen haben jede 76cm Durchmesser.
Friedr. Bode.
Tafeln