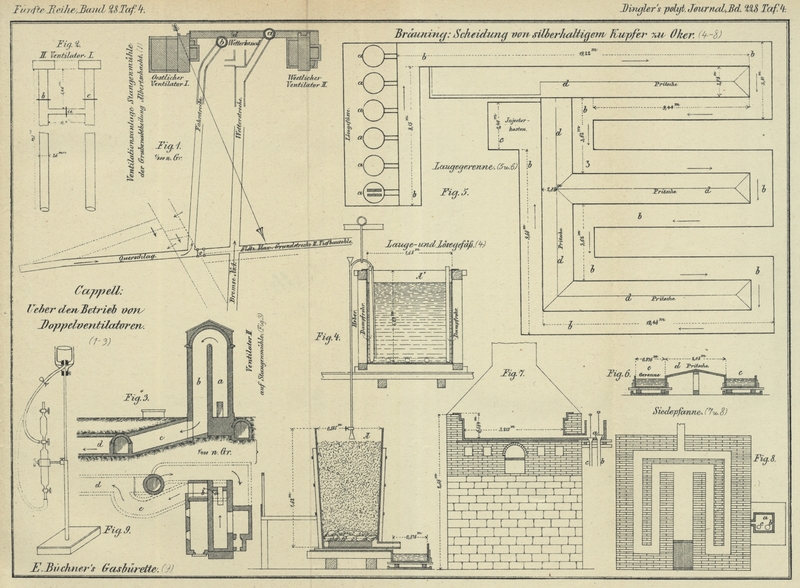| Titel: | Scheidung von silberhaltigem Kupfer und Darstellung von Kupfervitriol zu Oker am Harz. |
| Autor: | F. B. |
| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 44 |
| Download: | XML |
Scheidung von silberhaltigem Kupfer und
Darstellung von Kupfervitriol zu Oker am Harz.
Mit Abbildungen auf Tafel
4.
Bräuning, über Scheidung von silberhaltigem Kupfer.
Bei dem niedrigen Kostenpreise der Schwefelsäure, welche die Hütte selbst erzeugt und
bei dem geringen Gehalte an Gold und Silber in den aus den Rammelsberger Erzen
erhaltenen Kupferproducten, sowie bei deren Gehalt an Arsen, Antimon, Blei u.s.w.,
ist der beste Weg, Gold und Silber vom Kupfer zu scheiden, die Auflösung des
letzteren in Schwefelsäure unter Darstellung von Kupfervitriol. Heiſse verdünnte
Schwefelsäure löst bei Luftzutritt das Kupfer zu Sulfat, während Silber und Gold,
nebst etwa gegenwärtigem arsensaurem und antimonsaurem Bleioxyd unlöslich
zurückbleiben. Eisen, Kobalt und Nickel gehen mit in Lösung. Ersteres, in gröſserer
Menge vorhanden, beeinträchtigt die Durchführung des Processes. In dem Rohvitriol ist das
Unlösliche mechanisch beigemengt. Durch Auflösung in Siedepfannen scheidet sich aber
der sogen. Silberschlamm ab.
Die Auflösung des Kupfers geschieht in den mit Blei ausgeschlagenen Gefäſsen A (Fig. 4 Taf. 4) von 1m,62 Höhe, 885mm
oberem und 720mm unterem Durchmesser. Seitlich von
der unteren Abfluſsöffnung ist durch zwei eingelegte Hölzer ein Kanal für die
zutretende Luft gebildet. Das Gefäſs ist zunächst gefüllt mit einigen gröſseren
Kupferstücken, sodann mit Kupfergranalien. Zur Lösung dient rohe Säure von 50° B.,
verdünnt durch Mutterlaugen aus den Rohvitriolgerinnen und aus den
Krystallisationskästen auf 29 bis 30° B. Diese Mischung erfolgt in mehreren
Bleigefäſsen A', welche in dem Stockwerk oberhalb der
Lösefässer A aufgestellt und mit einer Dampfschlange
versehen sind, durch welche die Lösemischung auf 87,5° erwärmt wird. Die Granalien
werden durch einen Heber, der unten einen Abschluſshahn hat, mit der heiſsen Lauge
periodisch von ¾ bis 1 Stunde bebraust, wodurch das gebildete Kupfersulfat nebst dem
Unlöslichen in die Vitriolgerinne gespült wird.
Sechs Lösegefäſse a (Fig. 5 und 6 Taf. 4), zu einem
Systeme vereinigt, geben die Rohlauge in das gemeinsame Gerinne b (876mm breit und
105m,88 lang, sonach mit 92qm,751 Grundriſs), an dessen Ende ein Sammelkasten
c liegt, aus dem ein Injector die Laugen zur neuen
Verwendung nach A' hebt. Der angeschossene Rohvitriol
wird auf die Pritschen d ausgehoben und mit Wasser
gedeckt.
Wenn die aus den Gefäſsen A abflieſsende Lauge anfängt
klar zu werden, stellt man die Bebrausung ein und füllt nach Bedarf Granalien nach,
so daſs der Betrieb der Lösegefäſse ununterbrochen ist.
Der Rohvitriol in der Nähe der Lösegefäſse ist am reichsten an Silberschlamm, während
sich demselben weiterhin mehr Gyps und arsensaure und antimonsaure Bleisalze
beimengen. Man gattirt die verschiedenen Sorten Rohvitriol entsprechend für die
Lösung in den Siedepfannen, von welchen zwei zu jedem System gehören. Diese Pfannen
bestehen aus starkem Bleiblech, das auf Guſsplatten ruht, unter denen das Feuer
entlang geht (Fig.
7 und 8 Taf. 4). Die Länge der Pfannen ist 3m,505, die Breite 3m,213, die Tiefe 0m,584. Sie haben am Boden Verbindung mit dem
Gefäſse a, welches in verschiedener Höhe zwei
Abfluſsrohre b und c
besitzt, eines für klare Lauge, das andere für Silberschlamm.
Zur Wiederauflösung dient ein Theil, etwa die Hälfte, der Mutterlauge der
Krystallisationskästen. Diese Laugen sind auf 14 bis 15° B. verdünnt. Die
Siedepfannen, 40cm hoch mit denselben angefüllt,
werden auf 94° erhitzt, hierauf der Rohvitriol eingetragen und unter Rühren bei
unterbrochenem Feuer gelöst. Die heiſse Lösung zeigt 26° B. und gibt, wenn stärker,
ein unansehnliches Product von kleinen Krystallen. Etwa in Lösung befindliches Silber
wird durch einen Zusatz von Kupferschwamm in die Pfannen (erhalten beim Granuliren
des Kupfers) ausgefällt. Man läſst nach der Wiederauflösung in den Pfannen absitzen,
und kühlen hierbei die Laugen auf 81° unter Zunahme des specifischen Gewichtes auf
29° B. ab. Hiermit werden dieselben schnell in die Krystallisationskästen abgelassen
unter Vermeidung jeder weiteren Abkühlung, da sich sonst schlecht aussehende
Krystalle abscheiden. Die mit Blei ausgekleideten Krystallisationskästen messen 2m,921 Länge, 1m,460 Breite und 1m,022 Tiefe und fassen je
eine Pfannenfüllung. Für jede Pfanne sind 12 solche Kästen vorhanden, und bedarf die
Krystallisation 8 bis 12 Tage; 25 Latten mit je 5 herabhängenden Bleistreifen, sowie
die Seitenwandungen der Kästen tragen die groſsen Krystalle. Am Boden sitzt
gewöhnlich klein krystallinisches Product, aus welchem der abgesiebte Grus zur
nochmaligen Auflösung zurückgeht.
Die Mutterlauge wird theils in die Siedepfannen, theils in die Gefäſse A zurückgehoben. Der Vitriol wird mit Wasser gewaschen
und bei 19 bis 25° in dunklen Räumen getrocknet. Der rückständige Silberschlamm wird
nach zwei- bis dreimaliger Siedung aus den Pfannen in Behälter gebracht, in denen
man absitzen läſst, um mit Heber die klare Lauge abzuziehen. Der Rückstand enthält 2
bis 4 Proc. Silber und wird mit Glätte und Kuhhaaren zu Kugeln geformt und
getrocknet; die übrigen Bestandtheile sind vornehmlich Gyps, Bleioxyd, Arsen und
Antimon. Er wird mit Glätte und Kupfersteinschlacken auf ein Reichblei von 2 bis 3
Proc. Silbergehalt verschmolzen, das zum Abtreiben geht. Arsen und Antimon geben
beim Niederschmelzen Anlaſs zur Bildung einer silberreichen Speise, die durch
Verbleiung entsilbert und dann beim Kupferhüttenproceſs weiter verwendet wird.
Wie man sieht, vermeidet der Proceſs jeden Verlust an Schwefelsäure und Kupfer, weil
unbeschadet der Qualität des Vitriols die Mutterlaugen Jahre lang verwendet werden
können. Doch müssen hierzu die Granalien nahezu frei von Eisen und Nickel sein;
dieselben würden sich schlieſslich in den Mutterlaugen anhäufen und das Product
verschlechtern, wenn man die Mutterlaugen nicht bisweilen in dem Turnus ganz
erneuert. Man rechnet auf 100k Kupfergranalien
380k Kupfervitriol und 240k Schwefelsäure 50° B. zur Auflösung. Auf ein
System mit 6 Lösegefäſsen, 2 Siedepfannen und 24 Krystallisationskästen kommen in 24
Stunden durchschnittlich 1250 bis 1500k
Kupfervitriol. (Nach Bräuning in der Zeitschrift für
das Berg-, Hütten- und Salinenwesen, 1877 Bd.
25.)
F.
B.
Tafeln