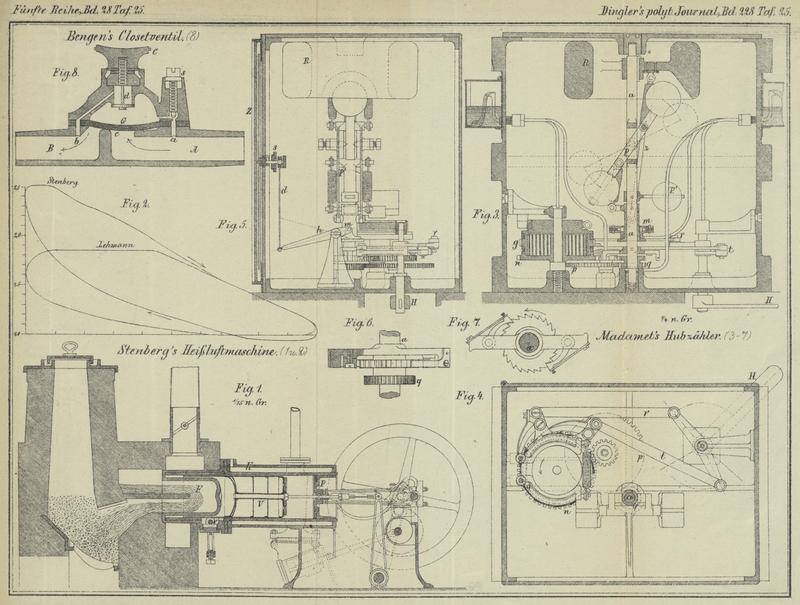| Titel: | Stenberg's Heissluftmaschine. |
| Autor: | Wilman |
| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 391 |
| Download: | XML |
Stenberg's Heiſsluftmaschine.
Mit Abbildungen auf Tafel
25.
Stenberg's Heiſsluftmaschine.
Diese im vorigen Jahre in verschiedenen Ländern von Stenberg patentirte Hochdruck-Heiſsluftmaschine (Fig. 1 Taf. 25) gehört wie
der bekannte Lehmann'sche Motor (1869* 194 257. 1873 209 152. 1876
219 196. 371. 222 183) zur Klasse der geschlossenen
calorischen Maschinen, bei welchen die Nutzleistung durch abwechselnde Erwärmung und
Abkühlung stets derselben Luftmenge erzielt wird. Zur Erwärmung dient der Feuertopf
F, zur Abkühlung der Kühlraum K, welcher den Arbeitscylinder ringförmig umgibt und
durch Kühlwasser, das die Maschine selbst hindurchpumpt, dauernd auf niederer
Temperatur erhalten wird. Zwischen diesen beiden Räumen wird die Arbeitsluft
abwechselnd hin- und herbewegt und gibt dabei, indem sie beim Einwärtsgange des
Kolbens P unter Wärmeentziehung verdichtet wird, aber
hierauf erhitzt expandirt und den Kolben nach auswärts treibt, einen
Kraftüberschuſs, welcher durch Kolben, Treibstange und Kurbel auf die
Schwungradwelle übertragen wird und die effective Leistung der Maschine darstellt.
Damit aber beim Einwärtsgange des Kolbens P die durch
Verkleinerung des Gesammtvolums comprimirte Luft gleichzeitig auch abgekühlt und so
die Compressionsarbeit mit geringstem Kraftaufwand verrichtet werde, ist es nöthig,
daſs dabei der Raum des Feuertopfes der Arbeitsluft thunlichst verschlossen bleibe,
und dies geschieht durch den Verdränger V – ein langer,
luftdicht verschlossener Blechcylinder, welcher einen etwas geringeren Durchmesser
hat wie der Arbeitskolben P und demselben beim
Einwärtsginge vorauseilt. Dadurch wird der Raum zwischen Arbeitskolben und Verdränger, welcher von dem Kühlmantel umgeben
ist, immer gröſser, dagegen der Raum hinter dem
Verdränger, d. i. das freibleibende Volum des Feuertopfes, immer kleiner, bis
endlich der Verdränger das Ende seines Hubes erreicht hat, nunmehr wieder nach
auswärts geht und dadurch die verdichtete, aber abgekühlte Luft, welche zwischen ihm
und dem Kolben enthalten war, zwingt, den Ringraum um den Verdränger passirend zum
Feuertopf zu ziehen. Hier nimmt die Luft rasch eine hohe Temperatur und
entsprechende Spannung an und vermag somit bei dem nun folgenden Auswärtsgange des
Kolbens expandirend Arbeit an denselben abzugeben, während der Verdränger, auf
welchen beiderseits gleicher Druck wirkt, ohne Arbeitsverrichtung dem Kolben nach
auswärts folgt, sich dabei demselben immer mehr nähert und so endlich alle
Arbeitsluft dem Feuertopfe zuführt. Bei dem hierauf wieder folgenden Einwärtsgang
beginnt das oben geschilderte Spiel von neuem.
Insoweit ist die Stenberg'sche Maschine mit der Lehmann'schen völlig identisch. Der auffallendste
Unterschied dagegen liegt in der Bewegungsübertragung, welche bei Lehmann in bekannter Weise mittels Hebel auf die quer über dem
Arbeitscylinder liegende Schwungradwelle erfolgt, während bei Stenberg dieselbe direct vor dem Cylinder liegt und
durch am Kolben angreifende Pleuelstangen angetrieben wird; in beiden Fällen sind
die Pleuelstangen seitlich und doppelt am Kolben angebracht, um der central durch
eine Stopfbüchse passirenden Kolbenstange des Verdrängers Platz zu lassen. Diese
selbst wird, um die oben beschriebenen Functionen zu erfüllen, bei Lehmann von einer mit 65 bis 75° Voreilung aufgekeilten
Gegenkurbel der Schwungradwelle bewegt, während bei Stenberg in directerer Weise der Antrieb durch einen Hebel erfolgt, dessen
Ende in eine Coulisse ausgeht und hier von einem dem Schwungrad eingesetzten
Kurbelzapfen bewegt wird. Die Kühlwasserpumpe wird durch Zahnräder angetrieben. Die
Dichtung des Arbeitskolbens wird, wie bei Lehmann, von
einem Lederstulp gebildet, welcher den Austritt comprimirter Luft verhindert, aber
bei einem durch Luftverluste eintretenden Minderdruck Luft von auſsen zuströmen
läſst.
Was die Feuerung betrifft, so wendet Stenberg, wie es
auch seit längerer Zeit bei den Lehmann'schen Maschinen
geschieht, einen Füllofen an; bei Lehmann umspülen die
Heizgase den Feuertopf nur von auſsen; bei Stenberg
werden sie durch eine hineinragende Zunge zunächst ins Innere des umgestülpten
Feuertopfes und dann noch, auf dem Wege zum Kamin, um denselben herumgeführt;
entsprechend dieser veränderten Gestalt ist auch bei letzterem der Vordränger am
Ende offen und glockenförmig gestaltet, während der Lehmann'sche Verdränger einen vollkommen luftdicht verschlossenen Cylinder
darstellt.
Zur Kritik der beiden Maschinen übergehend, läſst sich wohl erwarten, daſs die Stenberg'sche Maschine, als der Wesenheit nach aus Lehmanns Maschine hervorgegangen, einige Vorzüge vor
derselben voraus habe. Wir finden diese hauptsächlich in dem einfacheren
Antriebsmechanismus, wenn auch derselbe, soll der Verdränger zur Reinigung des
Cylinders herausgenommen werden, das Ausheben der Schwungradwelle bedingt, was bei
Lehmann nicht der Fall ist, sowie auch erwähnt
werden mag, daſs die den Verdränger am hinteren Ende tragende Rolle r in der älteren Maschine der Wirkung der Heizgase
ausgesetzt ist, während dies bei Stenberg nicht
stattfindet. Als speciellen Vorzug ihrer Maschine führen endlich Gebrüder Sachsenberg an, daſs sich, in Folge der
Gestaltung des Feuertopfes und der eigentümlichen Bewegung des Verdrängers durch die
entsprechend geformte Coulisse, höhere Luftspannungen und damit günstigere Resultate
erzielen lassen, als bei den Lehmann'schen Maschinen.
Nach den von Dr. A. Wüst in einem Vortrage im Thüringer
Bezirksverein (Zeitschrift des Vereines deutscher
Ingenieure, 1877 S. 407) gegebenem Diagramm Fig. 2 Taf. 25 ist allerdings der
Unterschied der Anfangsspannung auffällig, der Verlauf der Curve jedoch bei Lehmann der rationellen Kreisproceſslinie
entsprechender und die mittlere effective Spannung, welche die Arbeit repräsentirt,
bei beiden nahezu gleich. Es müssen somit die Resultate ökonomischer Versuche
abgewartet werden, um zu entscheiden, ob die Stenberg'sche Maschine hierin einen Fortschritt darstellt.
Wilman.
Tafeln