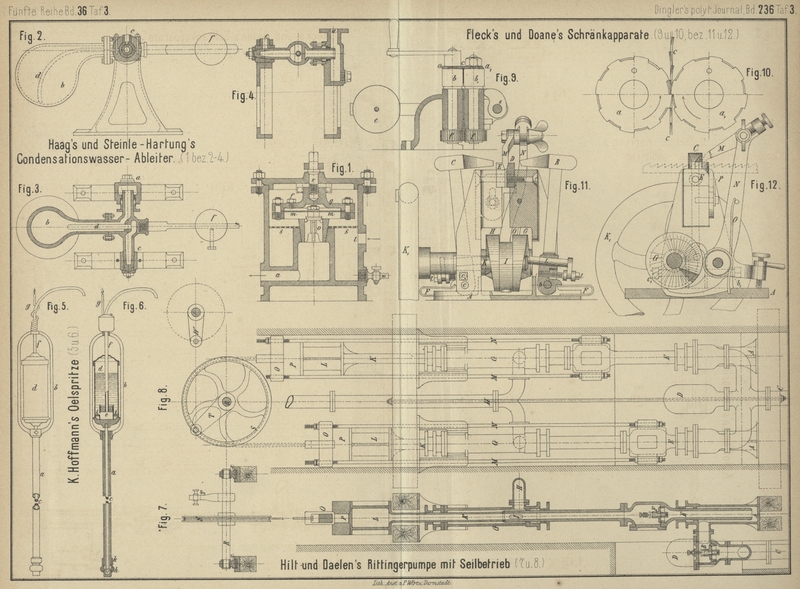| Titel: | Neuerungen an Condensationswasser-Ableitern. |
| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 14 |
| Download: | XML |
Neuerungen an
Condensationswasser-Ableitern.
Mit Abbildungen auf Tafel 3.
Neuerungen an Condensationswasser-Ableitern.
Der Condensationstopf von Johannes Haag in
Augsburg (* D. R. P. Nr. 6234 vom 26.
Januar 1879) wirkt vermöge der Ausdehnung und Dampfbildung einer
erhitzten Flüssigkeit, deren Siedepunkt unter 100°, also tiefer als der des Wassers
liegt (vgl. Hawes *1875 218
17). Diese Flüssigkeit (gewöhnlich wasserfreier Spiritus) wird in ein flaches, unten
mit einer elastischen Kupferscheibe m (Fig. 1 Taf.
3) abgeschlossenes Gefäſs g gefüllt, welches im Gehäuse
und zwar an einer im Deckel desselben abgedichteten Schraube r hängt. Mit dieser Schraube läſst sich das Gefäſs g von auſsen so einstellen, daſs das von der Scheibe m getragene Ventil o etwas
von seinem Sitz absteht und den Wasserablauf a ein
wenig offen läſst. Das bei l in den Topf eintretende
Condensationswasser kann demnach aus diesem ungehindert austreten. Sobald jedoch die
Wassertemperatur eine gewisse Grenze erreicht, wird in dem vom Wasser umspülten und
erwärmten Gefäſs g der Weingeist verdampfen, der
hierdurch entstehende Druck die Scheibe m ausbauchen
und diese das Ventil o niederdrücken, bis es
abschlieſst. Der völlige Ventilschluſs läſst sich von der Wärme des
Condensationswassers abhängig machen, da eine ursprünglich gröſsere Ventilöffnung
hierzu eine stärkere Durchbiegung der elastischen Scheibe erheischt, welche wieder
nur durch eine erhöhte Spannung der stärker erhitzten Spiritusdämpfe bewirkt werden
kann. Durch geeignete Ventilstellung mittels der Schraube r läſst sich demnach das Wasser bei 80 bis 95° ableiten. Besonders
bemerkenswerth ist der Umstand, daſs der Apparat bei kalter Leitung stets offen ist,
daſs sich also in letzterer kein Wasser ansammeln kann, welches beim Anlassen
Schläge verursachen würde. Auch die leichte Zugänglichkeit muſs hervorgehoben
werden, welche allerdings schon deshalb nöthig sein dürfte, weil sich das Entweichen
von Spiritusdämpfen aus dem Gefäſs g und das
zeitweilige Nachfüllen des letzteren kaum wird vermeiden lassen. Zum Nachfüllen
dient die verschraubbare Oeffnung f. Ein Hahn w erlaubt das gänzliche Ablassen des Apparates, wenn
dieser der Gefahr des Einfrierens ausgesetzt ist. Das Verschmutzen der
Ventilsitzflächen wird durch ein Schlammsieb s
verhütet.
Auf eigenthümliche Weise wurde das Princip des bekannten Kirchweger'schen Automaten
(* 1869 192 9), das Ablassen des Niederschlagswassers
durch die Wirkung seiner Schwere zu veranlassen, neuerdings von Steinle und Hartung in Quedlinburg (* D. R. P. Nr. 7490 vom 16. Mai 1879) angewendet, deren in
Fig. 2 bis 4 Taf. 3
abgebildeter Condensationstopf keine in einem Gehäuse eingeschlossenen Theile
enthält und deshalb besonders leicht controlirt werden kann. Das birnförmige
Sammelgefäſs b wird von einer in zwei Ständern
gelagerten hohlen Achse getragen und durch einen Gegengewichtshebel f ausbalancirt. Das Niederschlagswasser tritt durch die
Höhlung a des einen Ständers in den einen Kanal der
Achse und in das Gefäſs b und bringt dieses zum Sinken,
wodurch die Achse so gedreht wird, daſs ihr bisher verschlossener zweiter Kanal mit
der Abfluſsöffnung c im zweiten Ständer in Verbindung
tritt. Da nun in diesen Kanal das bis nahe zum Gefäſsboden reichende Tauchrohr d mündet, kann das im Gefäſs befindliche Wasser durch
dieses unter Dampfüberdruck entweichen. Das entleerte Gefäſs wird durch das
Gegengewicht f hierauf wieder gehoben und gegen den
Ablauf hin abgesperrt. Hohe Dampfspannungen können die Wirkung des Apparates nicht
beeinfluſsen, weshalb er sich zur Anwendung unter Hochdruck besonders eignen dürfte.
Als Uebelstand möchte die nothwendige Instandhaltung einer Stopfbüchse bezeichnet
werden.
Der erwähnte Kirchweger'sche Condensationstopf wurde von Trautschold und Rahnsen in
Sudenburg-Magdeburg dahin verbessert, daſs er ohne Demontirung des
Leitungsanschlusses zugänglich ist. Der in der Patentschrift (* D. R. P. Nr. 7415 vom 10. April 1879) angeführte Vortheil erhöhter
Leistungsfähigkeit, welche den älteren Apparaten gegenüber durch besondere
Formgebung des Gehäuses erzielt sein soll, ist nicht
begründet.
Auch bezüglich der Einrichtung des Condensationswasserableiters von E.
Fromm in Mülhausen (* D. R. P. Nr. 7488 vom 10. Mai 1879) genügt zu bemerken, daſs
derselbe lediglich aus einem Hahn besteht, dessen Küken einen breiten niedrigen
Spalt erhält, damit sich die Abfluſsöffnung möglichst empfindlich so reguliren
lasse, daſs – ununterbrochenen, gleichmäſsigen Dampfverbrauch vorausgesetzt – Zu-
und Abgang des Condensationswassers gleich sind.
Tafeln