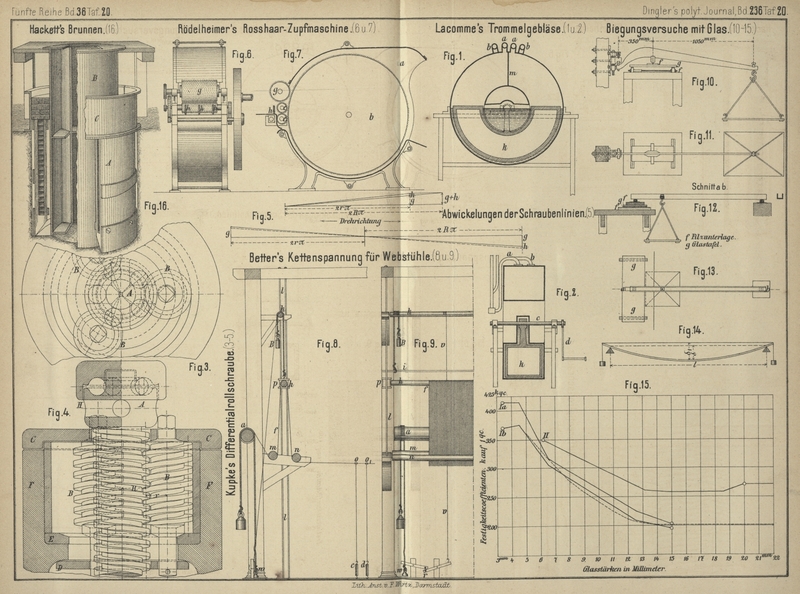| Titel: | Biegungsfestigkeit von Tafelglas für Bedachungen. |
| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 210 |
| Download: | XML |
Biegungsfestigkeit von Tafelglas für
Bedachungen.
Mit Abbildungen auf Tafel 20.
Schwering, über Biegungsfestigkeit von Tafelglas.
Die bisherigen Angaben über die Festigkeitsverhältnisse des Glases sind keineswegs
geeignet, als zuverlässige Grundlage zur Berechnung der Abmessungen von Glasplatten
für Bedachungen zu dienen. Da eine solche Berechnung aber aus ökonomischen Gründen
besonders dann von Wichtigkeit ist, wenn es sich um die Eindeckung groſser Räume
handelt, verdienen neuere Untersuchungen über diesen Gegenstand Beachtung, welche
vom Regierungsbaumeister Schwering in Hannover angestellt und in der
Zeitschrift des Architekten- und Ingenieurvereines zu
Hannover, 1880 S. 69 mitgetheilt wurden, wenngleich dieselben, lediglich
für praktische Zwecke berechnet, nicht darauf abzielten, wissenschaftlich genügende
Resultate zu geben. Zur richtigen Beurtheilung des Werthes dieser Versuche sei
vielmehr bemerkt, daſs durch dieselben zunächst die Constanten in den bekannten
Formeln für Biegungsfestigkeit ermittelt wurden, so daſs sich nun die Festigkeit
bestimmter im Handel vorkommender Tafelglassorten mit Hilfe derselben berechnen
läſst. Auſserdem wurden in einzelnen Fällen auch die Durchbiegungen gemessen, um den
jeweiligen Elasticitätsmodul wenigstens annäherungsweise zu bestimmen.
Die Versuche wurden in folgender Weise vorgenommen: Glastafeln von meist 20cm Breite und von verschiedenen Längen und Stärken
wurden auf zwei etwas abgerundeten, mit Filzstreifen überdeckten Schneiden
aufgelagert und in der Mitte belastet. Bei einer Reihe von Versuchen diente hierzu
ein auf die Glastafel aufgelegtes Holzstück mit Filzunterlage, auf dessen
Mittelpunkt mittels einer Schneide ein Belastungshebel wirkte (vgl. Fig. 12 und
13 Taf. 20). Bei einer zweiten Versuchsreihe, bei welcher stärkere,
bezieh. kürzere Tafeln zerbrochen wurden, erfolgte die Belastung durch einen Hebel
mit 4 facher Uebersetzung; derselbe drückte mittels einer Schneide auf die
Glastafel; zwischen beide war zur gleichmäſsigen Druckübertragung wieder ein Stück
Filz gelegt. Die Schneidenlänge betrug hierbei etwas mehr als die Breite der
Glastafel (vgl. Fig. 10 und
11). Zur annähernden Bestimmung des Elasticitätsmoduls wurden die
Durchbiegungen in einzelnen Fällen in der Weise bestimmt, daſs ein feiner
Seidenfaden, an dessen Enden Gewichte befestigt waren, über die Glastafel gezogen
wurde. An einer in deren Mitte aufgesetzten Scale konnte zunächst die durch das
Eigengewicht hervorgerufene Durchbiegung abgelesen werden, worauf die Beobachtung
weiterer durch Belastung von 5 zu 5k
hervorgerufener Durchbiegungen stattfand. Nachdem noch jede gemessene Durchbiegung
δ1 (Fig. 14)
auf die der Stützweite l entsprechende Durchbiegung δ reducirt wurde, konnte der Elasticitätsmodul nach der
bekannten Formel E=\frac{P\,l^3}{48\,\delta\,T} bestimmt werden,
worin T das Trägheitsmoment des Tafelquerschnittes und
δ die durch ein Gewicht P hervorgerufene, auf die Länge l reducirte
Durchbiegung ist. Aus den beobachteten Bruchbelastungen wurde der Bruchmodul
(Coefficient) k nach der Formel
k\,\frac{b\,h^2}{6}=\frac{2600\,h\,b}{1000000}\
\frac{l^2}{8}+\frac{P}{4}\,\left(l-\frac{l_1}{2}\right) bestimmt,
worin b die Breite, h die
Dicke und l die Länge der Glastafel in Centimeter, P die Bruchbelastung in Kilogramm bedeutet und das
specifische Gewicht des Glases zu 2,6 angenommen ist. Unter l1 ist die Breite des die Belastung
übertragenden Brettstückes (Fig. 12 und
13) zu
verstehen; bei der zweiten Versuchsreihe, welche mit der in Fig. 10 und
11 abgebildeten Vorrichtung vorgenommen wurde, war l1 = 0 zu setzen.
Die erste Reihe weist 25 Versuche mit geblasenem Glas
von 3,0 bis 5mm,0 mittlerer Stärke und 36 Versuche
mit gegossenem Glas von 5,13 bis 15mm,0 mittlerer Stärke auf. Sämmtliche Proben der
33 Versuche zählenden zweiten Reihe waren gegossenes
Glas in mittleren Stärken von 5,02 bis 25mm,2.
Auſserdem wurden mit jedem der beiden Apparate je zwei Proben Preſshartglas in Stärken von 2,76 bis 6mm,0 untersucht.
Bei geblasenem Rohglas betrug k (die Bruchbelastung für 1qc) 286 bis
596k, im Mittel 375k. Die Bruchbelastungen des gegossenen Rohglases in Stärken von 5 bis 15mm erwiesen sich als mit der Stärke abnehmend; die
Mittelwerthe derselben sind in dem Diagramm Fig. 15
Taf. 20 übersichtlich zusammengestellt. Die nach den Minimalstärken der Probetafeln
der ersten Versuchsreihe berechneten Bruchbelastungen (Ia
in Fig. 15) sind etwas gröſser als die aus den mittleren Glasstärken
berechneten (Ib). Bei Tafeln von über 15mm Stärke ist die Bruchbelastung nach dem
Ergebniſs der ersten Versuchsreihe constant etwa = 200k zu setzen. Auch die Resultate der zweiten Versuchsreihe sind in Fig.
15 angegeben (II); doch legt Schwering selbst
auf diejenigen der ersten Versuchsreihe gröſseres Gewicht. Nach den letzteren stellt
er die Bruchfestigkeitscoefficienten des gegossenen Rohglases in zwischen 5 und
15mm gelegenen Stärken x durch die Formel dar:
k_x=200+(15-x)^2\,\times\,1,6.
Die nach dieser Formel berechneten Coefficienten sind in Fig.
15 punktirt angedeutet.
Die Abnahme der Festigkeit des gegossenen Glases bei
zunehmender Stärke ist einestheils aus den mit der Dicke sich ändernden inneren
Spannungen im Glase, anderntheils daraus zu erklären, daſs die äuſseren Schichten
eine höhere Festigkeit haben als der innere Kern, dessen Einwirkung bei groſsen
Dicken besonders hervortritt. Probeplatten, welche sogen. „Haarrisse“
zeigten, hatten eine verhältniſsmäſsig geringe Festigkeit; die eine von 6mm,8 Dicke brach bei 192k/qc, die andere
von 6mm,21 Dicke schon bei 108k/qc. Solches Glas
sollte deshalb für Dachbedeckungen oder ähnliche Zwecke nicht benutzt werden.
Haarrisse – feine Risse von oft nur geringer Länge und zackiger Form – sind dadurch
charakterisirt, daſs sie sich bei einem leichten Schlag mit einem Hammer auf die
betreffende Stelle der Glastafel vergröſsern.
Für Preſshartglas ergab sich aus den 4 Versuchen ein
mittlerer Bruchmodul von 1000k. Dagegen zeigt sich
der aus zwei Versuchen im Mittel zu rund 7800 berechnete Elasticitätsmodul desselben
nicht wesentlich verschieden von dem des gewöhnlichen Glases; denn für geblasenes Glas wurde als
Mittelwerth aus 11 Proben von 3 bis 5mm Stärke E = 7473 und für gegossenes Glas als Mittelwerth aus 9
besonders hervorgehobenen Proben E = 7638 bestimmt.
Weil nun Dachplatten nicht nur eine ruhende Last, sondern auch erhebliche
Stoſswirkungen bei Hagelschlag u. dgl. auszuhalten haben, ist neben hoher Festigkeit
auch eine groſse Elasticität von Wichtigkeit, und aus diesem Grunde müſste das
Preſshartglas für Bedachungen als ganz besonders geeignet erscheinen. Allein der
ausgedehnteren Verwendung desselben steht nicht nur der hohe Preis (5 bis 12 M. für
1qm 2 bis 5mm starker Tafeln zweiter Sorte und 3,50 bis 6 M. für 1qm 2 bis 3mm,5
starker Tafeln dritter Sorte), sondern auch die geringe Gröſse entgegen, in welcher
sich die Tafeln herstellen lassen. (Nach Angaben von F.
Siemens in Dresden kann dieselbe bei 4mm
Dicke 350 × 550 bis 685mm und bei 5mm Dicke 640 × 400 bis 430mm betragen.) Ueberdies ist auch die
wahrscheinlich durch innere Spannungen bedingte Möglichkeit des Zerspringens von
Hartglastafeln ohne äuſsere Veranlassung sowie der Umstand in Betracht zu ziehen,
daſs sich dieselben mit dem Diamant in der gewöhnlichen Weise nicht schneiden
lassen.
Bezüglich der Frage, ob geblasenes oder gegossenes Rohglas für Bedachungen
vorzuziehen sei, kommt Schwering zu keiner allgemeinen
Entscheidung. Während geblasenes Glas eine gröſsere Festigkeit zeigt, hat das
gegossene den Vortheil, daſs es sich in gröſseren Dimensionen herstellen läſst; auch
wird hervorgehoben, daſs die Fehler, welche dünnen Rohgläsern anhaften, bei
sorgfältiger Herstellung bis zu einem gewissen Grade vermieden werden können.
Ob eine Riffelung des Glases auf die Festigkeit Einfluſs hat, ist fraglich;
angestellte Versuche scheinen zu ergeben, daſs stärker
geriffelte Platten fester als glatte oder schwach geriffelte sind. Jedenfalls
empfiehlt es sich, die Riffeln rechtwinklig zum Auflager zu legen, was bei wenig
geneigten Dächern allerdings den Uebelstand zur Folge hätte, daſs sich in den
Riffeln Schmutz ansetzt. Was das Schleifen des Glases betrifft, so läſst sich
annehmen, daſs dasselbe die Festigkeit vermindert, weil die härtere, bezieh. festere
Oberfläche entfernt wird. Es müſsten deshalb die Tafeln so gelegt werden, daſs die
geschliffene Fläche auf der Druckseite, also bei Bedachungen oben liegt.
Schlieſslich macht Schwering den Vorschlag, bei groſsen
Bestellungen eine bestimmte Festigkeit und Elasticität des zu liefernden Materials
vorzuschreiben und die Güte desselben durch Prüfungen jeweilig festzustellen. Von
einer derartigen Maſsregel verspricht er sich bezüglich der Fortschritte in der
Fabrikation den besten Erfolg.
Tafeln