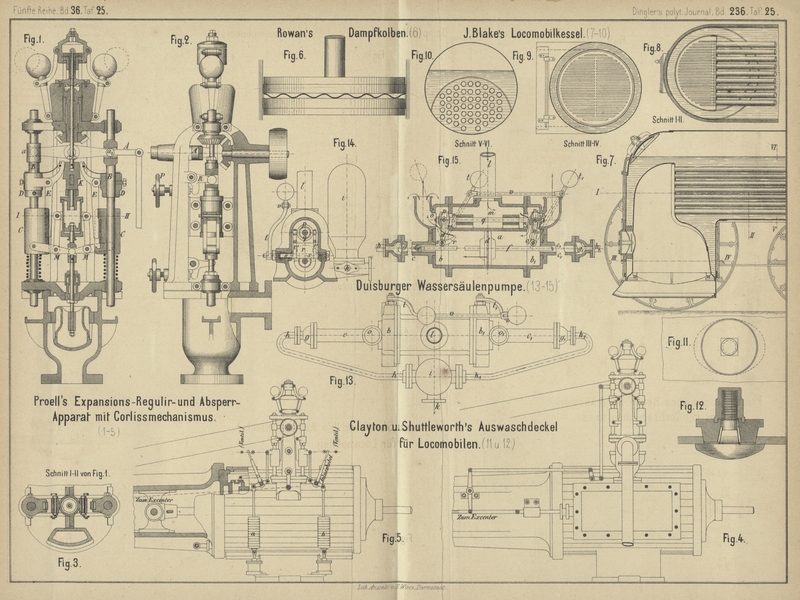| Titel: | Proell's Expansions-, Regulir- und Absperrapparat mit Corlissmechanismus. |
| Autor: | G. H. |
| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 277 |
| Download: | XML |
Proell's Expansions-, Regulir- und Absperrapparat
mit Corliſsmechanismus.
Mit Abbildungen auf Tafel 25.
Proell's Expansions-, Regulir- und Absperrapparat.
Der im Nachfolgenden erläuterte Expansions-, Regulir und Absperrapparat von Dr. R.
Proell in Dresden (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 1919 vom 4. November 1877) basirt auf
dem Princip der Corliſsauslösung und hat den Zweck, eine Dampfmaschine mit
Schiebersteuerung ohne erhebliche Betriebstörung binnen kurzer Zeit mit
Präcisionssteuerung auszurüsten bezieh. in eine Corliſsmaschine zu verwandeln (vgl.
Fig. 1 bis 5 Taf.
25).
Der ganze Apparat, zu einem geschlossenen Ganzen verbunden, wird als Armaturstück
fertig hergestellt und an Stelle des Drossel- oder Absperrventiles aufgesetzt. Es
bedarf dann nur einer entsprechenden Hebelverbindung desselben mit dem die bisherige
Steuerung bethätigenden Organ (beispielsweise mit dem Excenter einer
Schiebersteuerung, vgl. Fig. 4)
nebst einer Riemenzuführung von der Schwungradwelle zum Antrieb des gleich im
Apparat befindlichen Regulators und der gewünschte Zweck, die Leistung der Maschine
quantitativ und qualitativ erhöht zu haben, ist erreicht.
Es ist eine durch die Erfahrung festgestellte Thatsache, daſs Doppelsitzventile zum
Zweck der Expansion höchst zweckdienlich sind. Die Eröffnungen für den
Dampfdurchgang erfolgen schnell. Die Hebung des Ventiles geschieht mit dem geringsten Kraftaufwande
und der Dampfabschluſs ist auſserordentlich präcis. Diese Eigenschaften haben
jedenfalls den Erfinder des Apparates für die Anwendung eines Doppelsitzventiles
bestimmt, welches den Dampfzutritt zur Maschine regulirt.
Die Hebung des Ventiles (Fig. 1)
erfolgt für jeden Kolbenhub durch den Steuerapparat vermöge einer durch die
Stopfbüchse heraustretenden Stange, deren oberes Ende durch einen Luftcylinder
geführt und innerhalb desselben mit einem Luftkolben versehen ist, um bei schnellem
Fall des Ventiles ein weiches Aufsitzen zu erzielen. Den schnellen und präcisen
Schluſs bewirken (auſser dem Dampfdruck und dem Eigengewicht des Ventiles) zwei
unter die Gleitstücke C gepreſste Spiralfedern, welche
während der Hebung des Ventiles gespannt werden und in Folge der Hebel Verbindung
M, einerseits mit den Gleitstücken, andererseits
mit der geschlitzten Ventilstange, das Bestreben haben, das Ventil zu schlieſsen.
Die Hebel m erhalten in etwas mehr als ein Drittel
ihrer Länge, von der Ventilstange aus gemessen, ihre Unterstützung durch zwei am
Luftcylinder angebolzte Hängeeisen.
Die Steuerung des Expansionsventiles erfolgt, wie schon erwähnt, durch den sogen,
äuſseren Steuerapparat, welchem der Erfinder den Kamen „Corliſsmechanismus“
beilegt, in seiner Wesenheit aber auch an die M. A.
Starke'sche Präcisionssteuerung (vgl. * D. R. P. Kl. 14
Nr. 3529 und 4242 vom 13. April 1878) erinnert.
Die Gleitstücke C erhalten ihre Führung auf den beiden
diametral gegenüber angeordneten senkrechten Stangen B,
die ebenfalls verschiebbar und in dem am Ventilgehäusedeckel angegossenen Ständer
geführt sind. Auf diesen Stangen sitzen noch die Nüsse D, welche zwei herabhängende Auslösungshebel E drehbar tragen; letztere werden mit ihrem oberen etwas aufgebogenen Ende
durch Blattfedern gegen einen im Deckel des Luftcylinders stangenartig geführten
Stellkeil K gedrückt, während der untere mit
Stahlplatten armirte Theil der Klinken E in Nuthen der
Gleitstücke C geführt wird. Wie aus der Zeichnung
erhellt, bewirken diese Klinken die Auslösung der Steuerung und stoſsen zu diesem
Zweck abwechselnd mit ihren Anlagebacken so lange gegen die ebenfalls mit
Stahlplatten versehenen Angriffsflächen der Gleitstücke C, bis sie bei Bewegung des Hebels A und
Abwärtsbewegung der Stangen B den Stellkeil K zur Auslösung zwingt. Die gespannten Spiralfedern
werden dann zum Theil entlastet und schlieſsen das Ventil. Die wechselnde
Abwärtsbewegung der Stangen B ist durch die pendelnde
Bewegung des Hebels A um seine Mittellage bedingt;
derselbe greift mit seinen beiden Köpfen a, a1 in die mit Stahlplatten ausgelegten Schlitze der
Stangen B und bringt bei jedem Kolbenhub eine der
Klinken E zur Wirkung.
Die Höhenlage des Keiles K bedingt die Füllungsdauer und
ist beim Gang der Maschine von dem gleich am Apparat befindlichen
Proell'schen Regulator (vgl. * 1878 227 13), in dessen Hülse die den Stellkeil tragende
Regulirstange geführt ist, abhängig. Die Hülse hat oben einen dem Kugelausschlag
angepaſsten Schlitz; durch diesen ist ein Querstück gesteckt, welches, auf der
Belastungsurne befestigt, als Träger der Regulirstange dient. Schlieſslich ist
oberhalb des Querstückes auf die Regulirstange ein kleiner, mit Labyrinthenliderung
versehener Kolben aufgeschraubt und in einem Luftcylinder geführt, um die Wirkung
des Regulators zu begünstigen. Den Ausschlag des Regulators und gleichzeitig die
Minimalfüllung, begrenzt die in den Deckel des Luftcylinders gesetzte
Kopfschraube.
Wie erwähnt, vertritt das Expansionsventil zugleich das Absperrventil. Zur Erreichung
dieses Zweckes ist noch eine geeignete Absperrvorrichtung angebracht, welche durch
zwei Griffräder bethätigt wird. Hierzu gehört zunächst der am Ständer angelenkte
obere Winkelhebel R; derselbe greift mit dem Auge des
horizontalen Hebelarmes in den geschlitzten Stellkeil, während sich der
herabhängende Hebelarm gegen die mit dem Griffrad P
versehene Stellschraube anlegt. Eine analoge Vorrichtung dient zum Anlassen und wird
durch das untere Griffrad bewerkstelligt.
Soll also die Maschine in Gang gesetzt werden, so wird die obere Stellschraube
zurückgedreht, der Stellkeil senkt sich und eine der Klinken tritt in Eingriff mit
ihrem Gleitstück C; zugleich wird die untere
Stellschraube angezogen, der auf sie drückende Winkelhebel erfaſst die Ventilstange
und öffnet das Ventil, die Maschine kommt in Bewegung und nach dem ersten Hub tritt
die Steuerung in Thätigkeit. Nun werden beide Griffräder einige Mal zurückgedreht,
das Ventil gelangt zum Aufsitzen und die Steuerung kann ohne jedes Hinderniſs
wirken.
Das Abstellen der Maschine geschieht selbstredend in umgekehrter Weise.
Fig.
5 seigt die Anwendung des Apparates auf Corliſsmaschinen; hier sind die
Federn unter den Gleitstücken C in Wegfall gekommen und
durch die an die Hebel der Steuerhähne angehängten Gegengewichte a, b ersetzt.
Die Theorie des Apparates ist in unserer Quelle, Zeitschrift des Vereines deutscher
Ingenieure, 1879 S. 389 ff., gegeben.
G.
H.
Tafeln