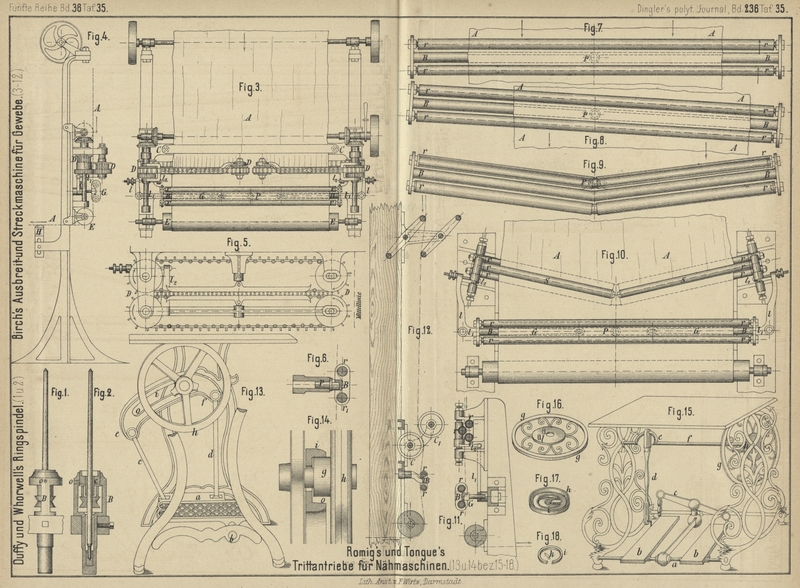| Titel: | Neuerungen an Nähmaschinen und Stickmaschinen. |
| Autor: | G. W. |
| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 380 |
| Download: | XML |
Neuerungen an Nähmaschinen und
Stickmaschinen.
(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes S. 28
Bd. 235.)
Mit Abbildungen auf Tafel 35.
Neuerungen an Nähmaschinen und Stickmaschinen.
Die Anordnungen für den Handbetrieb der Nähmaschinen von Frister und Roſsmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 7254 vom 30. März 1879) zeigen eine neue
Kupplung zwischen Schwungrad und Triebwelle. Das Schwungrad steckt im Allgemeinen
lose auf dieser Welle und dreht sich zwischen einem festen Bunde und einer am Ende
vorgeschraubten Mutter. Seine Nabe trägt auf dem inneren, dem Bunde zugekehrten
Stücke eine Scheibe mit gekerbtem Rande, welche mit Schraubengewinde auf ihr sich
drehen und verschieben läſst; das andere Ende der Nabe enthält ein Stirnrad, welches
durch ein mit der Handkurbel zu bewegendes gröſseres Rad seine Umdrehungen erhält
und damit auch das Schwungrad umdreht. Schraubt man nun die gerändelte Scheibe weit
nach vorn, so drückt sie an den Bundring und preſst zwischen diesen und der äuſseren
Mutter das Schwungrad fest auf die Welle.
Die Spülmaschine
von Louis
Sieſs in Löbtau-Dresden (* D. R. P. Nr. 8056 vom 17. April 1879) ist zur Anwendung an
Nähmaschinen für das Aufspulen des Schiffchenfadens bestimmt; ihr eigenthümlicher
Fadenführertrieb kann jedoch auch an anderen Spulmaschinen Verwendung finden. Der
Fadenführer wird von zwei parallelen Stäben im Gestell getragen und längs derselben
verschoben, wobei er den Faden zwischen beiden Würteln der Spule hin und her führt.
Von ihm reicht ein drehbarer Arm nach abwärts, welcher mit seinen beiden
zugeschärften Seitenkanten beim Hin- und Rückgange abwechselnd an je einer der
beiden Schrauben anliegt, welche unter ihm im Gestell eingelagert sind und von der
Spulenachse aus durch Stirnräder so getrieben werden, daſs ihre Umdrehungsrichtungen
einander entgegengesetzt sind. In der Mitte unter beiden Schrauben liegt eine lange,
nach oben schmäler werdende Schiene, gegen deren Seite der Arm vom Fadenführer sich
anstemmt, so daſs er sicher mit den Schrauben gangen im Eingriff bleibt. Am Ende des
Führerhubes trifft der Führerarm an eine Feder, welche ihn, sobald die untere
Führungsleiste zu Ende ist, auf die andere Seite drängt zum Eingriffe mit der
anderen Schraube, welche ihn in entgegengesetzter Richtung wieder mit zurück nimmt;
er stemmt sich dabei gegen die andere Seite der Führungsleiste.
Der Mechanismus zur Bewegung der Nadelstange an Nähmaschinen von C. A.
Rempen in Linden vor Hannover (* D. R. P. Nr. 8172 vom 13. Mai 1879) besteht darin, daſs in
Singer-Maschinen die Führungsscheibe mit herzförmiger Curve, welche an der
Nadelstange befestigt ist und von dem Kurbelzapfen der Triebwelle erfaſst wird, um
die Nadel zu heben und zu senken, nicht mehr in steifer Verbindung mit der
Nadelstange sich befindet, sondern an einem einarmigen Hebel im Bogen auf und ab
schwingt und erst durch einen Zugarm die Nadelstange mit fort bewegt. Die Verbindung
kann nun so getroffen werden, daſs der höchste und tiefste Stand der Nadel mit den
äuſsersten Ständen des Schiffchens zu gleicher Zeit erreicht, also der obere Faden
mit dem unteren ganz gleichzeitig angezogen wird. Ferner vermeidet diese
Construction den seitlichen Druck fast gänzlich, welchen bei bisheriger Einrichtung
die Kurbel auf die Nadelstange ausübt, und erhält somit den sicheren Gang auf
längere Dauer.
Die Knopfloch-Nähmaschine von Fried. Simmons in
London (* D. R. P. Nr. 7847 vom 15.
März 1879) stellt mit dem Doppelsteppstich einer Schiffchen-Nähmaschine
die Umsäumung der Knopflochkanten her. Der Stoffrücker erhält auſser seiner
fortschreitenden Bewegung nach jedem Stiche noch eine seitliche Schwingung und
verschiebt dadurch den Stoff so, daſs die Nadel abwechselnd in den Schlitz und zur
Seite in die Waare einsticht, also die Kante wie mit überwendlicher Naht umgibt. Die
Schwingungen werden so regulirt, daſs am Ende des Schlitzes Stiche von doppelter
Länge zum Abschluſs der Oeffnung entstehen und dann rückwärts die Schwingungen nach
der entgegengesetzten Seite erfolgen, wobei die andere Kante ihre Naht erhält.
Zwei Patente von G.
Neidlinger in Hamburg (* D. R. P. Nr. 8258 vom 25. März 1879 und Nr. 8264 vom 20. Mai
1879) betreffen solche Transportirvorrichtungen in
Schiffchen-Nähmaschinen, welche den Stoff von oben erfassen und nach jeder Richtung
hin schieben. In beiden Fällen hat man, um die Nahtrichtung im Stoffe zu ändern, den
Stoffrücker direct mit der Hand im Kreise fort zu schieben; dagegen wird er in
Richtung der Stichlänge im ersten Falle durch einen um die Nadelstange herum
liegenden und auf und ab gehenden Kegel nach auswärts gedrängt und von einer Feder
wieder zurückgeschoben und im zweiten Falle zieht ihn ein Winkelhebel direct hin und
her, radial zur Nadelachse gerichtet. Der horizontale Arm dieses Winkelhebels liegt
in der Nuth eines Ringes, welchen die Triebwelle durch eine Curvenscheibe und
Zugstange stetig auf und ab zieht. Die Nadel bewegt sich immer in gleicher Lage und
an gleicher Stelle, ebenso bleibt das Schiffchen unverändert.
Der Spulapparat für
Nähmaschinen von Jos. Wertheim in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 8022 vom 2. April
1879) zeigt eine neue Fadenführung beim Aufwinden des Garnes auf die
Schiffchenspule. Der Fadenführer bildet einen zweiarmigen Hebel, dessen vorderes
Ende den Faden auf die Spule leitet, während das hintere Ende durch eine Zugstange
hin und her geführt wird. Eine Kurbel Scheibe, getrieben von einem Schraubenrade und
einer Schraube der Spulenachse, bewegt diese Zugstange, indem sie deren Endzapfen in
einem radialen Schlitze führt und ihn durch eine Feder stetig an ein fest liegendes
elliptisches Stück andrücken läſst. Der Umfang dieses Führungsstückes ist so
geformt, daſs der Fadenführer eine gleichmäſsige Bewegung erhält.
E. Cornely in
Paris (* D. R. P. Nr. 8481 vom 21.
Juni 1879) hat denjenigen Apparat an der
Bonnaz'schen Tambourirmaschine, welcher zum
Umschlingen des gewöhnlichen Nähfadens mit einem besonderen Zierfaden dient (vgl.
1879 232 39), aus seiner bisherigen Lage und Anordnung
unterhalb der Nähtischplatte herauf gebracht an den Kopf der Maschine. Er besteht
hier aus einer Hülse welche um das Nadelröhrchen drehbar gelagert ist und die
Fadenspule den Führer und Fadenspanner trägt. Diese Hülse wird, ähnlich der früheren
Einrichtung, bei jedem Stiche einmal um die Nadelachse herum gedreht; dabei legt
sich der Zierfaden um den gewöhnlichen Nähfaden und bleibt oben auf dem Stoffe da,
wo der Kettenstich entsteht, sichtbar. Zum Betriebe dieses Apparates enthält das
Gestell oben neben der Triebwelle eine ihr parallel liegende und durch Stirnräder
von ihr getriebene Welle, welche sowohl den oberen Fadenführer, als auch den unteren
gewöhnlichen Führer zum Einlegen des Nähfadens in den Haken der Nadel bewegt.
Ein Nähständer
für die Schirmfabrikation von Berthold Doctor und Comp. in
Berlin (* D. R. P. Nr. 8502 vom 24.
Juni 1879) ist für die Handnäherei beim Ueberziehen des Schirmgestelles
in so fern ein sehr nützliches Geräth, als er den Schirm in irgend einer Lage, den
Stock nach aufwärts gerichtet, zu tragen vermag, so daſs man leicht auſsen und innen
an ihn gelangen kann. Er besteht aus einem Reifen von solcher Weite, daſs ein Theil
der Schirmwölbung im aufgespannten Zustand in ihm Platz findet. Durch gebogene Stäbe
ist dieser Reifen mit einer tiefer liegenden Nabe verbunden, so daſs das Ganze die
Form eines Korbes erhält, welcher mit einer nach abwärts reichenden Schraubenspindel
in einem Fuſsgestell sich nach Art eines Drehstuhles auf und ab bewegt. Ein Kästchen
in dem Nabenstücke und Knöpfe an ihm dienen zum Aufbewahren und Aufhängen von
Nähutensilien und Instrumenten.
Zur Herstellung langer gerader Nähte in
schweren Zeugen, wie z.B. in Segeln oder bei der Zusammensetzung von
Teppichen aus mehreren langen Streifen, haben Rosenberg und Fränkel
in Berlin (* D. R. P. Nr. 8482 vom 24.
Juni 1879) das Nähmaschinengestell zu einem Wagen umgeformt, welcher mit
vier Rädern auf zwei Schienen läuft und auf welchem auch zugleich der Arbeiter
sitzt. Letzterer bewegt in gewöhnlicher Weise durch Tretschemel, Kurbelscheibe und
Schnurentrieb die Hauptwelle der Nähmaschine und diese überträgt durch
Räderübersetzung die Drehung auf die vordere Wagenachse, so daſs gleichzeitig
während des Ganges der Nähmaschine auch das ganze Gestell auf den Schienen
fortfährt, entlang der Kante des zu nähenden und ausgespannten Stoffes. Dabei
entspricht die Stichlänge dem Wege des Wagens während einer Stichzeit. Die hintere
Wagenachse, über welcher sich das Sitzbrett des Arbeiters befindet, ist vertical
drehbar in das Gestell eingelegt, so daſs man mit dem Wagen auch in Curven fahren
kann, wenn die Nahtrichtung nicht eine geradlinige sein soll. Die Rückwärtsbewegung
erfolgt mit gröſserer Geschwindigkeit als der Lauf vorwärts während der Arbeit. –
Derselben Firma sind Neuerungen an
Pechfaden-Nähmaschinen patentirt worden (* D. R. P. Nr.
8379 vom 11. Juli 1879), welche vorherrschend aus verschiedenen
Stoffdrückern bestehen, mit denen man starkes Leder in bestimmte Lagen bringen und
während des Nähens erhalten kann.
Die Vorrichtung zur Bewegung des Schiffchenkorbes in Nähmaschinen von G.
Neidlinger in Hamburg (* D. R. P. Nr. 8569 vom 22. Juli 1879) ist für Cylinder- oder
Armmaschinen anwendbar, welche ein oscillirendes Schiffchen enthalten. Der Träger
oder Korb dieses Schiffchens wird auf eine Scheibe gesetzt und durch einen Stift
fest gehalten, die Scheibe aber mittels einer Kurbel und Stange auf kurze Strecken
vorwärts und rückwärts gedreht. Die betreffende Kurbelstange ist ein zweiarmiger
Hebel, der in der Mitte des Maschinenarmes mit einem Langschlitze an einem Bolzen
hängt und am anderen Ende wiederum von einer Kurbel erfaſst und bewegt wird. Die
Achse der letzteren trägt ein Stirnrädchen, auf welches ein schwingendes Zahnsegment
wirkt, dessen Schwingungen ein Hebel und ein Excenter auf der Triebwelle der
Maschine hervorbringt. – In einem anderen Patente derselben Firma (* D. R. P. Nr. 8589 vom 30. Juli 1879) ist das Segment
entfernt und dadurch ersetzt worden, daſs das Ende des langen Kurbelhebels direct in
der Nuth einer Excenterscheibe läuft und dadurch seitliche Schwingungen erhält. Da
aber auch eine geringe Längsbewegung in der Auflagerung des Hebels erforderlich ist,
so ist er am äuſseren Ende mit einem zweiten Arme verbunden, welcher durch eine andere Curvenführung
derselben Excenterscheibe hin und her gezogen wird. Weiter geben diese Neuerungen
noch eine solche Verbindung zwischen dem Nadelstangenhebel und der Stange selbst an,
daſs bei der Schwingung des ersteren sein vorderes Ende sich gegen die Stange
verschiebt und diese Bewegung wird zur Erzeugung der Fadenspannung benutzt.
Die Vorrichtung an Kettelmaschinen zur
Herstellung sehr langer Maschen von C. A. Roscher in
Markersdorf und Julius Köhler in
Limbach, Sachsen (* D. R. P. Nr. 8572
vom 2. August 1879) ist in derjenigen Nähmaschine verwendbar, welche man
in der Wirkerei sehr vielfach benutzt, um Waarenstücke genau in den Reihen ihrer
Maschen durch eine einfache Kettennaht mit einander zu verbinden. Die Stoffe werden
zu dem Zwecke mit ihren letzten Maschenreihen auf Zähne eines Kammes gehängt, welche
wenig rinnenförmig gebogen sind, so daſs die Nadel längs derselben genau in die
Maschen einstechen kann. Soll nun eine recht lockere Naht entstehen, so legt man
einen zweiten Kamm so in die Maschine ein, daſs dessen dünne Blechzähne zwischen den
Zähnen des Waarenkammes stehen und er sich während der Arbeit mit letzterem
gleichmäſsig fortbewegt. Dann führt die Nadel vor jedem Stiche ihren Faden um einen
solchen Hilfszahn herum, bildet also eine Schleife, welche um so länger wird, je
weiter der Kamm von der Waare entfernt eingestellt und gehalten ist. Anstatt des
Hilfskammes wird vortheilhaft ein Rad mit langen Blechzähnen dann verwendet, wenn an
einer Seite der Maschine Waare aufgehängt werden soll, während die andere schon in
Arbeit ist. Dieses Rad sitzt drehbar an einem Gestellarme, dreht sich während des
Fortschreitens des Waarenkammes und kann gegen denselben verstellt werden; es ist
auch für runde Kettelmaschinen ausschlieſslich anzuwenden, da für diese ein
Hilfekamm nicht angebracht werden kann.
Eine neue Trittbewegung für
Nähmaschinen von J. Romig in Mifflinburg, Pa.,
welche nach dem Scientific American im Engineer, 1880 Bd. 49 S. 190 veröffentlicht ist,
ersetzt die Kurbel am Schwungrade durch folgenden in Fig. 13 und
14 Taf. 35 veranschaulichten Mechanismus: Der Fuſstritthebel a an der Drehachse b ist
durch zwei Zugstangen c und d mit einem geschlitzten Querstücke ef
verbunden, welches mit seinem Schlitze die Nabe g des
Schwung- oder Triebrades h umfaſst. Diese Nabe ist mit
Gummi belegt, damit beim Anliegen der Kanten i oder o eine möglichst groſse Reibung zwischen ihr und diesen
Kanten erzeugt wird. Tritt man nun mit der Fuſsspitze vorn auf den Hebel a, so senkt sich derselbe und zieht durch die Stangen
c und d das Querstück
ef nach vorn hinab; dasselbe drückt dabei mit der
oberen Schlitzkante t auf die Nabe g und dreht, indem es auf ihr entlang gleitet, das Rad
h in der Richtung gegen die Uhr herum. Wenn man
darauf mit der Ferse auf den Hintertheil des Trittbrettes a drückt, so hebt sich dasselbe vorn und hebt durch c, d auch das Querstück ef, welches nun mit der unteren Schlitzkante o
gegen die Nabe g preſst und, indem es längs ihr
zurückgeschoben wird, wiederum das Rad h in derselben
Richtung wie vorher umdreht.
Eine Vorrichtung zum Betriebe von
Nähmaschinen mittels Fuſstrittbewegung von T. S.
Tongue in Birmingham, wie sie sich nach dem Iron, 1880 Bd. 15 S. 183 in Fig. 15 bis
18 Taf. 35 angedeutet findet, verwendet zwei Fuſstritthebel b an gemeinschaftlicher Drehachse a, welche durch einen Hebel c mit einander verbunden sind und mit einer Zugstange d eine Kurbel e und Welle
f umdrehen. Auf der Welle f ist das Schwungrad g fest und die
Triebscheibe h für die Nähmaschine lose angebracht;
beide stehen dicht neben einander und werden bei Drehung nach einer Richtung mit
einander gekuppelt, bei der entgegengesetzten Drehung aber von einander gelöst. Zu
dem Zwecke ist die Scheibe h so ausgedreht, daſs ein
Ring i eingelegt werden kann, welcher gespalten ist und
von einem Keile k zeitweilig ausgetrieben und gespannt
wird. Die beiden Stifte l des Schwungrades g reichen bis in die Aussparung der Scheibe h und einer derselben trifft bei der Drehung des Rades
den Keil k so, daſs er den Ring i festklemmt und die Scheibe k mit umdreht in
der für den Gang der Maschine richtigen Drehungsrichtung. Wird aber die Welle f rückwärts bewegt, so löst sich die Triebscheibe h vom Schwungrade und letzteres kann dann zum Aufspulen
des Garnes benutzt werden.
Der Knopfloch-Verriegelungsapparat
von Julius
Gutmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 8833 vom 10. October 1878) ist diejenige
Vorrichtung an einer mit zwei Nähnadeln arbeitenden Knopfloch-Nähmaschine, durch
welche am Ende des Schlitzes die Stichlänge verdoppelt werden kann, so daſs die
Fadenlagen über den Schlitz hinweg reichen und denselben begrenzen. Es ist zu dem
Zwecke erforderlich, daſs die zwei Nadeln, welche gemeinschaftlich die Langseiten
des Knopfloches benähen, am Ende einer jeden solchen Naht auf die doppelte
Entfernung von einander in ihre Nadelstange eingesetzt werden können, damit dann
beide Nadeln in den Stoff zu beiden Seiten des Schlitzes einstechen, während vorher
nur eine derselben in den Stoff und die andere in den Schlitz selbst sich
herabsenkte. Der Nadelstangenfuſs trägt direct die eine Nadel und enthält auſserdem
ein seitlich verschiebbares Klötzchen, in welches die andere eingeklemmt und das von
einer Feder in zwei Stellungen gehalten wird, so daſs die Nadeln entweder in
einfacher, oder in doppelter Entfernung von einander sich befinden. Die Verschiebung
kann leicht und schnell mit der Hand vorgenommen werden. Die Naht, welche die beiden
Nadeln mit ihren zwei Fäden und mit Hilfe eines dritten unten im Schiffchen
geführten Fadens herstellen, besteht aus zwei Doppelsteppstichnähten, welche dadurch
mit einander verbunden sind, daſs der untere oder Schiffchen-Faden durch die
Schleifen beider Nadelfäden geschoben und daſs auſserdem einer der oberen Fäden bei
jedem Stiche einmal um
den anderen herumgeschlungen wird. Die Nadelstange trägt deshalb die eine Nadel in
ihrer Mitte, in der Richtung ihrer Achse und die andere um so viel seitlich davon,
als die Nahtstiche von der Kante des Knopfloches entfernt sind. Beim Drehen der
Nadelstange bleibt die erstere Nadel im Schlitze stehen und die zweite bewegt sich
mit ihrem Faden um sie herum.
Die Einrichtung zur Bewegung des
Schiffchenkorbes an Nähmaschinen von G. Neidlinger in
Hamburg (* D. R. P. Nr. 9044 vom 25.
März 1879) ist in solchen Arm- oder Cylindermaschinen anzuwenden, welche
ein oscillirendes Schiffchen am Ende des als Nähtisch dienenden schmalen Armes
enthalten. Der Schiffchenkorb liegt fest auf einem Stirnrädchen, welches von zwei
Zahnstangen abwechselnd nach links und rechts gedreht wird, und die Zahnstangen
erhalten ihre Bewegung durch ein Getriebe, einen gezahnten Hebel und eine
Curvenscheibe von der Triebwelle der Maschine.
Der Nadelschutz für
Schiffchen-Nähmaschinen von Oswald Winkler in
Dresden (* D. R. P. Nr. 8982 vom 23.
September 1879) besteht aus einem Doppelwinkel von Stahlblech, welcher
mit einem Ende an den Schiffchenträger angeschraubt ist, also mit demselben sich
bewegt und dabei mit dem anderen Ende, welches über die Schiffchen spitze
hinausreicht, dicht an der Schiffchenbahn anliegt. Hierdurch wird der Nadelkanal
verdeckt, ehe die Spitze des Schiffchens an ihm ankommt, und die Nadel kann nicht
aus ihm heraustreten, was sonst beim Nähen dicker Stoffe durch ungleichmäſsige
Fadenspannung leicht geschieht und wodurch Nadel und Schiffchen, welche an einander
stoſsen, sich beschädigen.
Neuerungen an
Nähmaschinen für Strohgeflechte von G. W. Hooper in
New-York (* D. R. P. Nr. 8852 vom 30.
Juli 1879) beziehen sich auf solche Maschinen, welche mit einer
Zirkelnadel und einem Fadenfänger den Einfaden-Kettenstich nähen. Man verwendet da
für Veränderung der Stichlänge Nadeln und Fadenfänger von verschiedener Länge, kann
dieselben schnell auswechseln und braucht ihre Betriebseinrichtung nicht zu ändern.
Der Ausschub des Stoffrückers wird durch einen mit ihm verbundenen Hebel geändert
und der Stoffdrücker trägt zugleich einen als Nadelwächter dienenden Winkel, welcher
die frei schwingende Nadel so führt, daſs sie nicht verbogen werden kann.
An seiner Sohlennähmaschine (vgl. 1879 231 31) hat Herm. Karl
Gros in Reutlingen folgende
Verbesserungen (* D. R. P. Zusatz Nr. 8719 vom 2. September
1879) angebracht: Der Stoffdrücker wird durch eine Feder stetig an den zu
nähenden Gegenstand angedrückt; er ist ferner am vorderen Ende so getheilt, daſs er
sowohl die Sohle abwärts an den Leisten drückt, als auch seitwärts sie führt und
endlich die Lippe des für die Naht vorbereiteten Risses aufrecht stehend, folglich
den Riſs immer geöffnet erhält. Der Apparat zum Ausziehen der Heftstifte hat eine
neue Form und Bewegungsrichtung erhalten, ferner ist die Vorrichtung zur Aenderung
der Fadenspannung verbessert und endlich in Rahmenhobel und ein neues Verfahren zum
Annähen der Sohle angegeben.
Der Bohrapparat mit
verstellbaren Bohrern an Stickmaschinen von G.
Hornbogen in Plauen im Voigtlande (*
D. R. P. Nr. 9043 vom 3. October 1879) unterscheidet
sich von den bisher verwendeten ähnlichen Apparaten dadurch, daſs die Bohrer
lanzenförmig gestaltet und drehbar angeordnet, ferner durch kurze Arme mit einer
gemeinschaftlichen Stange so verbunden sind, daſs man sie alle gleichzeitig drehen
und mit der Breitseite ihrer Lanzen in eine andere Richtung bringen kann. Bisher
muſste man, um einen Schlitz oder ein sogen. Schneidloch in dem aufgespannten
Stoffstücke an einzelnen Stellen zu erzeugen, mit den Bohrern den Stoff an vielen
dicht neben einander liegenden Stellen durchstechen und etwa stehen bleibende Fäden
zerreiſsen; dagegen hat man nun mit dem neuen Apparate nur einmal zu arbeiten und
erhält längere oder kürzere Schlitze, je nachdem man mit den Lanzen mehr oder
weniger weit durch den Stoff hindurch fährt.
G.
W.
Tafeln