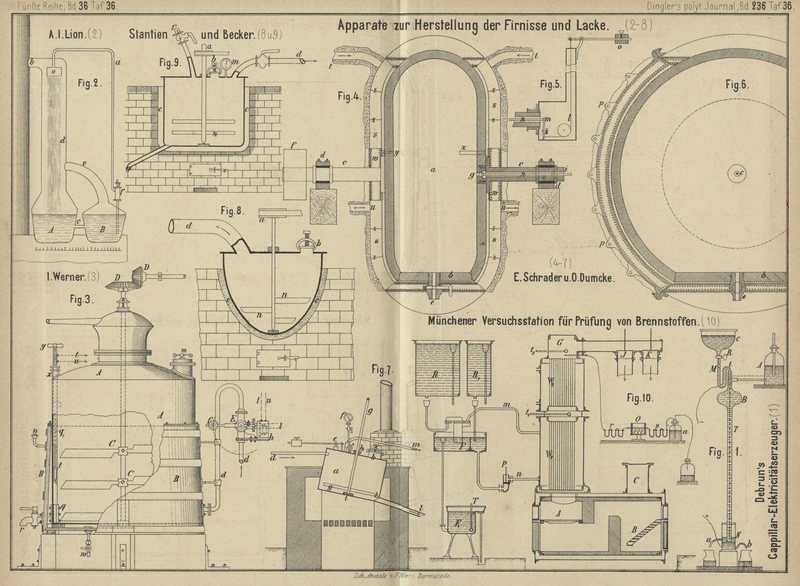| Titel: | Zur Herstellung der Firnisse und Lacke. |
| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 393 |
| Download: | XML |
Zur Herstellung der Firnisse und
Lacke.
Mit Abbildungen auf Tafel 36.
Zur Herstellung der Firnisse und Lacke.
Apparat zur Herstellung trocknender Oele und Firnisse.
A. I. Lion
in Paris (* D. R. P. Kl. 22 Nr. 2741 vom
10. Februar 1878) kocht die Oele in den beiden Kesseln A und B (Fig. 2 Taf.
36), welche durch das Rohr c mit einander in Verbindung
stehen. Die in B entwickelten Dämpfe entweichen durch
das Rohr e, steigen mit den in dem Kessel A entwickelten Dämpfen in d auf und treten durch den Ansatz b in den
Schornstein. Das heiſse Oel wird mittels der Pumpe f
durch das Steigrohr a in das Sieb o gehoben, aus welchem es in feine Strahlen vertheilt
in dem Rohre d herunterfällt, worauf es dann durch das
Verbindungsrohr c nach B
zurückflieſst. – Ob auſserdem durch das Rohr d
atmosphärische Luft hindurchgetrieben werden soll, ist nicht angegeben.
Dampfkochapparat für die Herstellung von Lacken. I. Werner in
Mannheim (* D. R. P. Kl. 22 Nr. 3235
vom 3. Mai 1878) umgibt den dicht geschlossenen Metallkessel A (Fig. 3 Taf.
36) mit einem starken Holzmantel B und zwischen
liegendem Dampfraum. Im Inneren des Kessels befindet sich das Rührwerk C, welches mittels der Kegelräder D bewegt wird. Die Rohstoffe werden durch m eingeführt, der fertige Lack durch das Rohr r abgelassen. Vor letzterem ist der Sicherheit wegen
noch ein besonderer Schieber q angebracht, dessen mit
Handgriff y versehene hohle Stange q1 bei x durch eine Stopfbüchse in den Kessel geht. Im Inneren
der Stange ist ein Thermometer t angebracht, in dessen
Kugel ein Platindraht eingeschmolzen ist, welcher mit dem anderen Ende auf die hohle
Schieberstange aufgelöthet wird. Oben ist das Thermometer mit einem Korkstöpsel
verschlossen, durch welchen ein Platindraht bis zu der Stelle hindurchgeht, welche
der höchsten zulässigen Temperatur entspricht. Von den beiden mit dem Elektromagnet
h verbundenen Leitungsdrähten t und u ist der eine mit
diesem Platindraht, der andere mit dem Rohr q1 verbunden.
Das Rohr d führt nun Dampf in den Zwischenraum zwischen
Kessel A und Holzmantel B.
Sobald nun die dadurch bewirkte Erwärmung des Kessels zu hoch steigt, wird im
Thermometer der Strom geschlossen, der Elektromagnet h
zieht seinen Anker zurück, worauf sofort das Gewicht f
den Hebelarm fb senkrecht stellt und dadurch den
Dreiweghahn E so richtet, daſs der gesammte Dampf jetzt
durch das seitlich angebrachte Rohr l austritt (vgl.
1879 231 558). Das Röhrchen w führt das
Condensationswasser ab, während das Luftventil n bei
der Dampfabstellung die Bildung eines luftleeren Raumes verhüten soll.
Autoclav zum Lösen von Bernstein. E. Schrader und O.
Dumcke in Königsberg i. Pr. (* D. R. P. Kl. 22 Nr. 4049 vom 26. März 1878) verwenden ein
35at Druck aushaltendes Gefäſs aus Eisen (Fig.
4 bis 6 Taf. 36),
welches innen mit versilbertem Kupfer ausgekleidet ist. Dasselbe trägt bei b ein mit dem Hahn e
versehenes Mannloch und ist mit den in den Lagern d
ruhenden Achsenstücken c fest verbunden; auf der einen
Achse sitzt bei f eine Riemenscheibe und in der
anderen, welche durchbohrt ist, bei g ein Kegelventil,
welches sich unter dem Drucke von 25at in der
Weise öffnet, daſs das Innere des Autoclaven mit dem von g bis i reichenden Theil der eisernen
Hohlachse in Verbindung treten kann, so daſs etwa entweichende Dämpfe auf diese
Weise unschädlich ins Freie geleitet werden können. Die Belastung des Kegelventiles
g ist aus Fig. 5
ersichtlich, wonach sich bei k der Drehpunkt des
zweiarmigen Hebels m befindet, welcher einerseits durch
die Stange n mit dem Ventil g, andererseits durch die über eine Rolle geführte Kette l mit dem Gewicht o
verbunden ist.
Um den Autoclaven liegt ein fester, mit schlecht leitender Packung belegter und durch
Stützen z gehaltener doppelwandiger Mantel aus
Eisenblech, bestehend aus zwei durch Bolzen p so
verbundenen Hälften, daſs der Autoclav frei zwischen ihnen rotiren kann. Bei t tritt in den Mantel überhitzte Luft, welche bei u wieder entweicht. Auſser den Ausschnitten im Mantel
zur Freilegung der Entleerungs- und Füllöffnung sind die seitlichen Ausschnitte w dazu bestimmt, die Achsen vor Erwärmung zu schützen.
Bei x reicht in den Autoclaven eine unten geschlossene
Röhre zur Aufnahme des Thermometers hinein; bei y
befindet sich ein Stutzen, der für gewöhnlich mit einer Kapsel zugeschraubt ist und
einerseits zur Aufnahme des Manometers beim Controliren des Autoclaven, andererseits
dazu dient, das Innere desselben mit einer Druckpumpe in Verbindung zu setzen.
Man bringt nun durch das Mannloch b eine Mischung von 40
Th. Terpentinöl und 60 Th. Bernstein in den Apparat, schlieſst denselben und erhitzt
den Inhalt durch Einführung 400 bis 420° heiſser Luft in den Mantel, während
gleichzeitig der Apparat in Umdrehung versetzt wird. Nach 3 Stunden wird die heiſse
Luft abgestellt, das Mannloch b nach unten gebracht und
der vorher auf 50° erkaltete Inhalt mit Hilfe der Druckpumpe zum Ausflieſsen
gebracht.
Nach einem anderen Vorschlage der Patentinhaber (* D. R. P. Kl.
22 Nr. 4679 vom 29. Juni 1878) wird der Bernstein ohne Anwendung von
Druck mittels überhitzten Wasserdampfes in einem einfacheren Apparate
geschmolzen.
Nach einem dritten Patent (* D. R. P. Kl. 22 Nr. 6322 vom 19.
Januar 1879) verwenden Schrader und Dumcke einen cylindrischen Schmelzkessel a (Fig. 7 Taf.
36), welcher geneigt eingemauert wird. Während des Schmelzens tritt durch das Rohr d Wasserdampf von 1 bis 2at Spannung (oder Kohlensäure bezieh. Stickstoff), welcher die Aufgabe
hat, die vorhandene Luft zu verdrängen und das geschmolzene Harz durch ein am Boden
des Apparates an tiefster Stelle befindliches und mit einer siebartigen Vorrichtung
k versehenes Rohr l zu
entfernen. Dadurch wird das Eintreten einer energischen Oxydation überhaupt
vermieden und jeder bereits geschmolzene Antheil der weiteren Einwirkung höherer
Hitzegrade entzogen, welche, da diese Harze keine einheitlichen Körper sind, bei dem
Fortschreiten der Operation bis zur vollendeten Schmelzung nothwendig eintreten
müssen. Die entstehenden hellen Producte werden in Kanälen aufgefangen, welche
geschlossen sind, damit die Arbeiter nicht belästigt werden, und nur eine
Rohrverbindung mit der freien Luft haben, um Wasserdampf und etwa gebildete Gase
fortzuführen. Am Deckel des Apparates befinden sich Mannloch b, Sicherheitsventil e, Manometer f, ferner ein Rohr m, um
gebildetes Copal- oder Bernsteinöl und Bernsteinsäure zu geeigneten Condensatoren zu
leiten, und ein starkes Rührwerk g, welches bei i in der Spur und bei h in
einer Stopfbüchse geht.
Nach einer kleinen Schrift von Stantien und Becker in Königsberg geschieht
das Schmelzen des Bernsteins theils in offenen Kesseln, besser aber in geschlossenen
Gefäſsen (Fig. 8 Taf.
36) mit Rührwerk n und Füllöffnung b; die flüchtigen Producte entweichen durch das Rohr
d. Damit der Bernstein nicht mit den zu heiſsen
Wänden in Berührung kommt, verwendet man einen Kessel mit doppeltem Boden oder
Sandbad c.
Für gröſsere Anlagen wird der mit Manometer m versehene
Apparat Fig. 9 Taf.
36 empfohlen. Während des Schmelzens wird durch das Rohr f Wasserdampf von 1 bis 2at Spannung
eingeführt, bis der geschmolzene Bernstein durch das mit Siebblech versehene und mit
Lehm beschlagene Rohr g abgeflossen ist. Dieses
Einleiten von Dampf soll aber erst dann stattfinden, wenn die Masse im Schmelzkessel
anfängt, sich zu verflüssigen, weil sonst bei früherem Eindringen desselben ein zu
groſser Wärmeverlust eintreten und die Farbe des Productes durch zu langsames Rösten
keine den Wünschen entsprechende werden würde.
Zur Herstellung von Lacken wird nun das so erhaltene Bernstein-Colophonium in der
nöthigen Menge Leinölfirniſs unter geringem Erwärmen und beständigem Umrühren
gelöst, worauf nach und nach das Terpentinöl zugesetzt wird. Die beste und
empfehlenswertheste Mischung, welche so zu sagen als Grund- und Ausgaogskörper für
alle anderen Bernsteinlacke dienen kann, ist die folgende: 25 Th.
Bernstein-Colophonium, 25 Th. Leinölfirniſs und 50 Th. Terpentinöl. In der Farbe
kann dieses Fabrikat durch eine theilweise Ersetzung des Bernstein-Colophoniums
durch geschmolzenen Copal an Güte erhöht werden; so erhält man ein Product,
welches mit den feinen englischen Kutschenlacken von Nobles
und Hoare übereinstimmt durch Befolgung der nachstehenden Vorschriften:
Bernstein-Colophonium
30 Th.
30 Th.
Geschmolzener Copal
30
–
Leinölfirniſs
60
60
Terpentinöl
120
120
Terpentin-Colophonium
–
30
Tafeln