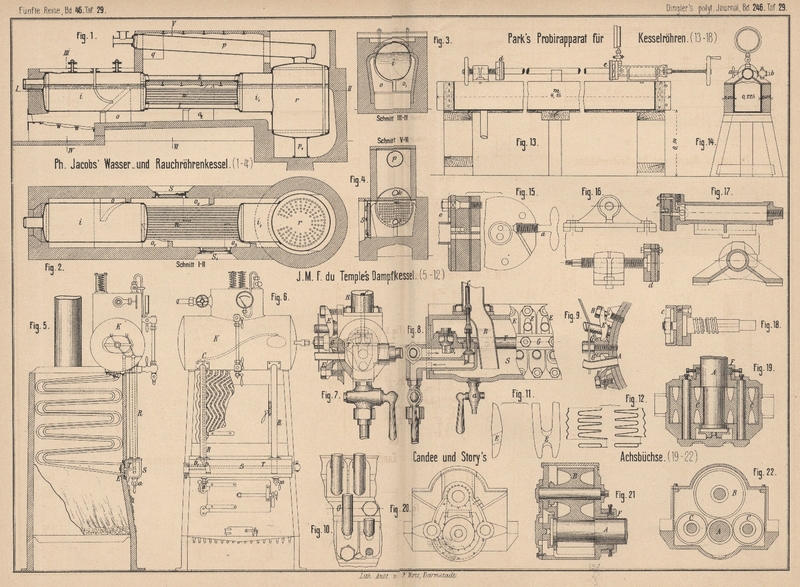| Titel: | J. M. F. du Temple's Dampferzeuger. |
| Autor: | Whg. |
| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 397 |
| Download: | XML |
J. M. F. du Temple's Dampferzeuger.
Mit Abbildungen auf Tafel 29.
J. M. F. du Temple's Dampferzeuger.
In Frankreich hat in den letzten Jahren ein ganz eigenartiger Dampferzeuger Auſsehen
erregt, welcher von dem französischen Marineofficier J. M. F. du
Temple in Paris (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 1584 vom 1. August 1877 und * Nr. 12850 vom
29. Juni 1880) herrührt und in den Fig. 5 bis
12 Taf. 29 abgebildet ist. Derselbe besteht im Wesentlichen aus einer
groſsen Anzahl sehr enger gezogener Stahlrohren, welche kalt in zick-zackformige
Windungen gebogen und paarweise unten in einem kastenartigen Behälter S, oben in einem cylindrischen Kessel K befestigt sind. Der innere Durchmesser der Röhren
beträgt je nach der Gröſse des Dampferzeugers nur 9,5, 13 oder 17mm, ihre Wandstärke bezieh. 1,75, 2 und 2mm,5. Ursprünglich waren noch viel engere Röhren
von 2 bis 3mm Durchmesser an in Aussicht genommen.
Die Behälter S und K
sind auſserdem durch
zwei weite Rohre R mit einander verbunden und sammt
diesen auſserhalb des Feuerraumes angebracht, während die engen Röhren, in einen
Ofen eingebaut, unmittelbar im Feuer liegen. Der obere hauptsächlich als
Dampfsammler dienende Kessel K soll etwa bis zur Hälfte
noch mit Wasser gefüllt sein. Er ist mit Wasserstandsglas, Sicherheitsventilen
u.s.w. versehen. Die Röhren liegen in einander verschlungen (vgl. auch Fig.
12), dicht neben einander und sind in allen Theilen so geneigt, daſs sie
nach Oeffnen der an S befindlichen Ablaſshähne a vollständig entleert werden können. Ihre aus Fig.
7 bis 10
ersichtliche Befestigung in den Theilen S und K gestattet eine schnelle und bequeme Auswechselung.
Auf die Enden der Röhren sind nämlich kleine kegelförmige Bronzemuffe A gelöthet, welche mit Hilfe von Gabelhebeln E (vgl. Fig. 11)
fest in die entsprechend kegelförmigen Oeffnungen der Gefäſswand gepreſst werden.
Die Hebel E fassen mit dem einen Ende unter eine
aufgeschraubte ⊤-Schiene G und werden am anderen Ende
durch Schrauben H niedergedrückt.
Da in den Röhren eine sehr starke Verdampfung vor sich geht, mithin die Wassersäule
in den äuſseren Rohren R ein starkes Uebergewicht
erhält, so muſs auch der Wasserumlauf mit auſserordentlicher Geschwindigkeit
stattfinden und wegen dieser groſsen Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser bezieh.
das Wasser- und Dampfgemisch in den Röhren aufsteigt, ist es auch möglich, daſs die
letzteren ziemlich rein bleiben. Die festen Niederschläge sollen sich auf dem Boden
des unteren Behälters S sammeln, zu welchem Zwecke die
Rücklaufrohre R tief in S
hinabreichen. Von da können sie durch die Hähne a
zeitweilig abgeblasen werden.
Die Speisung erfolgt durch das in den Behälter S
eingelegte Rohr T, welches den Mündungen der
Schlangenröhren gegenüber mit Löchern versehen ist, welche um so gröſser sind, je
weiter sie von der Eintrittstelle des Rohres T in S entfernt liegen. Hierdurch soll eine möglichst
gleichmäſsige Vertheilung des Wassers in die Röhren erreicht werden. Es wird eine
ununterbrochen arbeitende Speisepumpe vorausgesetzt. Um den Wasserstand in dem
Oberkessel annähernd immer auf gleicher Höhe zu halten, ist in demselben an einem
langen Hebel ein Schwimmer angebracht, welcher beim Steigen des Wasserstandes über
eine bestimmte Höhe mittels der Stange C (Fig.
7 und 8) ein
Rücklaufventil D öffnet. Durch das Rückschlagventil D1 tritt das Wasser in
das Rohr T ein.
Dieser Dampferzeuger ist seit 5 Jahren in der französischen Marine für kleine Dampf
boote benutzt worden und soll sehr befriedigende Resultate ergeben haben. In den
Sitzungsberichten der Société d'Encouragement, 1882 S.
172 finden sich über denselben folgende Angaben. Auf Befehl des Marineministers
wurden in den J. 1877 bis 1880 Versuche mit dem Dampferzeuger ausgeführt, welche
nachstehende Ergebnisse lieferten:
April
Februar
November
Februar
Zeit des Versuches
1877
1878
1879
1880
Durchmesser der Röhren in mm
6
9
12
13
Heizfläche in qm
4,75
8
8
6,2
Pferdestärken
9,5
23
25
22
VerdampftesWasser
in der Stunde kfür 1qm
Heizfläche stündl.für 1k
Kohlefür 1e
207 13 3,7 26
475 39 5 21
660 83,3 7,14 25
550 90 7,7 25
Mit den 6mm weiten Röhren
ist mithin nur eine 3,7 fache Verdampfung erreicht, dagegen mit den 13mm weiten Röhren eine 7,7fache. Wahrscheinlich
hätte wohl bei den dünnen Röhren eine bessere Ausnutzung der Heizgase erzielt werden
können. Im Privatbetriebe soll auch schon eine 12 fache Verdampfung erreicht worden
sein. Die Hauptvorzüge der du Temple'schen Construction
sind jedoch in der Verminderung der Explosionsgefahr, in der schnellen
Dampferzeugung, der Zulässigkeit hoher Spannungen und dem bequemen Auseinandernehmen
und Wiederzusammensetzen bezieh. Auswechseln von Röhren zu suchen. Bei einer
Reparatur, bei welcher ein Arbeiter benutzt wurde, welcher den Dampferzeuger nie
gesehen hatte, war es z.B. möglich, daſs nach Verlauf von 2 Stunden, von denen eine
auf die eigentliche Reparatur kam, sämmtliche Röhren herausgenommen, wieder
eingesetzt und die Maschine in Gang gesetzt war. Bei einem Versuche in Toulon wurde in 6 Minuten nach dem Anzünden Dampf von
9at Spannung erzielt. Hiernach würde sich die
Anordnung ganz besonders für Dampfspritzen eignen. Am
meisten dürfte das Verbrennen und Verstopfen der Röhren zu befürchten sein; doch
wird versichert, daſs sie in Folge des äuſserst lebhaften Wasserumlaufes sich lange
halten. Es wird über mehrere Fälle berichtet, in welchen die Röhren in Folge von
Wassermangel rothglühend geworden waren und ohne weiteres in diese glühenden Röhren
gespeist wurde, ohne daſs irgend ein Nachtheil zu bemerken war. Zum Beweise, daſs
die Bedienung des Kessels sehr einfach und leicht sei, wird angeführt, daſs du Temple Kinder als Heizer benutzt. Auch auf der
Ausstellung für Elektricität in Paris 1881 hatte ein 13jähriger Bursche eine
Locomobile von 4e zu bedienen, welche nach diesem
System gebaut war. Die bis jetzt ausgeführten Dampferzeuger sind für 2 bis 60e effectiv bestimmt; doch will du Temple auch solche für 500 bis 600e bauen. Für industrielle Zwecke, namentlich, wenn
es auf sehr regelmäſsigen Gang der Maschine ankommt, wird diese Construction jedoch
kaum Anwendung finden können.
Whg.
Tafeln