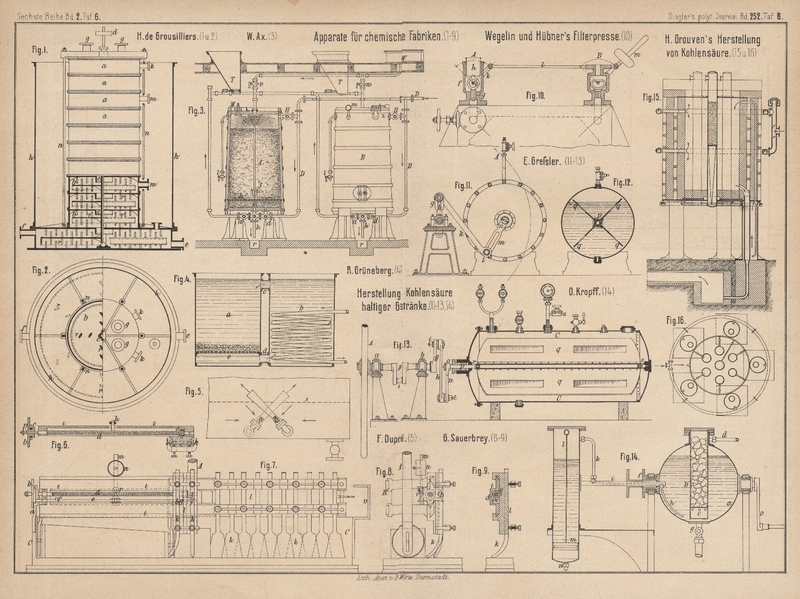| Titel: | E. Grouven's Ofen zur Darstellung von reiner Kohlensäure aus Kalkstein, Dolomit oder Strontianit mittels glühenden Wasserdampfes; von E. Meyer-Mülsen. |
| Autor: | E. Meyer-Mülsen |
| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 68 |
| Download: | XML |
E. Grouven's Ofen zur Darstellung von reiner
Kohlensäure aus Kalkstein, Dolomit oder Strontianit mittels glühenden Wasserdampfes; von
E. Meyer-Mülsen.
Mit Abbildungen auf Tafel 6.
Grouven's Ofen zur Darstellung von Kohlensäure.
Leitet man durch ein glühendes, mit Stücken von Kalkstein, Dolomit oder Witherit
gefülltes Rohr gewisse Mengen heiſsen Wasserdampfes, so stellt sich schon bei
mäſsiger Rothglut eine Entbindung von Kohlensäure und nach gewisser Zeit eine
vollständige Kausticität jener Mineralien ein. Diese Beobachtung ist schon von
verschiedenen Chemikern gemacht, also nicht neu. Ihre Anwendung auf die Industrie
der Kohlensäure-Gewinnung sowohl, als auf die des Kalkbrennens hat aber noch nicht
stattgefunden; überall brennt man noch Kalkstein oder Strontianit, Dolomit u. dgl.
in Schachtöfen bei angehender Weiſsglut entweder mittels eingeschichteter Kohle und
Luft, oder mittels Gas und Luft; auch überall, wo man viel Kohlensäure braucht, wie
in Zuckerfabriken, Ammoniaksodafabriken und so manchen anderen chemischen
Industrien, da wird dieselbe in ähnlichen überdies mit theuren Pumpwerken und
Waschapparaten versehenen Schachtöfen erzeugt. Die dabei erzielte Kohlensäure ist
eigentlich nur ein an Kohlensäure reiches Rauchgas, welches bloſs 20 bis 30 Procent
Kohlensäure enthält und trotz groſser Waschvorrichtungen manchmal, namentlich bei
Anwendung böhmischer Kohle, viele Theergase führt. Auch durch seine oft groſsen
Sauerstoffantheile schädigt es manche Saturation.
Eine so verdünnte Kohlensäure muſs in 4 fach gröſserem Volumen durch die zu
saturirenden Flüssigkeiten getrieben werden und darin liegt die Schuld ihrer oft
unvollständigen Ausnutzung. Ich beobachtete bei 30° warmen Ammoniaklösungen 30 bis
50 Proc. Verlust an nicht absorbirter Kohlensäure und zwar unter Umständen, wo ¼
Volumen reiner Kohlensäure fast gänzlich absorbirt wurde. Bei heiſsen
Aetzkalklösungen war jener Verlust nicht so groſs.
Kohlensäuregewinnung mittels Wasserdampf hat nicht bloſs die Zulässigkeit einer
niedrigeren Temperatur, sondern gewährt auch, da keinerlei Gas sich mit der
entwickelten Kohlensäure vermengt, auſser dem leicht zu condensirenden
überschüssigen Wasserdampfe, eine Kohlensäure von 99 Proc., d.h. eine ebenso reine,
wie sie in Mineralwasserfabriken aus Magnesit und Schwefelsäure dargestellt wird.
Solche Kohlensäure bedarf keiner Waschapparate; sie läſst die Möglichkeit zu, den
Saturationsbatterien die kleinste, also billigste Gröſse zu geben. Die Vorzüge der
Wasserdampf-Methode erscheinen also so groſs, daſs man den Grund ihrer bisherigen
Nichteinführung nur suchen kann in den vielerlei abschreckend wirkenden
Schwierigkeiten, welche in der Construction einer entsprechenden Ofenanlage
liegen.
Die in der chemischen Fabrik zu Bürgerhof bei Lauenburg auszuführenden Prozesse
führten nun Dr. H. Grouven in
Leipzig (* D. R. P. Kl. 12 Nr. 26248
vom 4. December 1883), nach mehrjährigen groſsen Vorversuchen, zur
Construction des in Fig. 15 und
16 Taf. 6 dargestellten Ofens, welcher sich gut bewährt hat. Die
Zeichnung zeigt den Ofen mit 7 Retorten, wobei derselbe einer Leistungsfähigkeit von
täglich 7t,5 Kalkstein entspricht; er kann aber
ebenso gut auf 12 oder 16 Retorten erweitert werden; auch können letztere, je nach
Leistungsforderung, ebenso gut 4 wie 3m Länge im
Feuer haben. In allen Fällen ist aber erfahrungsgemäſs eine lichte Weite der
Retorten von 0m,25 die zweckmäſsigste. Je weiter,
desto schwieriger ist die Durchheizung derselben und desto gröſsere Glut muſs das
ringsum brennende Gasfeuer bieten. Man wünscht aber zur Conservirung der Retorten
diese Glut nicht unnöthig hoch. Luft und Gas, welche der Ofen zur Heizung bedarf,
wird in denselben mittels eines Roots-Gebläses
hineingedrückt. Angenommen, der Ofen brauche zur Heizung minutlich 1k Kokes, so hat dieses Gebläse die Hälfte (4cbm,5) der nöthigen Luft in den Gasgenerator, die
andere Hälfte (4cbm,5) in den eigentlichen Ofen zu
treiben. Direkt aus dem Generator kommend, strömt das Kokesgas mittels zweier
Gasringe aus 10 Oeffnungen in den Ofen mit einer Temperatur von 600 bis 800°. Die zu
dessen Verbrennung nöthige Luft wird oben unter der Decke des Ofens durch 5 Düsen
eingepreſst, auf keinen Gasstrahl stoſsend und daher nirgendwo Stichflammen
erzeugend, welche einer Retorte gefährlich wären. Auch die Luft tritt 300 bis 400°
vorgewärmt in den Ofen; ihre Vorerwärmung findet innerhalb der 5 Säulen, auf welchen
der Ofen steht, statt und zwar durch die Wärme der nach unten hin abziehenden
Rauchgase. Obgleich damit die Bedingungen einer hohen Verbrennungstemperatur gegeben
sind, so bleibt doch die Mischung von Luft und Gas eine allmähliche und sich auf die
ganze Höhe des Ofens erstreckende.
Die Retorten werden nur zur Hälfte mit dem zu brennenden Kalksteine gefüllt, auch in
keinen gröſseren Stücken als 20 bis 40mm. Auf je
1t Füllung läſst man minutlich 1k Dampf durchstreichen. Indem der Dampf zunächst
unten in die leere Hälfte der hochglühenden Retorten einströmt, bekommt er bis zum
Eintritte in die Füllmasse eine solche Ueberhitzung, daſs ihm die Aufgabe leicht
wird, das auf dem Roste lagernde glühende Gestein zu decarbonisiren. Von unten
frisch und stetig nachströmend, entführt er rasch die frei werdende Kohlensäure nach
oben hin bis zum Ausgange der Retorten und bis zur Condensation.
Solche Retorten brauchen erfahrungsgemäſs zur vollständigen Entkohlensäuerung ihres
Inhaltes etwa 4 Stunden. Die kaustisch gebrannte Masse läſst man dann, nachdem oben
die Retorte durch Zudrehung des Hahnes isolirt worden, mit dem beweglichen Roste
herabfallen. Nach Wiedereinsetzung des Rostes bekommt sie sofort wieder neue Füllung
von oben durch die
leicht zu handhabende und gasdicht schlieſsende Morton'sche Thür. Zum Brennen von je 100k
Rüdesheimer Muschelkalk muſsten in Bürgerhof ungefähr 12k Kokes und 24k Dampf aufgewendet
werden. Hieraus geht hervor, wie wenig Brennmaterial ein solcher Ofen bedarf.
Gibt man in die Retorten anstatt Kalkstein gewöhnlichen Pyrit in Nuſsdicke, so findet
unter theilweiser Spaltung des Dampfes allmählich eine vollständige Entschwefelung
des Pyrites statt; der Schwefel entweicht in Form von Schwefel wasserstoffgas und in
den Retorten bleibt Eisenoxydoxydul mit den sonstigen Nebenbestandtheilen der Pyrite
zurück. Somit ist jener Ofen gleichzeitig zur Herstellung von Schwefelwasserstoffgas
geeignet.
Tafeln