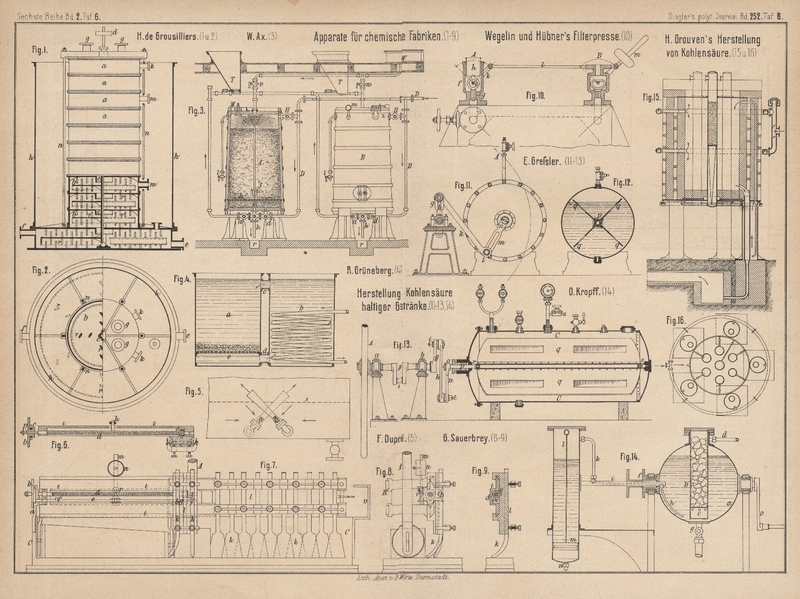| Titel: | Neuere Apparate für chemische Fabriken. |
| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 70 |
| Download: | XML |
Neuere Apparate für chemische
Fabriken.
Patentklasse 12. Mit Abbildungen auf Tafel 6.
Neuere Apparate für chemische Fabriken.
Der Apparat zur Absorption von Gasen durch Flüssigkeiten
von H. de
Grousilliers in Berlin (D. R. P. Nr. 24600 vom 1. März 1883) besteht im
Wesentlichen aus einem äuſseren und einem inneren Tellersysteme. Die äuſseren Teller
a (Fig. 1 und
2 Taf. 6) haben in der Mitte eine kreisrunde Oeffnung, welche ebenso wie
der äuſsere Umfang des Tellers von nach unten gehenden Rändern eingefaſst ist. Mit
ihrem äuſseren Rande sitzen die Teller auf einander auf, indem immer eine
Gummischnur zwischen ihre Flanschen gelegt wird, welche nach Anziehung der
Ankerschrauben n die Dichtung bildet. Die inneren
Teller b haben in der Mitte eine vierkantige Nabe, mit
welcher sie über die gleichfalls vierkantige Welle c
geschoben werden und so mit dieser beweglich sind. Der äuſsere Rand des inneren
Tellers geht nach unten und ist ebenso wie der innere Rand des äuſseren Tellers
gezahnt, damit das Gas nie an einer Seite austritt, sondern in feinen Strahlen durch
die Flüssigkeit hindurchgeht. Sämmtliche Teller sind mit Rührstäben r versehen, welche so befestigt sind, daſs die der
inneren Teller beim Drehen der Welle durch die der äuſseren hindurchgehen.
Sobald ein Gas absorbirt werden soll, wird mittels der Riemenscheibe d die Welle c und das
ganze innere Tellersystem b in Bewegung gesetzt. Die
Flüssigkeit strömt durch Rohre k in den Apparat und
wird ihr Abfluſs aus dem Stutzen e so gehalten, daſs
der Apparat stets gefüllt bleibt und die ablaufende Flüssigkeit möglichst gesättigt
ist. Das Gas strömt bei f ein und geht von einem
äuſseren Teller zu einem inneren, von diesem wieder zu einem äuſseren u.s.f., unter
jedem eine dünne Schicht bildend, und wird dadurch, daſs die Rührstäbe die
Flüssigkeit heftig bewegen, mit dieser möglichst gemischt; gleichzeitig soll
hierdurch das Absetzen etwaiger Niederschläge verhütet werden. Das nicht absorbirte
Gas entweicht bei g. Eine etwaige Reinigung kann durch
Stutzen m
ausgeführt werden, eine
erforderliche Kühlung durch Füllen des Blechcylinders h
mit Wasser.
W.
Ax in Siegen (* D. R. P. Nr. 24752 vom 14. Januar 1883) empfiehlt zur Gewinnung von Gerbstoffen zwei Fässer A und B (Fig. 3 Taf.
6), welche mit Manometer m und Sicherheitsventil z versehen sind. Die Fässer werden durch Mannloch M vom Trichter T aus mit
Lohe u. dgl. gefüllt. Dann öffnet man die Wasserhähne w
und v, so daſs aus dem Behälter W durch die Brause S Wasser auf die Lohe
flieſst. Der so erhaltene erste Auszug, welcher sich unter dem Siebboden b sammelt, ist besonders rein und kann zum Gerben aller
Arten von Leder verwendet werden. Die Flüssigkeit läſst man durch Rohr h in die Ablaufrinne r
flieſsen.
Will man jedoch mittels dieser Apparate eine concentrirte Gerblösung für Bodenleder
(Sohlleder o. dgl.) erzielen, so wird die Füllöffnung M
dicht verschlossen, der nach unten führende Lufthahn l
geöffnet, der Wasserzufluſs von oben durch Schlieſsen der Hähne w und v abgestellt und
durch Rohr D Dampf unter den Siebboden b geführt. Hat dieser die Luft durch den Hahn l ausgetrieben, so wird der Hahn d geschlossen und der zum Dampfstrahlgebläse J führende Hahn geöffnet, so daſs der Dampf die
Lohbrühe unter dem Siebboden ansaugt und in die Brause S hebt. Bei dieser heiſsen Auslaugung soll der Dampfdruck unter 2at bleiben, damit der Gerbstoff nicht zersetzt
wird.
Soll der erhaltene Loheauszug verstärkt werden, so schlieſst man den Hahn zum
Dampfstrahlgebläse, öffnet die Hähne H und a, so daſs der Dampf die Brühe durch Rohr A in den mit Gerbstoff haltigen Stoffen gefüllten
Apparat B drückt.
Der von R.
Grüneberg in Stettin (* D. R. P. Nr. 25775 vom 22. März 1883) angegebene Löseapparat besteht, wie Fig. 4 Taf.
6 zeigt, aus zwei Gefäſsen a und b, welche durch Röhren c
und d verbunden sind. Das zu lösende Salz wird auf den
durchlochten Doppelboden e des Gefäſses a gebracht und nun die Lauge bezieh. das Wasser in die
beiden Gefäſse gefüllt. Der Inhalt von b wird durch
einen Heizapparat, z.B. durch eine Heizschlange s
erhitzt. In Folge der stetigen Temperaturerhöhung in b
und der Zunahme des specifischen Gewichtes der Lauge in a wird in beiden Gefäſsen eine heftige Bewegung der Lauge in der durch die
Pfeile angedeuteten Richtung erzeugt werden, so daſs die Lösung der auf dem
Siebboden des Gefäſses a liegenden Salze in sehr kurzer
Zeit vor sich geht. Sobald die gewünschte Concentration erreicht ist, wird die
völlig klare Lauge ohne Verwendung von Decantirgefäſsen aus dem Gefäſse b zur Krystallisation abgelassen, während a stets mit dem betreffenden Salze gefüllt erhalten
bleibt, bis die Ansammlung von unlöslichen Bestandtheilen eine Reinigung des
Gefäſses a erforderlich macht.
F. W.
Dupré in Staſsfurt (* D. R. P. Nr. 25018 vom 20. März 1883) empfiehlt in Auslaugeapparaten, welche namentlich für Staſsfurter
Kalisalze bestimmt sind,
die Verwendung von Strahlapparaten. Dieselben werden so
angebracht, daſs ihre Saugöffnungen a (Fig. 5 Taf.
6) mit dem Räume unter dem Siebboden s, die
Ausstoſsöffnungen mit dem Räume über dem Siebboden in Verbindung stehen.
Gleichzeitig bekommt der ausgestoſsene Flüssigkeitsstrom durch entsprechende Lage
des Strahlapparates oder der Verbindungsröhren eine solche Richtung, daſs dadurch
ein lebhafter Kreislauf der Flüssigkeit und der Salztheile über dem Siebboden
erzeugt wird g abgesehen von einer Vermischung der
Laugen soll hierdurch eine gleichmäſsige Vertheilung der Salztheile auf dem
Siebboden erzielt werden.
Die Schabevorrichtung an Salpeter- und
Chlorkalium-Trockenapparaten von G. Sauerbrey in
Staſsfurt (* D. R. P. Kl. 75 Nr.
24080 vom 13. Oktober 1882) besteht, wie aus Fig. 6 bis
9 Taf. 6 zu entnehmen, aus einem guſseisernen Bette t, welches an dem schmiedeisernen Rahmen R des Rührwerkes befestigt wird, das mit der Achsel in
dem cylindrischen Kasten C sich dreht. In dem Bette t ist eine Schraubenspindel d drehbar gelagert, durch welche der Schlitten l, woran die Abkratzmesser k befestigt
werden, mittels einer Mutter o hin- und herbewegt wird.
Die Schneiden der Abkratzmesser k werden möglichst nahe
an die Fläche des Trockenapparates gebracht, so daſs sie bei Drehung des Rührwerkes
die harten Krusten vollständig beseitigen. Auſserhalb des Bettes t sitzt auf einer Verlängerung der Schraubenspindel d das sternförmige Rad b.
Dasselbe ist gegen Drehung auf der Spindel durch eine auf letzterer sitzende Feder
p, welche durch eine Nuth des Sternrades tritt,
gesichert, kann sich aber auf der Spindel hin- und herverschieben. Zu dieser
Verschiebung dient die Stoſsstange e, welche durch eine
schmiedeiserne Schelle c mit dem Sternrade b in Verbindung ist. Die Schelle legt sich in eine
ringförmige Nuth in der Nabe des Sternrades, so daſs letzteres in der Schelle sich
frei drehen kann. Ungefähr auf der Mitte der Stoſsstange e sitzt ein Finger h, welcher mittels des
zweiarmigen Hebels m hin- und hergeschoben werden kann,
indem der Finger h durch einen Schlitz im unteren Arme
m hindurchtritt. Der Hebel m ist um den Zapfen r drehbar, welcher in die
Hinterseite des Bettes t eingeschraubt ist- sein oberer
Arm trägt das Wurfgewicht n. Ferner ist die Stoſsstange
e nahe an ihrem einen Ende mit einem aufwärts
gerichteten Finger f und nahe an ihrem anderen Ende mit
einem nach abwärts gerichteten Finger g versehen. Die
Stifte i und z, welche auf
der hinteren Seite des Schlittens l festsitzen,
schlagen bei einer Verschiebung des Schlittens an f
bezieh. g an und verschieben dadurch die Stoſsstange
sammt dem Sternrade. Die Verschiebung des Schlittens wird in Folge Anschlagens der
Spitzen des Sternrades an einen der Arme a und v herbeigeführt, welche an dem Cylinder C befestigt sind. Dabei dreht sich das Sternrad und die
Schraubenspindel d, wodurch eine Verschiebung des
Schlittens längs seines Bettes t bewirkt wird. Beim
Hingange des Schlittens
schlägt der Stift z gegen den Finger g, beim Rückgange der Stift i gegen den Finger f der Stoſsstange. Dadurch
wird nun das Sternrad jedesmal so verschoben, daſs seine Spitzen bei der durch die
Achse A herbeigeführten Drehung des Bettes t einmal unten von dem Arme a, das andere Mal oben von dem gegenüber liegenden Arme v erfaſst werden, was natürlich dann ein abwechselndes
Rechts- und Linksumdrehen der Schraubenspindel d zur
Folge hat. Diese Umsteuerung geschieht also ganz selbstthätig. Beim Anschlagen der
Stifte i und z an die
Finger f und g überträgt
sich die Bewegung der Stoſsstange e zugleich auf den
mit dem Wurfgewichte n versehenen Umsteuerungshebel m, welcher zur Weiterführung der Verschiebung der
Stoſsstange sowie zur Sicherung ihrer Endstellungen dient. Bei der Drehung des
Rührwerkes werden in Folge dessen die beiden Messer k
mit ihrem Schlitten l beständig längs dem Bette t hin- und hergeschoben und bestreichen dadurch radial
langsam fortschreitend die ganze Bodenfläche des Trockenapparates in spiralförmigem
Wege.
Tafeln