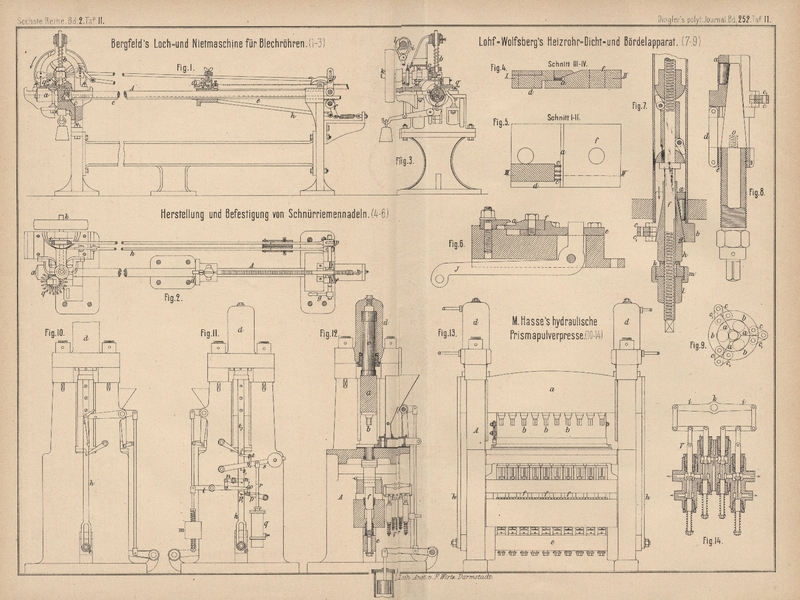| Titel: | G. Lohf und L. Wolfsberg's Heizrohr-Dichtapparat. |
| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 144 |
| Download: | XML |
G. Lohf und L. Wolfsberg's
Heizrohr-Dichtapparat.
Mit Abbildungen auf Tafel 11.
G. Lohf und L. Wolfsberg's Heizrohr-Dichtapparat.
Einen Heizrohr-Dichtapparat, dessen Druckwalzen radial in ihren Gehäusen verschiebbar
sind, wobei die Führung derselben durch Hebel bewirkt wird, ist G. Lohf bezieh. L. Wolfsberg in
Berlin (* D. R. P. Kl. 49 Nr. 23406
vom 1. September 1882) patentirt. (Vgl. Lohf's Apparat 1883 248 * 408.) Die Ausdehnung
in radialer Richtung wird bei der in Fig. 8 und
9 Taf. 11 dargestellten Construction durch Kuppelung der Walzen träger
a und b an einander
mittels Hebelpaare c, c1 bewirkt. Von den Walzenträgern a und b gehen die Gelenkhebel d
nach einem Ringe e, welcher als Zuspannmutter dient und
nun durch diese Vereinigung mit den Theilen a und b bewirkt, daſs die Walzen stets gleichförmig aus- oder
einwärts sich bewegen.
Will man auf den Zusammenhang aller Theile, so lange dieselben auſserhalb des Rohres
sind, verzichten, so erhält man durch einfaches Weglassen des Ringes e und der Verbindungsstangen d einen Dichtapparat zum Schlagen.
Eine eigenartige Anordnung des expandirenden Walzengehäuses ist in Fig. 7 Taf.
11 für den Fall gezeichnet, wenn die Röhren nicht nur gedichtet, sondern
gelegentlich auch gebördelt werden sollen (vgl. Lohf
1883 248 * 158). In diesem Falle muſs eine Spindel f im Rohre gegen Verschiebung festgeklammert werden, um
mittels derselben den Bördelapparat gegen das Rohrende anpressen zu können. Auf
diese Spindel f wird der conische Dorn g, welcher mit einer entsprechenden Ausbohrung versehen
ist und in das Sechskant h ausläuft, aufgeschoben. Auf
g wiederum paſst das Walzengehäuse ab, welches durch Vorwärtsbewegen von g aus einander getrieben wird und bei gleichzeitiger
Drehung um f, die durch einen auf h aufgesetzten Schlüssel erfolgt, die Dichtung bewirkt.
Das Nachtreiben des Dornes g geschieht durch die
Vorrichtung k, l, m; die Scheibe k ist mit einer in die Längsnuth von f passenden Feder und mit Gewinde versehen; die Mutter
m sitzt fest an dieser Scheibe und umschliefst
gleichzeitig den Vorsprung der auf f gehenden Mutter
l, läſst derselben aber freien Spielraum. Hierdurch
wird k, m beim Drehen von l in der Achsenrichtung mitgenommen.
Aus Fig. 8 ist noch ersichtlich, wie mittels des Zapfens o volle Kegel verschiedener Steigung bei einem und
demselben Dorne verwendet werden können.
Tafeln