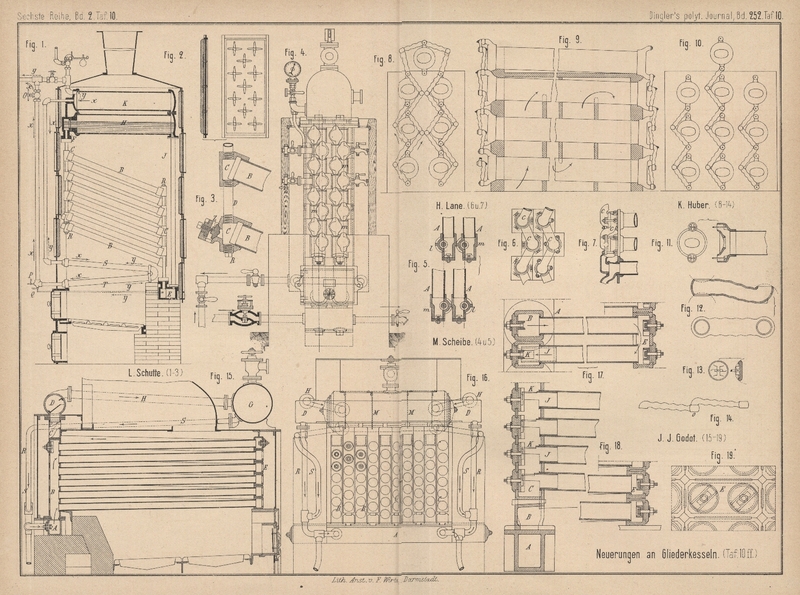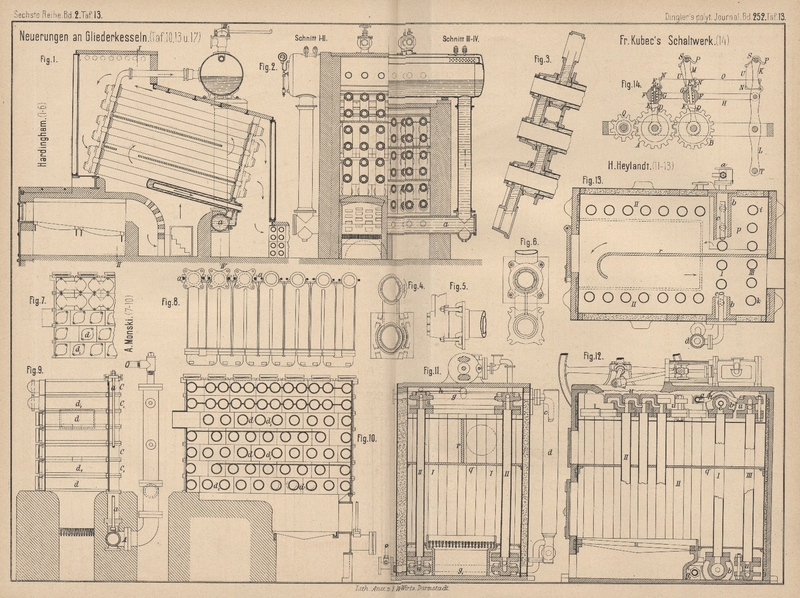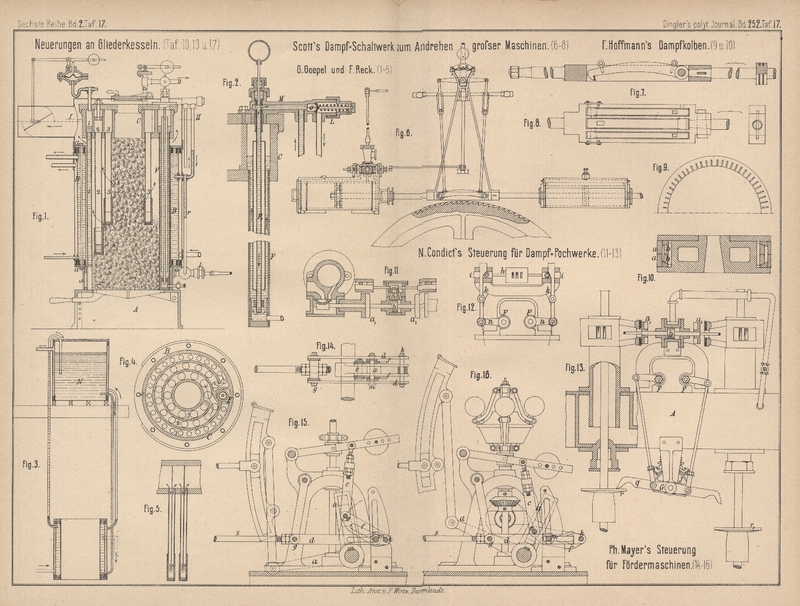| Titel: | Ueber Neuerungen an Gliederkesseln. |
| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 185 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Gliederkesseln.
(Schluſs des Berichtes von S. 137 d.
Bd.)
Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 10, 13 und 17.
Ueber Neuerungen an Gliederkesseln.
Der in Fig. 1 bis 6 Taf. 13
nach Engineering, 1884 Bd. 37 S. 30 abgebildete Kessel
von Hardingham bestellt aus Wasserröhren, durch welche
conachsiale Heizröhren hindurchgeführt sind (vgl. Hambruch 1875 216 * 394. Pond und Bradford 1880 238 * 189). Die Verbindung der mit den Enden in
quadratförmige Platten eingeschraubten Wasserröhren mit einander und die
Hindurchführung der inneren Röhren durch Stopfbüchsen ist aus Fig. 3 bis
6 ersichtlich. Zur Abdichtung dienen mit Kautschuk bekleidete
Asbestringe. Die rostförmigen Kesselelemente ruhen auch hier hinten unten auf einem
Wasservertheilungsrohre a, mit dem sie durch je ein
Kniestück verbunden sind, und stehen vorn oben mittels je eines durch eine
Stopfbüchse gehenden Rohres mit einem über der Decke liegenden Oberkessel in
Verbindung, welcher nach der Zeichnung etwa zur Hälfte noch mit Wasser gefüllt sein
soll. Zwei weite Vertikalrohre führen von demselben auſserhalb der Kesselmauern in
das Vertheilungsrohr a zurück. Ein sehr lebhafter
Wasserumlauf wird hiernach vorhanden sein. Das Dampfaufnahmerohr ist nur an den
beiden Enden siebartig durchlöchert; trotzdem wird der Dampf sehr naſs sein.
An der Feuerung ist beachtenswerth, daſs der Feuerraum
oben ganz gedeckt und hinten durch ein bis unter die Feuerbrücke hinabreichendes
durchlöchertes Gewölbe abgeschlossen ist, so daſs die Heizgase theils durch die
Oeffnungen, theils unter dem Gewölbe hindurchziehen müssen. Es werden hierbei die
Heizgase nicht so schnell abgekühlt, die Verbrennung wird mithin vollständiger und
rauchfreier sein, als sie in der Regel bei diesen Röhrenkesseln auftritt; auſserdem
werden auch die unteren Röhrenschichten mehr geschont. Das durchlöcherte Gewölbe
dagegen wird kaum sehr dauerhaft sein können. Die Heizgase steigen zunächst um
Ablenkplatten herum zwischen den Röhren hindurch aufwärts, fallen dann vorn abwärts,
durchziehen die inneren Heizrohren und gelangen hinten unten in den Fuchs, in
welchem noch ein Röhrenvorwärmer angebracht sein kann. Daſs hierbei ein starker Zug
erforderlich wird, ist einleuchtend und stellte sich auch bei einem mehrmonatlichen
Betriebe eines solchen Kessels heraus. Die inneren Röhren, welche eine Weite von
75mm hatten, sollen deshalb in Zukunft 100mm und die äuſseren Röhren 150mm Durchmesser erhalten. Bei diesen Maſsen wird
aber kaum eine gröſsere Heizfläche in einem gegebenen Räume erzielt werden können
als mit den gewöhnlichen einfachen Röhren und, da diese Einrichtung doch recht
erhebliche Uebelstände aufweist, wie die unbequeme Reinigung der Röhren, die der
Einwirkung der Heizgase ausgesetzten Stopfbüchsen u.s.w., so erscheint sie nicht empfehlenswerth.
A.
Monski in Eilenburg (* D. R. P. Nr. 22819 vom 2. September 1882 und * Nr. 24860 vom 17.
April 1883) will guſseiserne Dampferzeuger
nach Art der Körting'schen Heiz- bezieh. Kühlkörper
herstellen. In Fig. 7 bis
10 Taf. 13 ist eine derartige Construction (* D. R. P. Nr. 24860)
abgebildet. Auf einem horizontalen Rohre A stehen eine
Anzahl vertikaler Röhren, jede aus kurzen, auf einander stehenden Cylindern C und C1 zusammengesetzt, welche durch Schraubenbolzen a zusammengepreſst werden. An diese Cylinder sind
seitlich abwechselnd einfache und gabelförmige, an den Enden durch aufgeschraubte
Platten geschlossene Rohre d und d1 angegossen. Die
oberen zur Dampftrocknung dienenden Rohre sind zu einer Schlangenröhre mit einander
verbunden. Ueber den Vertikalröhren soll, wie anzunehmen ist, ein gemeinschaftlicher
Dampfsammler aufgestellt werden, an welchen sich oben das gezeichnete, unten mit A verbundene Wasserstandsrohr anschlieſst. Ein
derartiger Dampferzeuger wird billig herzustellen sein, dürfte aber wegen der dicken
Wandung der Rohre, des Mangels jeder Strömung u.s.w. für einen vortheilhaften
gleichmäſsigen Betrieb wenig geeignet sein.
Der in Fig. 11 bis 13 Taf. 13
dargestellte Dampferzeuger von H. Heylandt in
Leipzig (* D. R. P. Nr. 23232 vom 28.
December 1882) besteht aus 3 Gruppen vertikaler Röhren. Gruppe I wird durch eine
hinter dem Roste aufgestellte Reihe oben und unten durch Querrohre b verbundener Röhren gebildet und dient als Vorwärmer.
Das Wasser wird in das untere Rohr b, welches als
Schlammsammler dienen soll, bei a eingeführt, steigt in
den Röhren I auf und gelangt oben in ein durchlöchertes
Rohr c, welches zur Verhinderung des Mitreiſsens der
Niederschläge in das obere Querrohr, b eingelegt ist.
Durch c flieſst das Wasser in ein auſserhalb der Kessel
wand aufgestelltes weites Rohr d (Fig. 11),
welches in derselben Weise wie ein entsprechender Körper bei dem Belleville'schen Kessel (vgl. 1879 231 * 485) zur Regelung der Speisung dienen soll. In
demselben ist nämlich ein Schwimmer untergebracht, welcher bei einem gewissen
höchsten Wasserstande ein Rücklaufventil öffnet, worauf das von der ununterbrochen
arbeitenden Pumpe gelieferte Wasser nicht in den Vorwärmer I gelangt, sondern in den Vorrathsbehälter zurückflieſst.
Aus d gelangt das Wasser unten in die Röhrengruppe II, welche, zu beiden Seiten des Rostes aufgestellt,
den Verdampfer bildet. Sämmtliche Röhren einer Seite sind oben und unten durch
Kappen u, welche mit den in Fig. 6 und
7 Taf. 10 gezeichneten von Lane Aehnlichkeit
haben, verbunden und beide Seiten stehen oben durch eine Röhre g, unten durch eine Röhre g1 in Verbindung. Das unten sich in die
Röhren II vertheilende Wasser steigt in diesen auf, der
entwickelte Dampf sammelt sich oben und gelangt von der Mitte der Röhre g aus durch das über I hinweg
geführte Rohr h in die hintere, als Dampftrockner
dienende Abtheilung III, bei welcher die Röhren zu
einem Schlangenrohre vereinigt sind. Der in das erste Rohr i oben eintretende Dampf durchströmt dieselben, abwechselnd auf- und
absteigend, der Reihe nach und wird endlich aus dem letzten Rohre k abgeführt. Der ganze Feuerraum ist durch eine
horizontale Platte q in zwei Kammern und die obere
nochmals durch eine vertikale Längswand r getheilt. Die
Oeffnung p in der Platte q, durch welche die Heizgase in die obere Kammer treten, und der von den Gasen
verfolgte Weg sind in Fig. 13
Taf. 13 zu erkennen. Es fehlt auch hier der Wasserumlauf. Die Niederschläge werden
sich hauptsächlich in den unteren Verbindungskanälen der Röhren II ansammeln und dieselben leicht verstopfen.
Die Dampfmaschine, wie in Fig. 12
Taf. 13 gezeichnet, oben auf den Kessel aufzustellen, ist wohl nicht zweckmäſsig.
Die ganze Anlage läſst überhaupt in der constructiven Ausführung zu wünschen
übrig.
Endlich möge noch ein in Fig. 1 bis
5 Taf. 17 veranschaulichter Dampferzeuger von G.
Goepel und F. Reck in Schweinfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 11900 vom 20. Mai
1880) angeführt werden, welcher zwar nicht aus einzelnen gleichen
„Gliedern“ zusammengebaut ist, also auch nicht beliebig vergröſsert
werden kann, der aber ein Hauptmerkmal der Gliederkessel, kleinen Wasser- und
Dampfraum, im hohen Grade besitzt. Bei der Construction desselben wurde das Ziel
verfolgt, die nöthige Bedienung auf das geringste Maſs zurückzuführen, um den
Dampferzeuger für den Kleinbetrieb recht geeignet zu
machen. Der Verdampfer besteht aus drei concentrischen Reihen von Röhren 1, 2 und 3, welche in
einem starken, oben durch einen aufgeschraubten Deckel geschlossenen Guſseisenkörper
C befestigt sind und in einen Füllschacht
hineinreichen. Die Wand des letzteren wird durch ein zwei concentrische Kammern
enthaltendes, als Vorwärmer dienendes Blechgefäſs B
gebildet. Die innere gröſsere Kammer nimmt das Wasser aus einem höher gelegenen
Behälter N (Fig. 3) auf,
die äuſsere den Abdampf der Maschine, dessen Wärme auf diese Weise ausgenutzt werden
soll. Das Gefäſs B ist oben und unten durch Ringe a, welche sich auf angenietete Ringe auflegen und gegen
einander verschraubt sind, dicht abgeschlossen., Der in demselben entwickelte Dampf
wird in das Wasser des oberen offenen Behälters N
geleitet, während dafür das Wasser aus diesem nachflieſst. Auf diese Weise soll das
Wasser in B beständig im Kochen gehalten werden, wobei
die Spannung ein wenig über dem Atmosphärendrucke liegt. Hier wird also auch ein
groſser Theil des Kesselsteines ausgeschieden werden. Aus B gelangt das Wasser durch Rohr r (Fig.
1) zur ununterbrochen arbeitenden Speisepumpe L und von dieser durch den Guſskörper M (Fig.
2) in den Speiseregulator. Letzterer besteht aus einem weiten Rohre F, welches oben in eine besondere Kammer des Körpers
C mündet, und einem darin beweglichen Speiseröhre
F1, auf dem ein langer kupferner
Schwimmer und am oberen Ende ein Ringschieber aus Bronze befestigt ist. Mit diesem
ist mittels einer dünnen., durch eine Stopfbüchse gehenden Spindel eine Hohlkugel
verbunden, um durch Füllen derselben mit Blei o. dgl. den Schwimmer beliebig
beschweren zu können. Bei der gezeichneten tiefsten Stellung des Schwimmers kann das
Wasser aus M ungehindert in F1 eintreten, um dann in F auſserhalb des Schwimmers aufzusteigen. Schlieſst der
Schieber bei steigendem Schwimmer ab, so öffnet das Wasser das belastete Ventil o und flieſst zur Pumpe zurück. Aus der Kammer des
Rohres F flieſst das Wasser über eine Querwand in den
äuſseren Ringraum von C ein (vgl. Fig. 4), die
Röhren 1 nach und nach füllend, dann in die zweite
Ringkammer und die Röhren 2 und endlich in die innerste
Kammer mit den kürzesten Röhren 3. Es soll nun die
Anordnung derart sein, daſs die Röhren 3 und die letzte
Hälfte der Röhren 2 nur noch Dampf enthalten, so daſs
dieser gut getrocknet und überhitzt wird. Damit der Dampf gezwungen werde, die
Röhren zu durchströmen, sind in die betreffenden Röhren Scheidewände eingesetzt
(vgl. Fig. 5 Taf. 17). Aus der letzten Röhre des inneren Kreises gelangt der
Dampf direkt zur Maschine. Der Guſskörper C ist von
einer sich an B anschlieſsenden Blechhaube umgeben, aus
welcher die Heizgase bei A abgeführt werden. Zur
Regelung der Verbrennung bezieh. der Dampfspannung ist mit der Rauchklappe ein
Regulator von bekannter Einrichtung verbunden.
Die Ausführung dieses Dampferzeugers sammt Maschine hat die Fabrik von Klotz, Günther und Kops in Merseburg übernommen und
zwar wird er für Leistungen von 0e,5 an
hergestellt. Für 1e erhält der Kessel 2qm Heizfläche und einen Wasserinhalt von 30l. Die Röhren, namentlich die inneren nur Dampf
enthaltenden, werden bei dieser Einrichtung schnell zerstört werden, wenngleich die
unteren Enden durch guſseiserne Mäntel geschützt sind. Uebrigens mag der Kessel,
wenn gut ausgeführt und gut in Stand gehalten, namentlich für häufige Reinigung der
Röhren, des Speiseregulators u.s.w. gesorgt wird, in manchen Fällen brauchbar sein;
leider ist bekanntlich im Kleingewerbe auf eine gute
Instandhaltung selten zu rechnen.