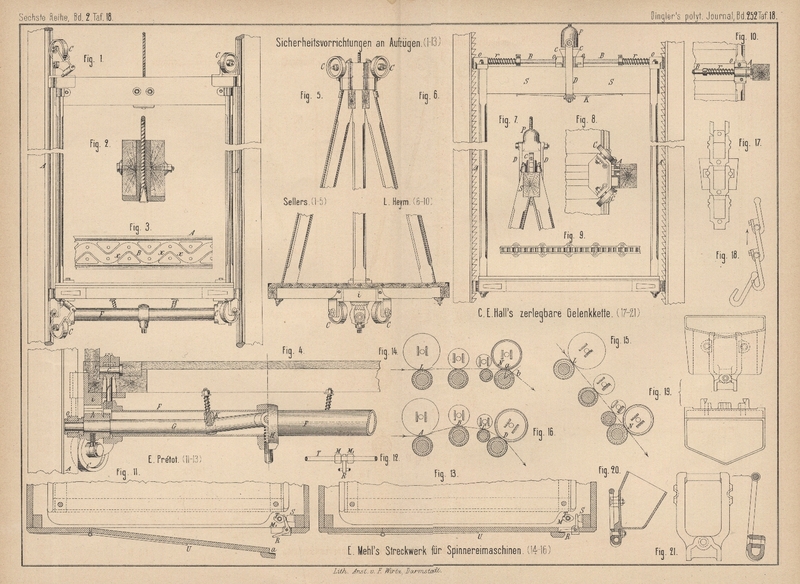| Titel: | Sicherheitsvorrichtungen an Aufzügen. |
| Autor: | G. R. |
| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 228 |
| Download: | XML |
Sicherheitsvorrichtungen an Aufzügen.
Mit Abbildungen auf Tafel 18.
Sicherheitsvorrichtungen an Aufzügen.
Die nachfolgenden drei dem Bulletin de Mulhouse, 1884 S.
26 und 42 entnommenen Sicherheitsvorrichtungen für Aufzüge betreffen zwei
Fangvorrichtungen und einen Sicherheits-Thürverschluſs.
Bei der Fangvorrichtung, System Sellers (Fig. 1 bis
5 Taf. 18), wird nach Ueberschreitung einer bestimmten
Niedergangsgeschwindigkeit die Bewegung eines pendelnden, mit dem Fahrstuhle
verbundenen Körpers verhindert und hierdurch der Fahrstuhl selbst gefangen. Der
letztere ist mit 8 schräg stehenden Rollen C an den
entsprechend schräg gehobelten Seitenflächen der Schienen A
geführt, welche mit einer schlangenförmig laufenden Spur B versehen sind (vgl. Fig. 3).
Unterhalb des Fahrstuhlbodens hängt an den Bolzen c
(Fig. 4) mit den kurzen Gelenkstangen f ein
Rohr F, in welchem sich der Doppelhebel G befindet, der an seinen Enden die Zahnbogen h und die kleinen, mit Kautschuk belegten Messingrollen
o trägt; letztere greifen in die schlangenförmige
Spur B der Schienen A ein.
Bei normaler Geschwindigkeit des Fahrstuhles schwingt nun vermöge dieser Anordnung
das Rohr F hin und her. Sobald aber die
Fallgeschwindigkeit das zulässige Maſs durch irgend einen Umstand überschreitet,
können die Rollen o in der Spur B dieser Bewegung nicht mehr folgen; sie stoſsen sich an den geraden
Seiten x derselben und es wird dadurch der Doppelhebel
G um die festen Knaggen K gedreht, indem die in der Mitte befindliche Feder H zusammengedrückt wird, bis die Zähne des Zahnbogens
h in die am Fahrstuhle feste Verzahnung i eingreifen. Die Schwingung von F ist dann vollständig gehindert und der Fahrstuhl
festgehalten. Die Vorrichtung wirkt schon bei 0m,08 secundlicher Fallgeschwindigkeit.
Durch langsames Anziehen des Fahrstuhles nach oben wird derselbe wieder frei. Fig.
2 zeigt die Befestigung des Seiles in dem oberen Querbalken des
Fahrstuhles.
Die von Lothar Heym in Leipzig zur Ausführung gebrachte,
in Fig. 6 bis 10 Taf. 18
dargestellte Fangvorrichtung mit Klinken-Zahnstangen
ist nur für leichtere Fahrstühle zu gebrauchen. Der
Fahrstuhl wird an den beiden Zahnstangen A durch
Gleitbacken o geführt. In den letzteren und den Backen
o1 führen sich auch
die vorn zugespitzten Stangen B, welche durch die
Federn r immer nach innen zur Anlage an die Keile c gedrückt werden. Das Tragseil des Stuhles ist an dem
Gewichte P befestigt, welches mit dem den oberen
Querbalken S umgreifenden Bügel D verbunden ist. Unterhalb des Balkens S
liegt zwischen dem Bügel D die Blattfeder K. Bei etwa eintretendem Seilbruche kann nun diese
Feder K den Bügel D nach
unten ziehen und dadurch schlägt das Gewicht P auf die
Keile o1 und treibt die
Stangen B nach auſsen, daſs dieselben in die
Zahnstangen A treten und den Fahrstuhl festhalten.
Bei dem in Fig. 11 bis
13 Taf. 18 veranschaulichten Sicherheitsthürverschlusse für Aufzüge der Firma Schlumberger Sohn und Comp. in Mülhausen nach Angaben ihres Ingenieurs E. Prétot kann der Betrieb des Aufzuges nur
stattfinden, wenn die Ladeöffnungen des Fahrschachtes durch ihre Thüren oder
Schutzgitter verschlossen sind. Die aus Schmiedeisenrohr bestehende Ausrückstange
T trägt für jede Ladeöffnung zwei Stellringe M und M1 (Fig. 12),
zwischen welche, wenn sich die Stange T in der Stellung
für den Stillstand des Fahrstuhles befindet, der eine Arm des Winkelhebels R, durch die hinter ihm befindliche Blattfeder S vorgedrückt, treten kann. Es ist dies jedoch nur
möglich, wenn der andere Arm des Winkelhebels R,
welcher sich gegen die Leiste a der Verschluſsthür
U legt, frei, wenn also die Thür geöffnet ist. Es wird
demnach die Ausrückstange T nicht verschoben und der
Fahrstuhl in Gang gesetzt werden können, wenn nicht vorher durch Schluſs der Thür
U und Verriegelung derselben der Winkelhebel R aus dem Zwischenräume der Stellringe M und M1 gebracht worden ist. Die Fig. 11
zeigt die Stellung bei nicht geschlossener und verriegelter Thür, Fig. 13 bei
geschlossener Thür U.
G. R.
Tafeln