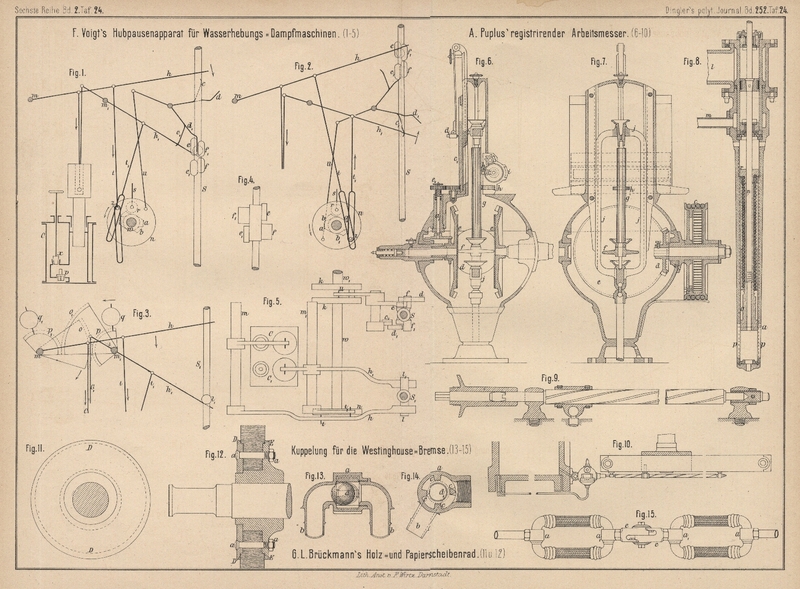| Titel: | A. Puplus' registrirender Arbeitsmesser. |
| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 309 |
| Download: | XML |
A. Puplus' registrirender
Arbeitsmesser.
Mit Abbildungen auf Tafel 24.
A. Puplus' registrirender Arbeitsmesser.
Gleichwie der früher besprochene integrirende Arbeitsmesser von Boys (1884 251 * 202) soll
auch der in Fig. 6 bis
9 Taf. 24 nach der Revue industrielle, 1884
S. 78 dargestellte Apparat von A. Puplus dazu dienen,
die von dem Kolben einer Dampfmaschine in einer gewissen Zeit aufgenommene Arbeit zu
messen. Auch hier wird ein Doppelindicator benutzt und die geleistete Arbeit, in
einer bestimmten Einheit gemessen, durch ein Zählwerk fortdauernd registrirt; die
Einrichtung ist aber eine ganz andere. (Vgl. Ashton und
Storey 1869 194 * 16.)
Die Kolbenstange des in Fig. 8
besonders dargestellten Indicators trägt an ihrem oberen Ende einen in Schienen
geführten Rahmen j (Fig. 7), in
welchem zwischen zwei Stahlspitzen ein Reibungsrädchen f gelagert ist. Dasselbe steht in Berührung mit zwei parallelen Scheiben
e (Fig. 6),
welche von der Maschine aus eine entgegengesetzt gleiche, dem Hin- und Hergange des
Maschinenkolbens entsprechende Schwingung erhalten. Wenn die Pressung auf beiden
Seiten des letzteren gleich ist, der Indicatorkolben also seine Mittelstellung
einnimmt, berührt das Rädchen f die Scheiben e genau in deren Mittelpunkt, wird also von deren
Schwingung nicht beeinfluſst. Ist aber der Indicatorkolben durch den Ueberdruck auf
der einen Cylinderseite gehoben, also auch das an seiner Bewegung stets
theilnehmende Rädchen f, so erhält dasselbe eine
Drehung, welche 1) proportional seinem Abstande von der Mitte der Scheiben e, d.h. proportional dem wirksamen Kolbendrucke und 2)
proportional dem Drehwinkel der Scheiben e, d.h.
proportional dem in Betracht gezogenen Kolbenwege ist. Die Drehung des Rädchens f gibt also ein Maſs ab für die auf den Kolben
übertragene Arbeit und zwar wird die in auf einander folgenden Kolbenhüben
aufgenommene Arbeit einfach addirt; denn steht das Rädchen f beim Kolbenhingange oberhalb der Mitte von e, so steht es beim Kolbenrückgange unterhalb derselben, und da sich beim
Rückgange die Scheiben e entgegengesetzt wie beim
Hingange drehen, so dreht sich das Rädchen f immer im
gleichen Sinne. Nur während der Compression wird, wie es auch sein muſs, eine
Rückdrehung bewirkt. Von der ein langes Getriebe bildenden Spindel g des Rädchens f wird die
Bewegung mit starker Uebersetzung ins Langsame auf ein Zählwerk übertragen.
Der Indicator hat folgende besondere Einrichtung (Fig.
8). Der Cylinder desselben ist mit einem aus zwei Theilen
zusammengeschraubten, eine obere und eine untere Kammer bildenden Mantel versehen.
Die obere Kammer wird durch l mit dem einen, die untere
durch m mit dem anderen Ende des Dampfcylinders in
Verbindung gesetzt und beide Kammern stehen mit dem Inneren des Indicatorcylinders
an seinen äuſsersten
Enden in Beziehung. Die Belastungsfeder ist so angeordnet, daſs sie bei der
Verschiebung des Kolbens aus der Mitte nach oben oder unten stets ausgedehnt wird. Zu dem Zwecke ist ihr oberes Ende an
einem Ringe r und ihr unteres Ende an einer Hülse o befestigt, welche beiden Theile so gegen einander
eingestellt werden, daſs, wenn die Feder nicht gespannt ist, der Ring r auf einen Vorsprung des Federgehäuses sich aufsetzt
und gleichzeitig ein durch o gehender Stift a oben in seinen Führungsschlitzen p anliegt. Auf die Stange des Indicatorkolbens ist eine
Hülse n von solcher Länge aufgeschraubt, daſs sie die
Theile r und o eben
berührt, wenn der Kolben auf beiden Seiten gleich belastet ist. Beim Aufgange des
Indicatorkolbens von der Mitte aus drängt die Hülse n
den Ring r nach oben, während o unten festgehalten ist, und beim Niedergange wird o nach unten gestoſsen, während r gehalten ist; in beiden Fällen wird daher die Feder ausgezogen. Sollte
die Feder nach längerer Benutzung etwas erschlafft sein, so kann man durch Drehung
der Hülse o leicht den vorhandenen Spielraum
beseitigen, o und r sind
nämlich mit einem passenden Gewinde versehen, auf welches die Enden der Feder
aufgeschraubt sind, auf dem sie durch übergeschraubte Muffe gehalten werden. Der
untere Muff ist sehr lang ausgeführt, um den wirksamen Theil der Feder innerhalb
ziemlich weiter Grenzen verändern zu können. Man ist dadurch in den Stand gesetzt,
den einer bestimmten Spannung entsprechenden Kolbenweg passend einzustellen und
dieselbe Feder für niedere und höhere Spannungen benutzen zu können. Die Muffe sind
am Umfange und das Federgehäuse ist an der Innenwand gerieft, so daſs eine
selbstthätige Verstellung ausgeschlossen ist. Die Kolbenstange ist mit dem Rahmen
j durch ein Doppelkugelgelenk – eine kurze
Gelenkstange mit zwei Kugelköpfen – verbunden, so daſs hier jede Zwängung
ausgeschlossen ist.
Die Scheiben e haben selbstverständlich eine genaue
Lagerung in langen Büchsen und werden durch schwache Federn von gleicher Spannung
gegen das Rädchen f gepreſst. Die Scheiben sind mit je
einer Verzahnung versehen, welche beide mit einem gemeinschaftlichen Kegelrade d (Fig. 6 und
7) in Eingriff stehen; dem letzteren kann die schwingende Bewegung
entweder mittels einer Schnur und Federtrommel c in der
bei gewöhnlichen Indicatoren üblichen Weise, oder auch mit Hilfe einer mit steilen
Schraubengängen versehenen Spindel (Fig. 9 und
10) mitgetheilt werden, wobei dann die zugehörige, aus zwei Theilen
bestehende Mutter direkt mit dem Kreuzkopfe der Maschine verbunden werden kann,
welche Anordnung aus Fig. 10 zu
ersehen ist. Durch die Anwendung von zwei Scheiben e wird der einseitige Druck auf das Rädchen f, welcher die Reibung seiner Spindelzapfen vergröſsern
würde, vermieden.
Um die Drehung des Rädchens f auf das Zählwerk zu
übertragen, steht das lange Getriebe g mit einem
Zahnrade h (Fig. 6) in
Eingriff, von dessen Welle durch ein Schraubengetriebe mit 60 bis 70facher Uebersetzung das
Einerrad des Zählwerkes i seine Bewegung erhält. Dieses
Zählwerk zeigt nach dem Gesagten die sogen, indicirte Arbeit in einer aus den
Abmessungen des Apparates zu berechnenden oder besser empirisch zu bestimmenden
Einheit (z.B. 1000 oder 10000mk) an. Durch
Division mit der Zeit läſst sich hieraus leicht die durchschnittliche Arbeit für 1
Secunde ableiten und in Pferdestärken ausdrücken.
Neben diesem Zählwerke ist noch ein zweiter die Umläufe der Maschine zählender
Mechanismus angebracht, welcher wie gewöhnlich durch ein Schaltwerk angetrieben
wird. Der Schalthebel ward durch eine an dem Rahmen j
angebrachte Nase h1
bewegt. Da hierdurch die Bewegung von f merklich
beeinfluſst werden kann., so wird es zu empfehlen sein, dieses Zählwerk von dem
Apparate zu trennen und wie sonst gebräuchlich an die Maschine anzuhängen.
Mit dem Apparate ist ferner noch eine Vorrichtung zur Entnahme von Diagrammen
verbunden, bestehend aus einer Tafel c1 (Fig. 6),
welcher von der einen Scheibe e aus durch Reibungsräder
und Zahnstangengetriebe eine hin- und hergehende, mit dem Laufe des Dampfkolbens
übereinstimmende Bewegung gegeben werden kann, und einem mit dem Rahmen j auf- und abgehenden Schreibstifte d1. Die beiden
Reibungsrädchen werden für gewöhnlich durch eine Feder auſser Berührung gehalten,
können aber durch einen leichten Druck auf den Knopf e1 sofort in Eingriff gebracht werden.
Ebenso kann der Schreibstift mit seinem Schlitten leicht an den Rahmen j angehängt und wieder ausgerückt werden. An Stelle der
Tafel kann man auch die gewöhnliche Trommel benutzen, welche dann direkt auf der
Welle a1 zu befestigen
ist.
Der Apparat kann auſser für Dampfmaschinen selbstverständlich auch für andere Motoren
mit hin- und hergehendem Kolben, sowie für Pumpen, Gebläse u.s.w. benutzt werden.
Für schnellgehende Maschinen wird derselbe jedoch nicht zu verwenden sein, da bei
diesen das Beharrungsvermögen der verhältniſsmäſsig groſsen auf- und abschwingenden
Massen das Resultat sehr fehlerhaft machen würde. Im Uebrigen hängt die Genauigkeit
hauptsächlich von der guten Ausführung und Einstellung ab; namentlich muſs todter
Gang in den Getrieben sorgfältig vermieden werden.
Tafeln