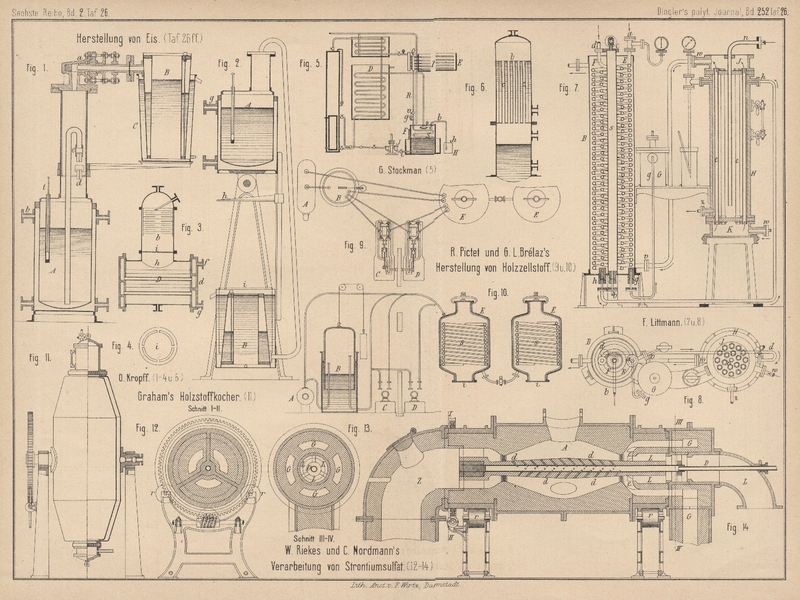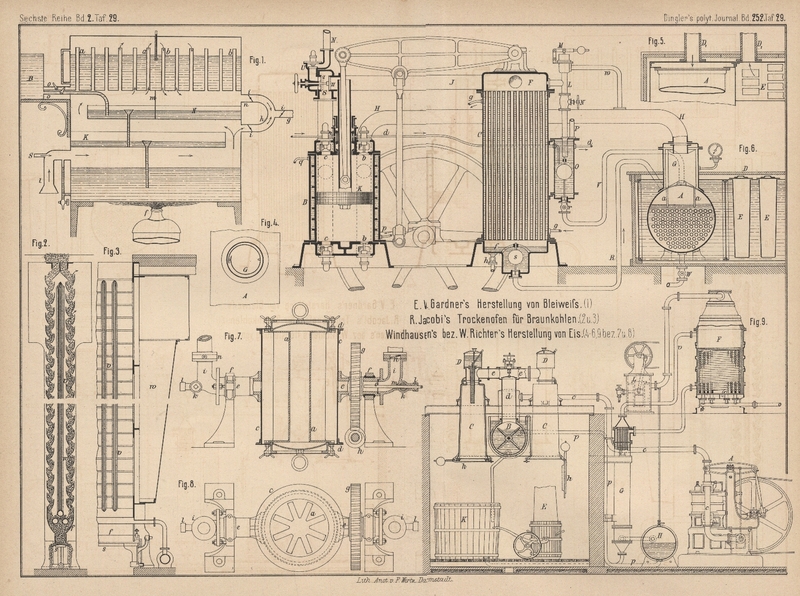| Titel: | Ueber die Herstellung von Eis. |
| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 328 |
| Download: | XML |
Ueber die Herstellung von Eis.
Patentklasse 17. Mit Abbildungen auf Tafel 26 und 29.
Ueber die Herstellung von Eis.
Der in diesem Jahre allgemeine Eismangel regt aufs Neue die Frage an, ob es nicht
vortheilhafter ist, statt Eis aus Norwegen u.a. einzuführen, dasselbe mit Maschinen
herzustellen. Im Anschlusse an die früheren Besprechungen (vgl. F. Fischer 1877 224 * 165)
mögen daher die neueren diesbezüglichen Vorschläge besprochen werden.
O. Kropff
jr. in Nordhausen (* D. R. P. Nr. 11732 und 13853 vom 26. Februar bezieh. 24. November
1880) hat bei den kleinen Carré'schen Ammoniak-Eismaschinen für Haushaltungen, Schiffe u.
dgl. den mit Dampfmantel umgebenen Ammoniakkessel A (Fig. 1 Taf.
26) mit dem drehbaren Eisbildner B durch Hahn a verbunden. Werden durch den Stutzen b am Dampfmantel gespannte Dämpfe eingelassen, so
entweicht Ammoniak durch das Ventil d und sammelt sich
als Flüssigkeit im Eisbildner B an, welcher in einem
mit frischem Wasser gefüllten Gefäſse C hängt. Wird,
wenn das eingehängte Thermometer t 115° zeigt, statt
Dampf Wasser eingeleitet, so verschwindet der Druck, die wasserfreie Ammoniakflüssigkeit in B verdunstet und erzeugt frische Kälte. Die frei
gewordenen Gase gehen durch Ventil e in das gekrümmte
Rohr, welches bis zum Boden des Kessels führt, und vereinigen sich hier wieder mit
der Flüssigkeit. Hierbei wird das warme Wasser in C
abgelassen und durch frisches ersetzt, welches dann friert. Soll das Eis zum Thauen
gebracht werden, so dreht man den Eisbildner nach oben, läſst durch Stutzen b etwas Dampf einströmen, so daſs die warmen
Ammoniakgase nach B gelangen und das Eis in Form eines
Hohlcylinders und eines massiven Cylinders von der Gefäſswandung lösen, worauf die
Maschine zu erneuter Thätigkeit sofort wieder verwendet werden kann.
Bei der ganz ohne Ventile hergestellten Maschine Fig. 2 ruht
der Ammoniakkessel A auf einer drehbaren, in zwei
Böcken gelagerten Achse und ist durch ein Rohr mit dem Eisbildner B verbunden. Durch Stutzen g strömt der Dampf ein, in Folge dessen die Gase entweichen und sich durch
die Wasserkühlung in B verdichten. Ist letzteres
vollständig geschehen, so wird die Maschine herumgedreht, so daſs der Eisbildner
oben und der Kessel unten zu stehen kommt. Wird der Kessel A nun mit Wasser gekühlt, so verschwindet der Druck, die Gase verdunsten
und erzeugen in B Kälte. An der Strebe, welche den
Eisbildner B mit A
verbindet, ist eine Stütze h angebracht, welche zur
Aufnahme des Wasserbehälters i dient. Man schiebt die
Stütze h mit dem zum Theile gefüllten Wasserbehälter
i hoch, so daſs der Eisbildner B darin hängt, wie die punktirten Linien in Fig.
2 andeuten. Das in B verdunstende Ammoniak
läſst das Wasser in i gefrieren und geht durch das
Verbindungsrohr nach dem Kessel zurück, wo es sich mit dem zurückgebliebenen Wasser
wieder vereinigt. Die in dem Eisbildner B noch
vorhandene unverdunstete Ammoniakflüssigkeit kann leicht durch Drehen der Maschine
in den Kessel zurückgeführt werden; ebenso leicht kann man die warme
Ammoniakflüssigkeit des Kessels in den Eisbildner leiten, um damit das Eis zu lösen.
(Vgl. Ferd. Fischer: Chemische Technologie des Wassers,
* S. 37.)
Man kann auch zwei oder mehrere Ammoniakkessel verwenden, welche ihre Gase
abwechselnd in einem gemeinschaftlichen Condensator verdichten, in einem
gemeinschaftlichen Kälteerzeuger verdunsten und in ihren Kesseln wieder zur
Absorption bringen, oder daſs man andererseits unter Beibehaltung von zwei oder
mehreren Ammoniakkesseln, die aber ihre Gase in besonderen Condensatoren verdichten,
diese Gase in einem gemeinschaftlichen Kälteerzeuger verdunsten und in den Kesseln
wieder zur Absorption bringen läſst.
Nach einem anderen Vorschlage Kropff's (* D. R. P. Nr.
12101 vom 26. August 1879) besteht bei groſsen Maschinen der Condensator aus einer
Anzahl Röhrenbündel. Die Siederöhren des liegenden Ammoniakkessels D (Fig. 3 Taf.
26) werden so angeordnet, daſs der durch den Verschluſsdeckel d bei f eintretende Dampf zuerst die oberste Reihe Röhren,
dann die zweite u.s.w. trifft, bis er als Wasser bei g
austritt. Zwischen dem Dome b und Kesselstutzen h ist eine ringförmig durchbrochene Scheibe i (Fig. 4)
eingeschoben, um den vom Kessel aufsteigenden Schaum zurückzuhalten.
Nach ferneren Vorschlägen (* D. R. P. Nr. 16338 und 16476 vom 8. Mai bezieh. 16. Juli
1881) werden in dem Dome b (Fig. 6) des
Ammoniakkessels aufrechtstehende, von Ammoniakflüssigkeit umspülte, offene Röhren
c angewendet, durch welche die Ammoniakgase strömen
und an deren inneren Wänden Ammoniakwasser den Gasen entgegen herabflieſst (vgl.
1877 224 * 169).
F.
Littmann in Halle a. S. (* D. R. P. Nr. 7749 vom 25. Februar 1879) vereinigt den
Condensator, den Temperaturwechselcylinder und das Kühlgefäſs in einem einzigen
Cylinder B (Fig. 7 und
8 Taf. 26). Derselbe enthält das Schlangenrohr E, in welches das Ammoniakgas aus dem Kessel bei a eintritt und durch Rohr g zum Gasgefäſse
G geht. In das Schlangenrohr F tritt die an Ammoniak arme Flüssigkeit vom Kessel aus
bei d ein und geht abgekühlt durch Rohr h nach der Einsaugungsvase H. Dadurch nun, daſs das heiſse Ammoniakgas und die heiſse an Ammoniak
arme Flüssigkeit oben in die beiden Schlangen E und F einströmend nach unten gehen, während kaltes Wasser
unten bei v eintretend nach oben steigt, wird dieses
Kühlwasser erwärmt, das Ammoniakgas und die arme Flüssigkeit werden gekühlt und
kommen beide unten bei g und h ganz abgekühlt aus den Schlangen heraus. Das ursprüngliche Kühlwasser
aber, welches um so heiſser wird, je höher es steigt, erwärmt den Cylinder s mit der darin befindlichen an Ammoniak reichen
Flüssigkeit, so daſs diese unten bei b kalt eintritt,
oben bei c ganz Keife nach dem Ammoniakkessel übergeht.
Die durch Stutzen w mit der Kühlwasserleitung
verbundenen niederen Cylinder K und J dienen zu Wasserkammern, während in dem mittleren,
mit Kühlröhren e versehenen Räume H die Absorption des durch Rohr n vom Eisbildner kommenden Ammoniakgases vor sich geht. Die gebildete
Ammoniaklösung wird bei z abgesaugt und nach dem Kessel
gedrückt.
Th. L.
Rankin in New-York (* D. R. P. Nr. 15559 vom 26. April 1881) beschreibt einen Ammoniak-Destillirapparat für Eismaschinen, welcher
jedoch weniger zweckentsprechend zu sein scheint, als der von Kropff (Fig. 6)
empfohlene.
G. W.
Stockman in Indianopolis, Indiana (*
D. R. P. Nr. 17267 vom 16. Juni 1881) will eine
beständige Bewegung des Ammoniaks dadurch herstellen, daſs die verdünnte
Ammoniakflüssigkeit als Absorbirungsmittel verwendet wird, nachdem ihre Temperatur
durch die Anwendung eines Kühlers D (Fig. 5 Taf.
26) für verdünnte Flüssigkeit und durch den theilweise aus einem Refrigerator E abgehenden Dampf erniedrigt worden ist. Die verdünnte
Ammoniakflüssigkeit tritt in den Absorbirungsapparat
F durch ein Verstäubungsmundstück e. Nachdem das Gas in dem Refrigerator E seine Wirkung erfüllt hat, läſst man es aus den
Schlangen P in den Aufsammler Q entweichen- aus diesem wird das Gas durch das Rohr R, welches mit Ventil v
und Manometer g versehen ist, nach der
Absorbirungsschlange S geleitet und in den
Absorbirungsapparat in der Nähe des Saugrohres i der
Pumpe J eingelassen. Das mit einem Hahne versehene
Läuterrohr b führt von einem oberen Theile des
Absorbirungsapparates F nach dem Kasten H, in dessen Kopfplatte der Ablaſshahn h zum Zwecke der Beseitigung der atmosphärischen Luft
aus dem ganzen Apparate angebracht ist.
Nach C. M. Tessié du Motay in Paris und A. J.
Rossi in New-York (* D. R. P. Nr. 11036 vom 8. Februar 1880) werden zwei
leichtflüchtige Flüssigkeiten, von denen die eine in der anderen löslich ist, unter
Anwendung des Vacuums zu rascher Verdunstung gebracht. Dies geschieht in
Eismaschinen gewöhnlicher Construction mit Saug- und Druckpumpen. Bei der
Condensation der Dämpfe durch Druck wird wiederum die Lösung gebildet. Vornehmlich
wird eine Lösung von Schwefligsäure in Aether oder von Ammoniak in Aether
angewendet. Aether absorbirt 33 bis 70 Procent seines Gewichtes an Schwefligsäure.
Während Aether allein eine Temperaturerniedrigung von 8,5° hervorbringt, verursacht
Schwefligsäure-Aether (33procentig) eine solche von 13,5°, Ammoniak-Aether (6
procentig) eine solche von 12,5°.
An Stelle der genannten Lösungen werden noch angeführt: Lösung von Schwefligsäure in
Schwefelkohlenstoff (Absorption: 1,43 Proc., Temperaturerniedrigung: 8,3°); von
Schwefligsäure in Chloroform (Absorption: 5 Proc., Temperaturerniedrigung: 5,5°);
bei der Lösung von weniger als 1 Proc. Chlormethyl beträgt die
Temperaturerniedrigung 10°.
A. J. Rossi und L. F. Beckwith in
New-York (D. R. P. Nr. 15151 vom 18.
Januar 1881) wollen Kälte erzeugen mit der Lösung eines flüchtigen
Stoffes, z.B. Ammoniak, in einem nichtflüchtigen, z.B. Glycerin, indem sie durch
Druckverminderung das Ammoniak zum schnellen Verdunsten bringen und die hierbei
gebundene Wärme anderen Stoffen entziehen. Das Ammoniak wird dann unter
Wiederherstellung des Druckes in einem kühl gehaltenen Gefäſse wieder in dem
erschöpften Glycerine aufgelöst.
Ammoniak-Eismaschinen mit Compression (vgl. Zeuner 1882 244 89), welche
sich von der Lindeschen (1877 224 * 172) wesentlich nur durch die Construction der Druckpumpe
unterscheiden, wurden angegeben von J. K. Kilburn im
Engineering, 1882 Bd. 34 * S. 379, J. Ch. de la Vergne und W. M.
Mixer in New-York (* D. R. P. Nr. 17336 vom 7. November 1880) und von A. Osenbrück (* D. R. P. Nr. 17373 und 21971, vgl. 1882 246 * 452).
Ueber die Gestehungskosten des Eises mittels der Osenbrück'schen Maschine macht die Maschinenfabrik Germania in Chemnitz folgende Angaben:
Maschinenmodell
I
II
III
IV
V
VI
VII
Stündliche Eislieferung k
25
50
100
250
500
1000
2000
Gestehungskosten für 100k
Eis in Pf.
152
120
84
68
52
46
38
Der Wirkung einer Flüssigkeits- Kühlmaschine
äquivalenter Eisaufwand in 24 Stunden k
1000
2000
4000
10000
20000
40000
80000
Gestehungskosten der 100k
Eis äquivalenten Kühlarbeit der Maschine, in Pf.
52
42
36
32
24
20
14
Nach J. F.
Littleton in London (D. R. P. Nr. 23345 vom 21. Mai 1882) wird, um das in der
Vorlage verflüssigte Ammoniakgas auf seinem Wege zum Kühlapparate, in welchem es
durch Expansion Kälte erzeugen soll, vor Erwärmung durch die umgebende Luft zu
schützen, dieses in einem Schlangenrohre entweder durch das aus dem Kühlapparate
austretende expandirte kalte Ammoniakgas, oder durch die in demselben abgekühlte
Flüssigkeit geleitet.
(Schluſs folgt.)