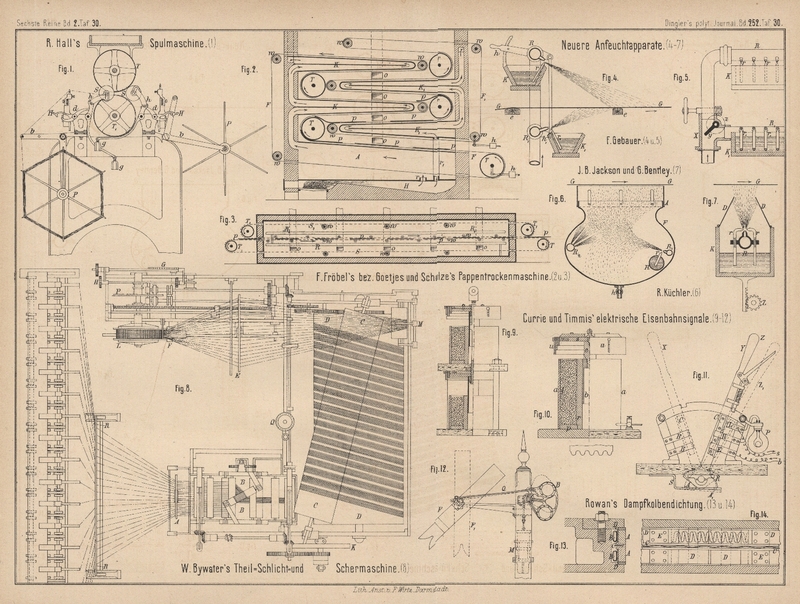| Titel: | Neuerungen an Anfeuchtapparaten für Gewebe und Papier. |
| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 405 |
| Download: | XML |
Neuerungen an Anfeuchtapparaten für Gewebe und
Papier.
Patentklasse 8. Mit Abbildungen auf Tafel 30.
Neuerungen an Anfeuchtapparaten für Gewebe und Papier.
Die Mittheilung von Feuchtigkeit an Gewebe und Papier vor dem Kalandern erfolgt
entweder durch Berührung mit einer nassen Walze, oder in Form eines Sprühnebels;
letzterer wird hervorgerufen durch Ausspritzen von Wasser mit einer schnell
rotirenden Bürstenwalze oder gepreiste Luft, beim Werfen von Wasser durch enge Siebe
(vgl. Fromm 1879 232 * 227),
oder es wird direkt Wasserdampf benutzt (vgl. Harris
1881 240 * 26). Das von A.
Stephan in Berlin (vgl. 1866 184 * 44)
angegebene Verfahren mit Preſsluft findet in einigen neueren Anfeuchtapparaten
wieder Anwendung und ist auch von Knappe (vgl. 1879 233 * 455) zum Aufbringen von flüssiger Appreturmasse auf
Gewebe benutzt. Wie bei dem letzteren befinden sich auch bei dem Anfeuchtapparate
für Papier mittels gepreſster Luft von F. Flinsch in
Offenbach (Erl. * D. R. P. Nr. 3274 vom 4. Juni 1878) die kleinen Ansatzröhrchen
finden Austritt des Wasser aus dem Zuführrohre innerhalb der Düsen für das Ausblasen
der Preſsluft; die letztere drückt dabei gleichzeitig in dem Zufluſsbehälter auf das
Wasser.
In gleicher Weise wie bei Stephan ist auch die Anordnung
des Anfeuchtapparates von F. Gebauer in
Charlottenburg (* D. R. P. Nr. 22690
vom 14. December 1882), nur daſs zwei Apparate, oberhalb und unterhalb
des Gewebelaufes, vorhanden sind und somit gleichzeitig beide Seiten des Stoffes
angefeuchtet werden können. In die Rohre R und R1 (Fig. 4 und
5 Taf. 30) wird durch ein kräftiges Gebläse Luft eingetrieben, welche
durch eine Reihe Düsen austritt und dabei, da die Düsen genau auf die in den
Wasserkasten K und K1 tauchenden kleinen Röhrchen r und r1 treffen, das Wasser ansaugt, fein zertheilt und
über das von den Leisten e getragene Gewebe G aussprüht. Die Röhrchen R und R1
können durch Hebel h und h1 verdreht, dadurch die Düsen den
Röhrchen r, r1 beliebig
nahe gestellt und die Stärke der Anfeuchtung regulirt werden. Zu erwähnen bleibt
noch die Einrichtung, durch welche der Luftzutritt in eines der beiden Rohre R und R1 aufgehoben wird, wenn das Gewebe bloſs auf einer
Seite angefeuchtet werden soll. In dem Kasten X des
Luftzuführungsrohres ist eine durch Handrad und Schneckengetriebe z stellbare Klappe y
angebracht, welche gegebenen Falles den Luftstrom von einem der Rohre R oder R1 abschlieſst.
Der in Fig. 6 Taf. 30 dargestellte Apparat von Rud. Küchler in
Wendhausen (* D. R. P. Kl. 55 Nr.
25420 vom 20. April 1883) ist besonders für Papier bestimmt und sucht für diesen Zweck von dem durch eine gleiche
Einrichtung wie vorher (Wasserrohr R mit den kleinen
Röhrchen r, Luftrohr R1 mit Düsen) erzeugten Sprühnebel nur die feinsten
Theilchen zur Anfeuchtung zu verwenden. Gegenüber dem Luftrohre R1 befindet sich ein
zweites Luftrohr R2;
die durch Löcher hier austretende Luft trifft den Sprühnebel und treibt die feinsten
Wassertheilchen nach oben gegen das Papier G, während
die schwereren Wassertheilchen in dem umgebenden Gehäuse F sich sammeln und durch den Hahn h
abgelassen werden können. Der ganze Apparat läſst sich in verschiedenem Abstande von
dem Papierlaufe einstellen, zu welchem Zwecke der Aufsatz A des Gehäuses F verschiebbar ist.
Bei dem in Fig. 7 Taf.
30 skizzirten Apparate von J. B. Jackson
und G. Bentley in Bury (Englisches Patent, vgl. Deutsches Wollengewerbe, 1884 S. 7) sind vor jeder Düse
des Luftrohres R zwei gegen einander angeordnete kleine
Saugröhrchen r angebracht, welche durch Ein- bezieh.
Ausschrauben gegen die Luftdüsen verschieden hoch eingestellt werden können. Das
Rohr R befindet sich in dem Wasserkasten K, welcher durch Zahnstange und Rad Z in beliebigen Abstand von dem Stofflaufe G gebracht werden kann und zwei Deckel D trägt, welche die Stärke des Nebelstrahles und damit
die Anfeuchtung reguliren. Durch die doppelte Anordnung der Röhrchen r dürfte auch hier eine weitere Verfeinerung des
Sprühnebels herbeigeführt werden.
Tafeln