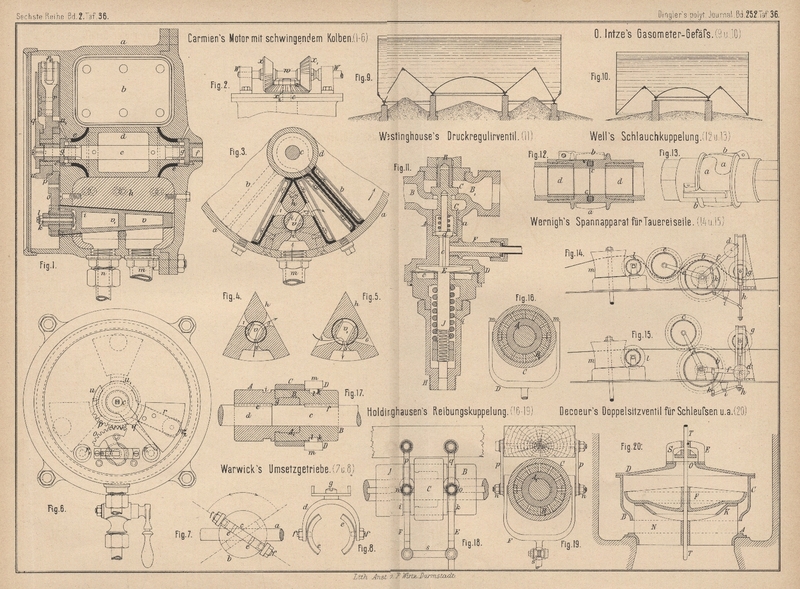| Titel: | Carmien's Motor mit schwingendem Kolben. |
| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 486 |
| Download: | XML |
Carmien's Motor mit schwingendem
Kolben.
Mit Abbildungen auf Tafel 36.
Carmien's Motor mit schwingendem Kolben.
Bei dem von P. J. Carmien in Issy bei Paris (*
D. R. P. Kl. 59 Nr. 24205 vom 5. December 1882)
angegebenen, sowohl als Pumpe, wie auch als Motor oder Wassermesser u. dgl.
verwendbaren Kapselwerke schwingt ein Kolben in einem unterbrochenen ringförmigen
Gehäuse hin und her und steuert dabei einen doppelten Dreiwegehahn derart, daſs eine
stetige Förderung der zu hebenden bezieh. zu messenden Flüssigkeit erfolgt, oder im
anderen Falle die Betriebsflüssigkeit stets treibend auf den Kolben einwirkt.
Wie aus Fig. 1 und 3 Taf. 36
hervorgeht, ist die Unterbrechung in dem ringförmigen Pumpenraume a durch das Gehäuse h des
Steuerhahnes selbst gebildet; der Flügelkolben b wirkt
bei seiner Schwingung wie der Kolben einer doppelt wirkenden Pumpe auf der einen
Seite saugend, auf der anderen drückend. Die Dichtung des Flügels b und der Nabe d erfolgt
durch entsprechende Kautschukstulpen. Die Stulpen e der
Nabe werden durch die Schrauben f mittels der
Metallkappen g von auſsen angezogen. Der zur
Verminderung der Reibung mittels eines Leder- oder Kautschukmantels in das Gehäuse
h eingesetzte Hahnkegel i besitzt zwei Durchgangsöffnungen v und v1 von denen die eine
v für den Eintritt, die andere v1 für den Austritt der
zu fördernden oder Betriebsflüssigkeit dient. Durch den auf den Stift k ausgeübten Druck der Feder l, deren Lage aus Fig. 6 zu
ersehen, wird der Hahnkegel in seinen Sitz hineingedrückt. Der Stift k legt sich dabei mit seiner Spitze gegen die
Kopffläche des Hahnkegels.
Bei der gezeichneten Stellung des Hahnes (Fig. 3 und
4) tritt durch den Kanal 2 aus dem Rohre m Wasser durch die Oeffnung v des Hahnkegels und die Oeffnung 3 in der
Wand h hinter den Kolben b. Dadurch wird letzterer in der Pfeilrichtung gedreht und gelangt in die
punktirte Stellung links. Hierbei wird die auf der anderen Seite des Kolbens
stehende Flüssigkeitsmenge durch den Ausströmungskanal v1 des Hahnes und die Oeffnungen 4 und 5 (vgl. Fig.
5) des Hahngehäuses h und weiterhin durch das
Anschluſsrohr n fortgedrückt. In dem Augenblicke, wo
der Flügel b in die in Fig. 3
punktirt angegebene Lage kommt, wird der Hahnkegel umgesteuert und gelangt nun die
Flüssigkeit aus m durch Kanal 2, Hahnkanal
v und Kanal 1 in den
linken Theil des Gehäuses; ein Entweichen der vorher aufgenommenen Flüssigkeit
findet alsdann durch den Kanal 6, Hahnkanal v1 und Kanal 5 des Gehäuses (vgl. Fig. 5) und
das Abfluſsrohr n statt.
Diese Umsteuerung wird folgendermaſsen bewirkt: Der an dem Hahnkegel i sitzende Zahnbogen o
(Fig. 1 und 6) steht mit
einem Zahnkranze p in Eingriff, welcher um einen die
Achse c concentrisch umschlieſsenden Zapfen drehbar
ist. Ein Theil dieses Zapfens dient auch einem mit einem Gewichte versehenen
Hebelarme r als Drehzapfen. Dieser Hebelarm befindet
sich mit dem mit der Achse c und dem Flügel b sich drehenden Arme q in
der Stellung Fig. 6, wenn
der Flügel b in der Pfeilrichtung Fig. 3 sich
zu drehen beginnt. Der Hebelarm r trägt jenseits der
Achse c eine Knagge u,
welche bei der Drehung des Armes q von letzterem
mitgenommen wird, bis der Hebel r die lothrechte, in
Fig. 6 punktirt eingezeichnete Stellung überschritten hat und nun durch
sein Gewicht vollends nach links herübergelegt wird. Hierbei stöſst eine unterhalb
des Hebels befindliche Knagge u1 gegen den Zahnbogen p, nimmt denselben mit und veranlaſst so unter Vermittelung der
Verzahnungen von p und o
eine Drehung des Hahnkegels i um etwa 90°, womit dann
die Umsteuerung bewerkstelligt ist. Um die Bewegung des Hebels r und damit auch des Steuerhahnes zu begrenzen, sind
zwei elastische Anschläge r1 vorhanden, gegen welche sich das Gewicht des Hebels r anlegt. In dem Gewichte ist noch ein Röllchen r2 angebracht, welches,
wenn der Apparat als Wassermesser dient, ein am Gehäuse anzubringendes, nicht
gezeichnetes Zählwerk betreibt, durch welches die Angabe der Schwingungen des
Flügelkolbens und damit auch der durch den Apparat gegangenen Wassermenge
erfolgt.
Will man den Apparat als Motor benutzen, oder soll derselbe als Pumpe für
Kraftbetrieb dienen, so ist die Achse c nur aus dem
Gehäuse herauszuführen und eine geeignete Einrichtung zur Umsetzung der schwingenden
Bewegung des Kolbens in eine fortlaufende Drehbewegung bezieh. umgekehrt
herzustellen. Hierzu soll z.B. das in Fig. 2 Taf.
36 dargestellte Rädergetriebe dienen. In den an dem wagerecht aufgestellten Gehäuse
befestigten Lagern W kann sich die Achse w mit den auf ihr festsitzenden Kegelrädern x, x1 drehen, welche
nur je zur Hälfte verzahnt sind. Zwischen diesen Rädern ist das Kegelrad x2 auf der verlängerten
Flügelachse c frei drehbar angeordnet. Dieses Rad x2 wird aber von dem
auf c festsitzenden Mitnehmer z, welcher an Ansätze des Rades x2 anschlägt, in geeignetem Augenblicke bald nach
rechts, bald nach links umgedreht und versetzt, indem es in dem einen Falle mit der
Verzahnung von x, im anderen mit der Verzahnung von x1 in Eingriff kommt,
die Achse w in eine nach gleicher Richtung
fortschreitende Drehung, zu deren Ausgleichung man auf w ein Schwungrad aufsetzen kann. – Als besonders zweckmäſsig ist dieser
Mechanismus, den man
selbst bei untergeordneteren Bewegungsübertragungen nur ungern anwendet, wohl kaum
anzusehen, da die Drehungsrichtung des Kolbens plötzlich, also mit Stoſs gewechselt
wird und, namentlich wenn der Apparat als Motor dient, ein sicheres Eingreifen der
halbverzahnten Räder wohl nicht zu erwarten ist.
Tafeln