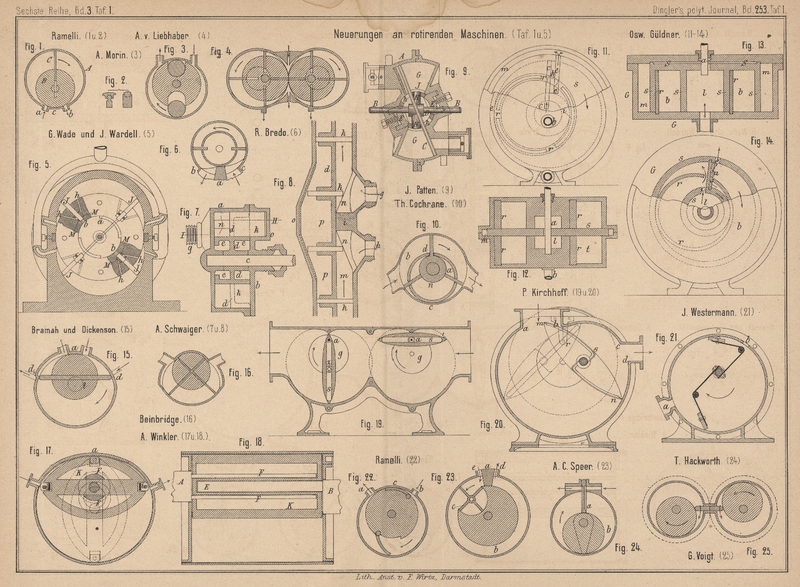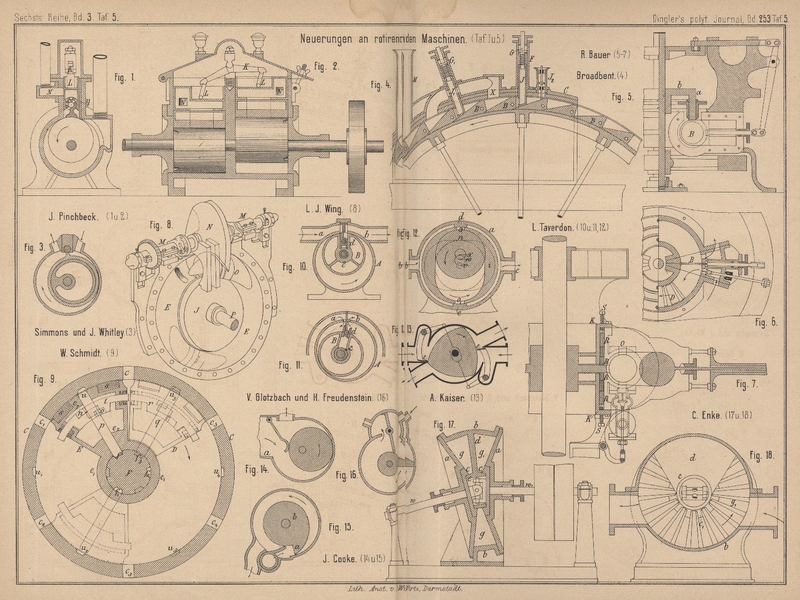| Titel: | Neuerungen an rotirenden Maschinen. |
| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 49 |
| Download: | XML |
Neuerungen an rotirenden Maschinen.
Mit Abbildungen auf Tafel 1 und 5.
(Fortsetzung des Berichtes von S. 1 d. Bd.)
Neuerungen an rotirenden Maschinen.
Man kann sich nun Kolben, Walze und Gehäuse auch noch in anderer Weise wie bisher mit
einander verbunden denken. Nimmt man z.B. an, die Walze Fig. 1 Taf.
1 sei hohl und werde mit ihren Rändern in excentrischen Ausdrehungen der
Gehäusedeckel geführt, so kann man die centrisch im Gehäuse unabhängig von der Walze
gelagerte Welle mit dem Kolben fest verbinden; nur muſs man dann die Kanten der
Walzenspalte, durch welche der Kolben geht, so groſs machen, als es die
verschiedenen Lagen des letzteren zum Walzenmittelpunkte verlangen (vgl. auch die
schon erwähnten Maschinen von Hick 1845 95 * 81 und Durot * D. R. P.
Nr. 22910). Dieses Prinzip findet in Fig. 10
Taf. 1 seinen Ausdruck, ist übrigens auch schon früher mannigfach angewendet worden
(vgl. die rotirende Dampfmaschine von Th. Cochrane 1836
62 * 441, welche mit Condensation arbeitet, bezieh.
von Th. Dundonald 1837 64 *
164, die Rotationspumpe von Mc Farland 1875 218 * 288, das Gebläse von Mackenzie 1875 215 * 100, ferner die rotirende
Schiffsdampfmaschine von Brossard in der Revue industrielle, 1882 * S. 225). Es wird also in
diesem Falle die auf die Kolben wirkende Kraft von diesen direkt auf die Welle
übertragen. Andererseits geht aus Fig. 10
hervor, daſs auch hier die Enden der Kolben keiner Schuhe bedürfen; sie können
vielmehr genau nach dem Radius des Gehäuseinneren abgedreht werden. Dagegen wird
eine besondere Führung zwischen Kolben und Walze nothwendig. Bei einigermaſsen
zweckmäſsig eingerichteten Maschinen wird dies nicht durch einfache Abschrägung der
Kanten der Walzenspalten erzielt, sondern durch Anordnung eines Walzengelenkes. Bei
der Anordnung mehrerer Kolben müssen auſserdem die einzelnen Kolben unabhängig von
einander sein, da dieselben in den verschiedenen Lagen veränderliche Winkel
einschlieſsen.
Neuere Ausführungen dieser Maschinen sind die von Otto
Küster in Neuenhaus, Reg.-Bez. Düsseldorf (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 4018 vom
10. Juli 1878 und Kl. 59 * Nr. 19603 vom 29. September 1881); dieselben sind der Lechat'schen Maschine (vgl. 1866 182 * 1) nachgebildet und unterscheiden sich wesentlich von diesen nur
durch die Anordnung von Laufrollen um die aus den Gehäusedeckeln heraustretenden
Walzenenden, um die Stopfbüchsen, in welchen jene schleifen, zu entlasten. Hierher
gehört auch die rotirende Pumpe von H. Edw. Skinner in
Nag's Head Inn, England (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 3860 vom 14. Mai 1878), deren
Einrichtung aus Fig. 10
Taf. 1 hervorgeht, nur daſs die Anordnung der Kolben auf der Welle eine etwas andere
ist. Die Pumpe ist einer näheren Besprechung nicht werth, wohl aber ein Vorschlag, welchen Skinner noch macht. Er will nämlich, vorausgesetzt,
daſs zwischen Walze und Gehäuse bei c (Fig. 10)
sowie zwischen Walze und Kolbennabe n bei d eine dampfdichte Berührung stattfindet und die
nöthigen Ausström- und Einströmöffnungen vorhanden sind, auſserhalb der Walze Dampf
in die Maschine leiten, dieselbe also als Dampfmotor, das Innere der Walze dagegen
als Pumpe benutzen. Man könnte also die zu fördernde Flüssigkeit höher heben, als
eigentlich dem Dampfdrucke entspricht, da ja der Hebelarm, an welchen der Dampf
angreift, gröſser ist als der der Last. Ohne weiter auf die Zweckmäſsigkeit einer
solchen Ineinanderschachtelung von Dampfmotor und Pumpe einzugehen, muſs hier darauf
hingewiesen werden, daſs dies der erste derartige Vorschlag ist, welcher seiner
Eigenartigkeit wegen beachtenswerth ist. Wir finden denselben Gedanken S. 9 d. Bd.
bei dem schon erwähnten Kissam'schen Motor
ausgesprochen, welcher, da derselbe nur dadurch von der vorbesprochenen Maschine
abweicht, daſs die Achsen der Betriebswelle und Kolbenwelle nicht in eine Linie fallen, im Uebrigen aber wie vorhin sowohl der von der
Walze, als der von der Walze und dem Gehäuse eingeschlossene Raum ausgenutzt wird,
hier näher besprochen werden soll. Kissam läſst den
Dampf, nachdem er im Inneren a der Walze (Fig.
10 Taf. 1) auf eine Drehung derselben eingewirkt hat, in den zwischen
Gehäuse und Walze liegenden Arbeitsraum b strömen und
sich hier ausdehnen. Es ist also das Compoundprinzip in einer einzigen Maschine zum
Ausdruck gebracht. Eine derartige Zusammenstellung zweier Dampfmaschinen erscheint
zweckmäſsiger als die von Dampfmotor und Pumpe, besonders wegen der Abkühlung. Die
Dampfvertheilung wird durch einen Kreisschieber bewirkt, durch dessen Umstellung
eine Bewegungsumkehr der Maschine erzielt wird.
Hierher gehört auch die Maschine von Osw. Güldner in
Nossen bei Dresden (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 22336 vom 27. Oktober 1882); diese besitzt
einen ringförmigen Arbeitsraum t (Fig. 11 und
12 Taf. 1), welcher durch eine auf der centrisch gelagerten Welle a aufgekeilte Scheibe s in
zwei Abtheilungen geschieden wird. An jeder Seite der Scheibe s schleift je ein excentrisch in Nuthen der
Gehäusedeckel geführter Ring r. Die Ringe r berühren die Innenwände des Arbeitsraumes in zwei
Linien i und e dampfdicht.
Die Scheibe s ist nun von einem radialen Kolben k durchsetzt, welcher sich in Walzengelenken der Ringe
r verschieben kann. Führt man den Dampf durch b in den Raum l, so tritt
derselbe durch Aussparungen c in der Scheibe s links vom Kolben k ein
und dreht diesen bezieh. die Welle a nach rechts herum.
Der vor dem Kolben k befindliche Dampf entweicht durch
die Aussparungen e in den Raum m und von hier ins Freie. Der Kolben steht also auf seiner ganzen
Oberfläche während einer ganzen Umdrehung unter dem vollen Dampfdrucke. Ordnet man
zwei concentrische Arbeitsräume mit je einem Ringpaare r
und je einem Kolben k an, so kann das Compoundprinzip zur Anwendung
gelangen, d.h. der Dampf aus dem kleineren Arbeitsraume gelangt in den gröſseren und
wirkt hier durch seine Ausdehnung.
Bei der abgeänderten Güldner'schen Maschine (vgl. * D.
R. P. Kl. 59 Nr. 23956 vom 21. Februar 1883) ist in einem feststehenden Gehäuse G (Fig. 13 und
14 Taf. 1) centrisch eine Welle a gelagert,
auf welcher eine Platte S mit zwei centrischen
Kreiswänden s aufgekeilt ist. Die Wände s schleifen mit ihren Kanten dampfdicht in dem Gehäuse
G, so daſs ein Arbeitsraum b von ringförmigem Querschnitte gebildet wird. Innerhalb desselben ist ein
loser Ring r angeordnet, welcher auf der einen
Kopffläche dampfdicht gegen die Scheibe S anliegt und
auf der anderen Seite in einer ex centrischen Nuth des Gehäusedeckels so geführt
wird, daſs derselbe die äuſsere und innere Ringwand s
in zwei Linien berührt. Die Ringwände s sind nun. durch
einen Kolben u, welcher den Ring r mit Spielraum durchdringt, fest verbunden. Denkt man
sich nun in den Raum l Dampf geleitet, so tritt
derselbe durch die Oeffnung c der inneren Ringwand s und den Spielraum des Ringes r im Kolbenschlitze in den Arbeitsraum b und
schiebt den Kolben u nach rechts bezieh. dreht die
Welle a. Der vor u
befindliche Dampf entweicht durch eine Aussparung des Kolbens und die Oeffnung e in der äuſseren Ringwand s in den Raum m des Gehäuses und von hier ins
Freie. In der gezeichneten Anordnung soll die Maschine als Pumpe dienen; sie kann
aber auch in genauerer Ausführung, besonders unter Anwendung der schon genannten
Verbindung zwischen Kolben u und Ring r mittels eines Walzengelenkes als Dampfmotor laufen.
Will man das Walzengelenk nicht anwenden, so empfiehlt Güldner die Anwendung eines Ringes r, welcher
aus zwei concentrischen, gegen einander verdrehbaren Ringen besteht. Kolben und Ring
berühren sich dann immer in zwei Linien statt in einer Linie. Eine derartige
Zweitheilung ist zu demselben Zwecke auch schon bei Kolben, wie sie die Maschine
Fig. 1 benutzt, vorgeschlagen worden.
Auch in dieser Form ist die Maschine von Güldner als
Compoundmaschine ausgebildet worden. Man bedarf hierzu nur 3 concentrische Ringwände
mit 2 Kolben u und 2 excentrischen Ringen r mit entsprechender Dampfführung. Hierher gehört auch
die Pumpe von L. D. Green 1875 216 * 471 und die Dampfmaschine von J. Lamb
1843 88 * 86.
Die Schwierigkeit einer Dichtung zwischen Kolben, Walze und Gehäuse hat man auch noch
auf andere Weise zu umgehen gesucht. Bei dem Systeme Fig. 1 Taf.
1 liegt der wunde Punkt an der äuſsersten Kante des Kolbens, bei Fig. 10 in
der Durchführung der Kolben durch die Walze. Um besondere Vorrichtungen zur
Verschiebung der Kolben in radialer Richtung (Fig. 1) und
zur Verbindung der Kolben mit der Walze (Fig. 10)
unnöthig zu machen, fertigte man zwei sich gegenüber liegende Kolben aus einem
Stücke, erhielt also einen Kolben von unveränderlicher
Länge (vgl. Fig. 15
Taf. 1). Da aber dieser Kolben bei der dargestellten Anordnung der Walze immer durch einen
Punkt geht, welcher nicht mit dem Mittelpunkte des Gehäuses zusammenfällt, so muſste
man letzterem die Gestalt einer Kardioïde geben, damit der Kolben immer mit der
Gehäuseinnenwand in Berührung bleibt. Derartig eingerichtete Dampfmaschinen sollen
nach Ewbank (vgl. Hydraulic and
other machines for raising water. New-York 1876 S. 290) schon im J. 1790
von Bramah und Dickenson
gebaut worden sein. Bei der Maschine Fig. 15
liegt der Eintritt der Betriebsflüssigkeit auf der einen Seite der Linie a, der Austritt auf der anderen. Um einen schädlichen
Gegendruck der oben links zwischen Walze, Kolben und Gehäuse eingeschlossenen
Flüssigkeit zu vermeiden, muſs der Austritt in der dargestellten Weise vergröſsert
werden. Die Länge der Walze muſs natürlich gröſser als die des Kolbens sein und
werden deshalb die Kopfenden der Walzen in excentrischen Aussparungen der
Gehäusedeckel geführt. Die Walzenwelle wird auf den Kopfenden der Walze
befestigt.
Die nach dem gleichen Prinzipe gestaltete Dampfmaschine von Fr. Pernot in Gray (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 8344 vom 22. Juni 1879) besitzt
einen mit Schuhen versehenen Kolben und einen auf der Walzenwelle befestigten
Expansionsschieber. Der Eintritt der Betriebsflüssigkeit liegt in einem
Gehäusedeckel, der Austritt im Gehäusemantel.
Aehnlich ist die Maschine von Ludw. Pfaff in
Neu-Isenburg (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 8404 vom 30. Mai 1879) eingerichtet; nur sind
hier zur besseren Dichtung des Kolbens im Gehäuse an ersterem durch Blattfedern
gegen letzteres vorgedrückte Schuhe angeordnet. Der durch die Walze hindurch
erfolgende Dampfeintritt kann mittels eines Regulators in verschiedenen Füllungen
abgeschlossen werden. Das Zusatzpatent * Nr. 9633 vom 25. November 1879 betrifft in
den Kolben gelegte und nach 4 Seiten hin wirkende Dichtungsleisten und eine
Expansionssteuerung, welche aus einem von einem Excenter bewegten Kreisschieber
besteht.
Einer allgemeineren Verbreitung dieser Maschinen steht die Schwierigkeit der
Herstellung des Gehäuses entgegen. Dasselbe muſs genau nach einer Kardioïde
ausgedreht werden. Man hat auch schon versucht, nur den Deckeln die Gestalt von
Kardioïden zu geben und dann um diese ein biegsames Blech als Gehäusemantel
herumzulegen und passend zu befestigen. Diese Herstellung kann aber nur bei
Gebläsen, überhaupt nur dort Anwendung finden, wo mit geringen Druckwirkungen
gerechnet wird. Sind letztere, wie z.B. bei Motoren gröſser, so wird durch die
Bearbeitung bezieh. Biegung des Mantels die innere Oberfläche so rauh, daſs trotzdem
eine Bearbeitung derselben nothwendig wird. Es ist deshalb folgendes Auskunftsmittel
gewählt: Man stellt das Gehäuse Fig. 16
Taf. 1 aus zwei concentrischen Kreisabschnitten her und verbindet beide durch
Kardioïdencurven. Dem kleineren Kreisabschnitte gibt man dabei den Radius der Walze
und ordnet den Eintritt und Austritt der Betriebsflüssigkeit über den Theilen des Gehäuses
an, welche die Form einer Kardioïde haben; dann müssen aber 2 Kolben vorhanden sein,
da sonst bei bestimmten Kolbenstellungen eine Verbindung des Eintrittes und
Austrittes stattfände. Die sich in der Mittellinie der Walze schneidenden Kolben
greifen in diesem Falle kammartig durch einander. Die innere Bearbeitung derartig
gestalteter Guſsgehäuse bietet keine Schwierigkeit, da die Kardioïdenflächen roh
bleiben können. Diese Art von Maschinen findet vornehmlich als Pumpe und
Wassermesser Verwendung.Vgl. z.B. die Pumpe von Allweiler 1877 223 * 147, den Wassermesser von Schäffer und Budenberg 1866 180 * 425, die Pumpe von P. Samain 1879 233 * 20 bezieh. von Edw. Waldron in London (* D. R. P. Kl. 59 Nr.
7478 vom 16. November 1878). Die betreffende Patentschrift ist zu ungenau
gefaſst, um hier näher darauf eingehen zu können. (Das System ist jedoch
auch als Dampfmaschine ausgebildet worden; vgl. die rotirende Dampfmaschine
von J. Bainbridge 1823 12 * 307 bezieh. J. Upton 1839 71 * 81.) Natürlich müssen in diesem
Falle die Ein- und Auslässe entsprechend eingerichtet werden. Für derartige
Maschinen hat Jos. Kronenberg Sohn in Luzern (* D. R.
P. Kl. 59 Nr. 20 293 vom 9. April 1883) eine Steuerungsvorrichtung mit
veränderlicher Expansion angegeben.
Wie Fig. 15 Taf. 1 erkennen läſst, trennt der Kolben den Arbeitsraum in 2
Theile verschiedener Gröſse. Gibt man demnach der Walze bei unveränderter Lage des
Kolbens nur einen solchen Durchmesser, wie er eben zur Führung des Kolbens
nothwendig ist, so kann man durch Drehen der Walze in der Pfeilrichtung den über dem
Kolben befindlichen Raum vergröſsern, den unter demselben befindlichen Raum
verkleinern. Bringt man nun, statt oben bei a, bei d und d1 im Gehäusemantel Oeffnungen an, so findet bei d eine Saug-, bei d1 eine Druckwirkung statt. Umgekehrt kann man dieses
System aber auch als Motor benutzen. Die Todtpunktstellung tritt in der in Fig.
15 gezeichneten Lage des Kolbens ein, weil dann die bei d eintretende Betriebsflüssigkeit auf gleiche
Hebellängen des Kolbens drückt. Sowie aber die Walze etwas nach rechts gedreht wird,
verschiebt sich der Kolben in derselben ebenfalls nach rechts. In Folge dessen wird
das Gleichgewicht gestört und die Drehung der Walze beginnt. Auch dieses Prinzip ist
schon von verschiedenen Seiten benutzt worden (vgl. die Dampfmaschine von E. Galloway 1836 60 * 409
und Mathon 1853 127 * 241).
Neuerdings hat es August Winkler in Breslau (* D. R. P.
Kl. 14 Nr. 7636 vom 16. März 1879) als Motor, Pumpe und Gebläse ausgebildet. Der
Kolben K hat zur Vermeidung schädlicher Räume die in
Fig. 17 Taf. 1 dargestellte Gestalt. Die Mittelrippe desselben wird von
zwei Backen F umfaſst, welche auf der Walze A (Fig. 18)
angebracht sind; letztere rotirt in einer excentrischen Ausdrehung des einen
Gehäusedeckels. Da diese Backen zur sicheren Führung des Kolbens nicht genügen
würden, so ist noch ein anderes Mittel vorgesehen. Die Mittellinie des Kolbens
beschreibt nämlich bei der Bewegung des letzteren eine in sich geschlossene Curve
l (Fig. 15),
welche ohne groſsen Fehler als Kreis angenommen werden kann. Die Mittellinie des Kolbens dreht sich also
unter gleichzeitiger Verschiebung zwischen den Backen F
um den Mittelpunkt jenes Kreises l. Dem entsprechend
ordnet Winkler in dem anderen Gehäusedeckel (Fig.
18) eine zweite Walze B an, deren Mittellinie
mit dem Mittelpunkte des Kreises l (Fig. 15)
zusammenfällt und auf welcher ein die Mittelrippe des Kolbens durchdringender Zapfen
E angeordnet ist, dessen Mittellinie bei der
Drehung den Kreis l beschreibt. Entsprechend der
doppelten Winkelgeschwindigkeit der Mittellinie des Kolbens im Verhältnisse zur
Kolbenebene erhält daher auch die Welle B die doppelte
Winkelgeschwindigkeit der Welle A. Die beiden Enden des
Kolbens K tragen Dichtungsleisten, welche aus Leder-
oder Kautschukscheiben i bestehen, die auf Eisenstäbe
aufgereiht und fest zusammengepreſst sind. Diese Leisten werden in Nuthen des
Kolbens eingelegt und durch Federn angedrückt. Winkler
hält es für zweckmäſsig, bei Motoren den Durchmesser des Kreises l (Fig. 15)
gleich ⅕ der Breite des Kolbens K zu machen; für Pumpen
und Gebläse soll sich dagegen ein Verhältniſs wie 1 : 0,3 empfehlen. In letzterem
Falle baucht sich die Kardioïde bei a (Fig. 17)
ein. Demgemäſs soll man den mit convexen Flächen versehenen Kolben durch einen
einfachen Plattenkolben ersetzen, welcher an den Enden mit einer Bürstendichtung
versehen ist. In der Patentschrift ist auſserdem noch eine Steuerung für derartige
Dampfmaschinen beschrieben.
Hierher gehören auch die Ventilatoren von Paul Kirchhoff
in Mittweida (* D. R. P. Kl. 27 Nr. 8689 vom 23. August 1879 und Zusatz Nr. 10796
vom 19. Februar 1880). Bei dem in Fig. 19
Taf. 1 veranschaulichten Gebläse arbeiten 2 Kolben in einem gemeinschaftlichen
Gehäuse. In dem einen Gehäusedeckel sind excentrisch die Walzen g gelagert, deren Zapfen z
drehbar, aber nicht verschiebbar mit den Kolben verbunden sind. Zur Führung dienen
die Rollen a, die in dem gegenüber liegenden
Gehäusedeckel befestigt sind und über welche die Kolben mittels je eines Schlitzes
s gleiten. Im rechten Gehäusetheile Fig. 19
fällt der Zapfen z mit der Rolle a über einander. Der Querschnitt der Kolben ist von
einer Curve begrenzt, welche in jeder Lage den oberen Theil der Kardioïde berührt.
Die Kolben bestehen aus einem leichten, mit Schwarzblech bekleideten Holzgerippe.
Der Schlitz s ist mit Blech ausgefüttert, während die
Rollen a mit Leder überzogen sind, um möglichst
geräuschlos zu arbeiten. Die Wirkung der Kolben geht aus der Skizze hervor.
Bei dem zweiten Kirchhoff'schen Gebläse Fig. 20
Taf. 1, welches nur einen Kolben besitzt, liegt die Einströmöffnung oben, die
Ausströmöffnung seitlich, und zwar sind beide so angeordnet, daſs die Punkte a, r und d in einer
geraden Linie liegen, während b und c so zu einander angeordnet sind, daſs, wenn der Punkt
s den Punkt b berührt,
die Kante n des Kolbens den Punkt c ein wenig überschritten hat. Hierdurch schlieſst der Kolben mit der Kante
m die Einströmung, sobald die Kante n die Ausströmung öffnet, während die Kante b die Kolbenfläche ms so lange berührt, bis die Kante n die
Dichtung bei c bewirkt. Der Kolben ist aus
-förmig gebogenem Bleche hergestellt, welches an den Kopfseiten die
linsenförmig gestalteten Endplatten trägt.
Eine eigenartige Abänderung dieser Einrichtung, welche sich dem in Fig. 22
Taf. 1 dargestellten Systeme nähert, hat J. Westermann
in Witten a. d. Ruhr (* D. R. P. Kl. 27 Nr. 25 238 vom 7. Juli 1883) vorgeschlagen.
In einem cylindrischen Gehäuse ist, wie aus Fig.
21 Taf. 1 zu entnehmen, excentrisch eine mit 2 Flügeln versehene Welle
gelagert. Die Flügel sind so lang, daſs die Welle sich unbehindert im Gehäuse drehen
kann. Um nun einen Schluſs dieser Flügel mit der Gehäuseinnenwand zu erzielen, sind
an den Endkanten derselben Klappen mittels Gelenke oder biegsamer Bleche befestigt,
so daſs diese bei der Drehung der Welle durch die Centrifugalkraft gegen die
Gehäuseinnenwand gepreſst werden. Die Maschine kann in Folge dessen nur zum Ansaugen
und Fortdrücken von Flüssigkeiten oder Gasen dienen. Dieselben treten bei b ein, bei a aus. Unter
allen Umständen muſs aber die Centrifugalkraft der Klappen im Stande sein, dem bei
a wirkenden Drucke zu widerstehen. Zur besseren
Dichtung sind die Klappen an den Endkanten mit Holzleisten versehen. Zu bemerken
ist, daſs bei dieser Maschine der schädliche Raum sehr groſs ist. Die Menge der bei
einer Umdrehung geförderten Betriebsflüssigkeit ist gleich dem doppelten
Unterschiede des kleinsten und gröſsten Raumes.
Das in Fig. 1 Taf. 1 skizzirte System kann auch dahin abgeändert werden, daſs
man, anstatt den Kolben in Form eines Schiebers mit der Walze zu verbinden, den
Kolben in Gestalt einer mit der Walze gelenkig verbundenen Klappe ausbildet. Eine
solche rotirende Maschine mit 3 Klappen (vgl. Fig. 22)
ist auch schon von Ramelli gebaut worden; dieselbe hat
weniger Reibungsverluste, da die Klappen ihrer Drehung weniger Reibungswiderstände
entgegensetzen, als die Schieber Fig. 1 ihrer
geradlinigen Bewegung. Dafür ist die gelenkige Verbindung der Klappen mit der Walze
um so schwieriger. Jedenfalls darf das eigentliche Gelenk keinen Druck von den
Klappen auf die Walze übertragen. Dies müssen cylindrische Aussparungen in dem
Walzenumfange thun, in welche die Klappen mit entsprechend geformten Wülsten
hineinpassen. Das eigentliche Gelenk soll die Klappe lediglich in ihrer Lage
festhalten. Die Andrückung der Klappe gegen die Gehäusewand erfolgt entweder durch
die Betriebsflüssigkeit, welche unter dieselbe tritt, oder durch Federn, oder
zwangläufig. Liegt die Walze Fig. 22
excentrisch wie in Fig. 1, so
steigt die Kraftäuſserung während einer Umdrehung von Null auf ein Maximum und fällt
dann wieder bis auf Null.
Eine neuere Dampfmaschine dieser Gattung ist die von P. B.
Martin (1879 233 * 114) mit 2 Kolben. Eine als
Gebläse dienende Abänderung dieser Maschine rührt von Ellis (vgl. 1877 226 * 133) her; das System ist
übrigens früher schon von Cochrane als Dampfmaschine
ausgebildet worden (vgl. Reuleaux: Theoretische
Kinematik, 1875 S. 375). Die früher bei der Maschine Fig. 6
aufgestellten Gesichtspunkte führten auch bei dieser Maschinengruppe zu einer
Umgestaltung; sie findet sich schon bei den Maschinen von W.
Foreman 1826 20 * 334, L. W. Wright 1826 22 * 193, Rob. Winch 1827 23 * 204,
L. Costigin 1828 27 *
401. Dasselbe Prinzip kommt bei der Dampfmaschine von Heinrich Prokesch in Jägerndorf (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 8271 vom 19. Juli
1879) zum Ausdrucke. Bei derselben sind die Kopfflächen der Walze und die Kanten der
Klappe gegen das Gehäuse durch federnde Leisten gedichtet. Am Punkte a (Fig. 22)
sind seitlich der Dichtungsleiste Rollen zur Verminderung der Reibung
angeordnet.
Dem alten Lemielle'schen Gebläse ist der Ventilator von
V. F. Brohée in Pâturage, Belgien (* D. R. P. Kl.
27 Nr. 6122 vom 19. Januar 1879) nachgebildet. Die excentrisch im cylindrischen
Gehäuse gelagerte, letzteres aber nicht berührende Walze besitzt 3 Klappen, deren
äuſsere Kanten dadurch zwangläufig mit dem Gehäuse in Verbindung stehen, daſs sie
mittels Rollen in centrisch in den Gehäusedeckeln angeordneten Nuthen laufen. Auf
die Führung der Rollen in den Nuthen bezieht sich der Vorschlag von Heinr. Krähwinkel in Barmen (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 17
613 vom 5. August 1881).
Im Anschlüsse hieran möge noch die rotirende Maschine von Ritz und Schweizer (vgl. 1882 246 * 310) und
eine in Deutschland weniger bekannte amerikanische Maschine von A. C. Speer in Hart, Mich. (Nordamerikanisches Patent
Nr. 181112) erwähnt werden. Die centrisch gelagerte Walze der letzteren besitzt am
Umfange mit Sprengringen versehene Flanschen b (Fig.
23 Taf. 1), welche, wie schon früher erwähnt, die feste Wand a umfassen (das Gehäuse besitzt in Folge dessen gar
keine Deckel). Zwischen diesen Flanschen b ist drehbar
ein Rad c mit vier Schaufeln in der dargestellten Art
und Weise gelagert. Es ist nun klar, daſs der bei e
eintretende Dampf auf die Schaufeln des Rades c drückt
und dasselbe, da eine Drehung um seine Achse nicht eintreten kann, weil es durch
eine schwache Schnappfeder in der gezeichneten Stellung gehalten wird, im Uebrigen
aber der Dampfdruck auf die beiden in Betracht kommenden Schaufeln gleich groſs ist,
mit der Walze in der Pfeilrichtung bewegt. Gelangt das Schaufelrad an die Wand a, so muſs der Dampf durch eine Steuerung abgesperrt
werden, während ein Schwungrad, oder eine zweite derartige Maschine die Walze über
den todten Punkt hinwegdreht.
Eine Umkehrung des in Fig. 1 Taf.
1 dargestellten Systemes ist in Fig. 24
Taf. 1 veranschaulicht. Walze und Kolben haben hier ihre Rollen vertauscht. Die
feste Druckfläche wird durch den im Gehäuse radial verschiebbaren Schieber a gebildet, während der Kolben von einem auf der centrisch zum Gehäuse
gelagerten Welle befestigten Körper b gebildet wird.
Hat letzterer eine cylindrische Gestalt, wie in Fig. 24
schraffirt angegeben ist, so wird die Kraftäuſserung auf den Kolben während einer
Umdrehung eine bis zu einem Maximum stetig wachsende und dann wieder stetig
abnehmende; hat derselbe dagegen den punktirten Querschnitt, so ist die
Kraftäuſserung während des gröſsten Theiles des Kolbenweges eine gleichmäſsige. In
Bezug auf die Dichtung der reibenden Flächen gilt hier dasselbe, was früher schon
bemerkt worden ist. Der Schieber a schiebt sich in
Deckelnuthen auf und ab; er schleift auf dem Kolben mittels der schon erwähnten
Schuhe. Die Länge des Kolbens b muſs genau der
Gehäuselänge entsprechen; eine dampfdichte Verbindung beider wird durch Nachstellen
der Deckel oder durch in die Kolbenkopfflächen gelegte Sprengringe bewirkt. Die
Dichtungsleiste c (Fig. 1 Taf.
1) muſs in den Kolben statt in das Gehäuse gelegt werden. Die Zufluſs- und
Abfluſsöffnungen für die Betriebsflüssigkeit liegen entweder in dem Gehäusemantel,
oder im Schieber; durch letztere Einrichtung kann bei Dampf-, Luft- und Gasmotoren
eine Expansionswirkung erzielt werden.
Das System ist als Rotationspumpe schon vor dem 16. Jahrhundert bekannt gewesen (vgl.
das oben S. 52 d. Bd. bereits erwähnte Werk von Ewbank
S. 288.) Es hat zahlreiche Wiedergeburten und Abänderungen erlebt. In D. p. J. ist es als Pumpe und Dampfmaschine unter
folgenden Namen schon veröffentlicht: Rotirende Maschine von T. Hackworth 1837 66 * 247, J. Yule 1837 66 * 328, J. Dickson 1840 76 * 81, L. Heyworth 1840 78 * 409,
Clunes 1851 120 * 180,
W. Hall 1867 183 * 3 und
1871 199 * 4, A. Lemoine
1870 198 * 13, C. Meiſsner
1879 233 * 81.
Unter den neueren Constructionen sind folgende hervorzuheben: Die rotirende
Dampfmaschine von Edg. Cassot in Marseille (* D. R. P.
Kl. 14 Nr. 8145 vom 2. Mai 1879); bei derselben liegt die Einströmung des Dampfes im
Schieber a, welcher durch den Dampfdruck gegen den
Kolben b gedrückt wird. Auf der entgegengesetzten
Fläche des Schiebers sowie auf den Kopfflächen des Kolbens sind Nuthen zur
Herstellung einer Labyrinthdichtung angeordnet. Der Auspuff' liegt neben dem
Schieber im Gehäusemantel. Die Bewegungsumkehrung der Maschine kann durch besondere
Steuerschieber bewirkt werden.
Bei der Dampfmaschine von Ludw. Loewe und Comp. in
Berlin und L. d'Andrée in Riga (* D. R. P. Kl. 59 Nr.
26243 vom 5. Juli 1883) liegt die Dampfeinströmung in einem Gehäusedeckel; derselben
gegenüber besitzt der Kolben einen Kanal, welcher am Umfange des Kolbens ausmündet.
Die Bogenlänge des Kanales bestimmt die Expansion des Dampfes. Der mit einem Schuhe
versehene Schieber wird durch Schraubenfedern gegen den Kolben gedrückt. Der Auspuff
liegt im Gehäusemantel. Die Welle wird durch Stopfbüchsen in den Gehäusedeckeln
geführt, die Last des Kolbens jedoch durch zwei auſserhalb der Maschine liegende
unverhältniſsmäſsig lange Wellenlager aufgenommen.
H. Borgsmüller in Hofstede bei Bochum (* D. R. P. Kl. 14
Nr. 3353 vom 27. April 1878) verbindet Schieber und Kolben zwangläufig, durch auf
die Welle gekeilte, dem Kolben entsprechend geformte Excenter, Excenterstangen und
doppelarmige Hebel, welche letztere sich unter Einschaltung einer Wagenfeder auf den
Schieber legen. Die Umsteuerung der Maschine erfolgt durch Ventile. Zur Ueberwindung
der Todtpunktstellung, welche eintritt, wenn der Schieber ganz in das Gehäuse
hineingeschoben ist und der Kolben zwischen Ein- und Ausströmung steht, ist ein
Schwungrad oder die Kuppelung zweier mit um 180° gegen einander versetzten Kolben
versehenen Maschinen nothwendig. Liegen die Einström- und Ausströmöffnungen im
Gehäusemantel, so ist auſserdem noch eine Vorrichtung zur vorübergehenden
Dampfabstellung nothwendig; dieselbe kann fortfallen, wenn, wie Fig. 24
Taf. 1 zeigt, die Dampfkanäle im Schieber liegen.
Beim Kuppeln zweier mit um 180° gegen einander versetzten Kolben versehenen Maschinen
könnte man die beiden Schieber direkt durch einen
doppelarmigen Hebel mit einander verbinden, wenn die von den Schiebern
zurückgelegten Wege immer den von den Kolben beschriebenen Bogenlängen entsprächen.
Da dies aber nicht der Fall ist, so muſs man entweder Kolben von besonderem
Querschnitte, oder andere Mittel anwenden. Die Zwillingsmaschine von Jos. Zinnecker in Hirschberg in Schlesien (* D. R. P.
Kl. 14 Nr. 1951 vom 7. August 1877) besitzt z.B. zu diesem Zwecke im Querschnitte
elliptische Kolben; auſserdem sind aber zwischen den Schiebern und dem doppelarmigen
Hebel noch starke Schraubenfedern eingeschaltet. Die Schieber besitzen oben und
unten Schuhe. Bemerkenswerth ist die Dichtung der Kolbenkopfflächen mit den
Gehäusedeckeln. Die Kolben sind nämlich auf der Welle lediglich durch Nuth und Feder
befestigt, können sich also nicht gegen dieselben verdrehen, wohl aber der Länge
nach verschieben. Zwischen der einen Kolbenkopffläche und dem Gehäusedeckel ist nun
ein Zwischendeckel angebracht, welcher durch Federn gegen den Kolben gedrückt wird.
Es werden also durch diesen einen Deckel beide
Kolbenkopfflächen gedichtet, vorausgesetzt, daſs die Federn dem Dampfdrucke
widerstehen können. Die Expansion des Dampfes wird durch Muschelschieber bewirkt;
die Umsteuerung geschieht ebenfalls durch Schieber. Die Maschine soll besonders als
Schiffsmaschine Verwendung finden.
Anstatt die Kolben auf eine Welle hinter einander
aufzukeilen, kann man 2 Maschinen auch parallel neben
einander anordnen, so daſs die beiden Wellen derselben parallel zu einander liegen
und auſserhalb der Gehäuse durch Zahnräder mit einander verbunden werden können
(vgl. Fig. 25 Taf. 1). In diesem Falle können die Schieber in die beide Gehäuse
trennende Zwischenwand gelegt werden. Aus einem Stücke dürfen dieselben aus den
früher schon erwähnten Gründen nicht hergestellt werden. Die Andrückung der beiden
Schieber gegen die Kolben besorgen zwischen beide gelegte Federn. Die Dampfeinströmung liegt
in den Schiebern. Eine hiernach eingerichtete Maschine hat G. Voigt in Berlin (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 1877 vom 23. November 1877)
angegeben und erachtet dieselbe sowohl als Motor., Pumpe und Gebläse verwendbar.
Eine interessante neue Ausführung dieses Maschinensystemes ist im Iron, 1883 Bd. 22 S. 504 beschrieben. Die Maschine ist
von J. Pinshbeck in London construirt und wird von Waygood und Comp. in London gebaut. Wie Fig. 1 und
2 Taf. 5 zeigt, wird die Expansion des Dampfes durch den Schieber selbst
bewirkt und zwar durch Oeffnungen, welche sich in dem Walzengelenke des Schuhes und
seines Lagers im Schieber befinden. Der Schieber gleitet in seinem Kasten auf und ab
und erhält den Betriebsdampf durch eine seitliche Oeffnung N, welcher dann je nach der Stellung des Kolbens durch die Schlitze im
Walzengelenke in das Arbeitsgehäuse tritt. Die Dichtung des Schiebers im
Schieberkasten wird durch die Platte y bewirkt, welche
mittels Schrauben je nach Bedarf gegen die eine Schieberfläche gedrückt wird. Die
Schieber werden, wie aus Fig. 2
ersichtlich, zwangläufig auf die Kolben gedrückt; da 2 Maschinen mit um 180° gegen
einander versetzten Kolben vorhanden sind, werden hierzu folgende Mittel
vorgeschlagen: Die Schieber der beiden Maschinen werden nicht direkt durch einen
doppelarmigen Hebel mit einander verbunden, sondern es sind, wie Fig. 2 Taf.
5 zeigt, zwischen Schieber und Hebel Gelenkstangen L
eingeschaltet. Diese stehen am meisten nach rechts, wenn die Schieber die höchste
bezieh. tiefste Stellung einnehmen; zwischen Hebel und Schieber bestehen dann die
kürzesten Entfernungen. Haben sich die Kolben um ungefähr 90° gedreht, so sind die
Schieber, da die Stangen L nun lothrecht stehen, am
weitesten von dem Hebel K entfernt, worauf bei
fortgesetzter Drehung die umgekehrte Wirkung eintritt. Hierdurch soll es ermöglicht
werden, trotz der ungleichen Wege, welche die beiden Schieber und Kolben
zurücklegen, doch erstere zwangläufig mit einander zu verbinden. Eine Maschine von
222mm Gehäusedurchmesser und 379mm Länge soll nach Messung mit einem Dynamometer
8e ergeben haben.
Einen anderen (früher schon von Johnson und Gill 1870 196 * 106
angedeuteten) Weg, Kolben und Schieber direkt zwangläufig mit einander zu verbinden,
zeigen J. Simmons und J.
Whitley in New-Cross bezieh. in Leeds (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 1241 vom 19.
December 1877). An den im Schieber Fig. 3 Taf.
5 gelagerten Schuh ist ein cylindrischer Mantel befestigt, welcher den gleichfalls
cylindrischen Kolben genau umschliefst, im Uebrigen aber die gleiche Länge wie jener
hat. Die Excentricität des Kolbens ist nun so gewählt, daſs bei der Drehung
desselben sich der Kolbenmantel und das Gehäuse immer in einer Linie berühren. In
dieser Form kann die Maschine sehr wohl als Pumpe Verwendung finden. Um diese auch
zu chemischen Zwecken benutzen zu können, soll dieselbe
aus Vulkanit, Porzellan, Glas o. dgl. hergestellt werden. An dieser Maschine kann
man natürlich auch die vorher erwähnte Expansionsvorrichtung anbringen. Eine
derartig construirte einfache und Zwillings-Maschine ist in der Patentschrift
beschrieben.
Bei Maschinen mit nahezu gleichmäſsiger Kraftäuſserung braucht man keine zwangläufige
Führung der Schieber, wenn der Kolben nicht plötzlich in seine Nabe übergeht (vgl.
den punktirten Kolbenquerschnitt in Fig. 24
Taf. 1). Der Schieber wird dann durch den Kolben selbst zurückgedrückt und durch den
Dampfdruck oder andere Mittel wieder vorgeschoben. (Vgl. auch die Maschinen von White 1837 64 * 161, Beale 1841 81 * 262, Rüssel 1838 67 * 332 und Davies 1849 112 * 401.) Zu
dieser Gruppe gehört auch die Maschine von C. Blank in
Köln (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 256 vom 12. August 1877), welche zwei sich diametral
gegenüber stehende Kolben und zwei durch Dampf angedrückte Schieber besitzt. Der
Dampfeinlaſs erfolgt durch diese hindurch, während der Dampfauslaſs im Gehäusemantel
liegt. Auſserdem sind noch Expansionsventile vorgesehen, welche von der
Maschinenwelle aus bethätigt werden. Die Kolben werden durch mittels Federn
angedrückte Zwischendeckel gedichtet. Bezüglich der Stellung der Kolben zu einander
mag darauf hingewiesen werden, daſs es unzweckmäſsig ist, dieselben einander gerade
gegenüber anzuordnen, da dann beide gleichzeitig den
todten Punkt durchlaufen. Läſst man die beiden Kolben einen kleineren Winkel als
180° einschlieſsen, so dreht der eine den anderen über den Todtpunkt hinweg.
Besitzen die Kolben eine plattenförmige Gestalt, wie z.B. bei der Dampfmaschine von
Gallahue (1875 216 *
389) und dem rotirenden Gebläse von Newton (1860 155 * 174), so müssen die Schieber zwangläufig bewegt
werden. E. Genty und J.
Deschamps in Rouen (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 3713 vom 5. Juli 1878) bewirken
dies z.B. durch auf die Maschinenwelle gekeilte Curvenscheiben, welche durch
Zugstangen direkt an die in den Schieberkasten geführten Schieber angreifen; an den
Curvenscheiben sind Federn angeordnet, um einen sanften Schluſs der Schieber gegen
die Kolben zu bewirken. Diese Maschine besitzt einen Kolben und zwei Schieber; dem
entsprechend findet der Dampfeinlaſs durch die Hohlwelle und den Kolben statt;
auſserdem sind zwei von der Maschinenwelle beeinfluſste Auslässe vorhanden.
Bemerkenswerth ist die Dichtung des Kolbens und der Schieber; dieselbe wird durch
kupferne Stulpen von winkelförmigem Querschnitte (⌟) bewirkt, deren einer Schenkel
auf dem Kolben oder dem Schieber befestigt ist, während der andere gegen die
Gehäusewand durch Federn (auch durch den Dampfdruck allein) angedrückt wird. – Bei
der durch Zusatzpatent * Nr. 9272 vom 19. September 1879 geschützten Anordnung
gelangt der Dampf durch die Schieber in die Maschine und tritt durch die Hohlwelle
aus. Behufs Erzielung einer Expansion des Dampfes sind noch besondere Einlaſs- und
Auslaſshähne angeordnet, deren Oeffnung und Schlieſsung durch einen
Centrifugalregulator geregelt wird.
Bei dem rotirenden Motor von Fr. W. Zimmermann in Köln
(* D. R. P. Kl. 59 Nr. 13 534 vom 22. August 1880) erfolgt die Bewegung des einen Schiebers durch Wellenexcenter, welche auf
federnde Schubstangen einwirken, die in das äuſsere Schieberende eingreifende
Zahnbogen drehen. Zur Ueberwindung des Todtpunktes sind drei mit um 120° gegen
einander versetzten Kolben versehene Maschinen mittels einer gemeinschaftlichen
Welle gekuppelt.
W. D. Rondi in Duisburg (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 7486 vom
19. April 1879) läſst die Schieber den Kolben mittels zweier Arme umfassen, die an
ihren Enden mit Laufrollen versehen sind, welche inin in die Kolbenkopfflächen eingearbeitete Führungsnuthen eingreifen. Die
Maschine nimmt in diesem Falle nur sehr wenig Raum ein. Bei der in der Patentschrift
erläuterten Maschine geschieht der Dampfeinlaſs durch eine der Wellenstopfbüchsen
und durch Kolbenkanäle hindurch. Je nachdem ein auf der Welle sitzender
Kreisschieber gedreht wird, erfolgt dieser Einlaſs auf der rechten oder linken Seite
des Kolbens und ändert sich demgemäſs auch die Drehungsrichtung der Maschine. Der
Auslaſs des Dampfes liegt in der anderen Wellenstopfbüchse; er wird durch einen
besonderen, im Kolben angeordneten Kolbenschieber geregelt, welcher mittels eines
Zapfens durch eine in einen Gehäusedeckel eingearbeitete Curvennuth geführt wird;
die Dichtung des Kolbens gegen die Gehäusedeckel erfolgt durch in erstere eingelegte
Sprengringe von -förmigem Querschnitte, welche durch Schraubenfedern nach
auſsen gegen die Gehäusedeckel gepreſst werden.
An der Maschine von C. F. Döring und J. Udelhoven in Witten a. d. R. (* D. R. P. Kl. 14 Nr.
2126 vom 12. December 1877) ist nur die Bewegungsumkehr und Expansionsvorrichtung
erwähnenswerth. Dieselbe besteht aus durch Excenter bewegten Schiebern. Nebenbei sei
auch bemerkt, daſs die Kolben seitliche Flanschen vom Durchmesser des Gehäuses
besitzen, zwischen welchen der eigentliche Kolbenkörper liegt und sich die Schieber
auf- und abbewegen. Man kann auf diese Weise 2 Maschinen neben einander aufstellen,
so daſs 2 Kolben auf einer gemeinschaftlichen Welle sitzen, ohne daſs eine
Trennungswand zwischen beiden liegt; nur muſs in diesem Falle eine gute Dichtung
zwischen Flanschenumfang und Gehäusemantel vorgesehen sein, welche durch in ersteren
eingelegte Sprengringe bewirkt wird.
(Schluſs folgt.)