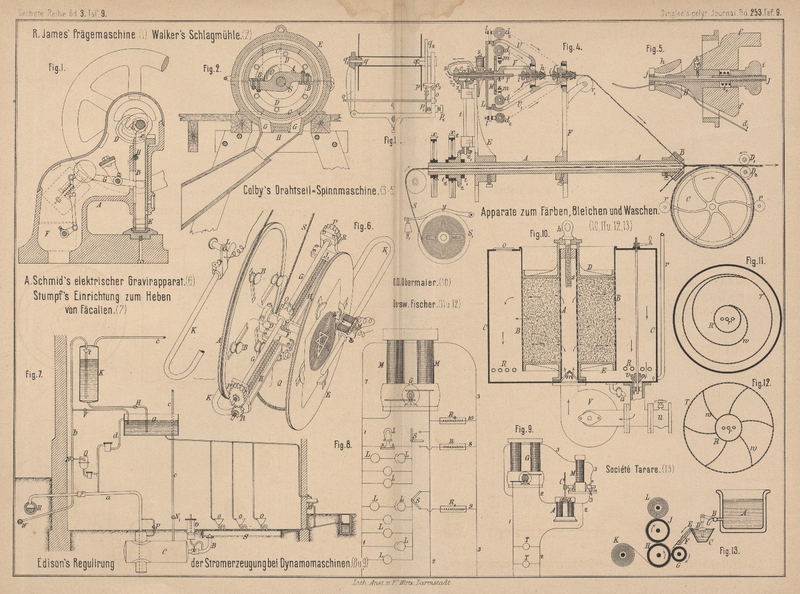| Titel: | Ch. Colby's Drahtseilmaschine. |
| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 112 |
| Download: | XML |
Ch. Colby's Drahtseilmaschine.
Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 9.
Ch. Colby's Drahtseilmaschine.
Die Anfertigung der Drahtseile erfolgt mittels der von Ch.
Colby in Stanstead, Canada (* D. R. P. Kl. 73 Nr. 25908 vom 24. April 1883)
angegebenen Maschine nach dem jetzt ziemlich allgemein verlassenen Verfahren derart, daſs Litze und
Seil gleichzeitig zugeschlagen werden, während sonst gewöhnlich die Litzen für sich
angefertigt und dann erst zum Seile vereinigt werden. Auſserdem sind, wie aus dem
nebensehenden Querschnitte hervorgeht, die Litzen doppelt geschlagen.
Textabbildung Bd. 253, S. 113
Die in Fig. 4 Taf. 9 im Längenschnitte dargestellte Maschine besteht demnach,
entsprechend der Zahl der Litzen, welche das Seil erhalten soll, aus 6, 7 oder mehr
einzelnen Litzenmaschinen, welche zwischen den auf der Hohlwelle A festgekeilten Armsystemen E und F gehalten werden und von denen in der
Abbildung nur eine dargestellt ist. Da jede Litze aus zwei über einander gewickelten
Drahtschichten bestehen soll, so ist jede Litzenmaschine doppelt. Es sind nämlich
auf die concentrischen Hohlachsen T und e die Scheiben M und L aufgebracht, von denen die erstere die Spulen d1 für die inneren, die
andere die Spulen d2
für die äuſseren Litzendrähte trägt. Diese Spulen sind zwischen Gabeln o gelagert, welche auf die Stifte m bezieh. l aufgesteckt
und durch eine Klemmschraube festgehalten werden sollen. Der eine Schenkel o1 (Fig. 3)
einer jeden Gabel ist um ein Gelenk drehbar und kann durch den federnden Bügel o2 in seiner Lage
erhalten werden. Wird dieser gegen das Gelenk hin gebogen, so läſst sich der
Schenkel o1 so weit
abbiegen, daſs die Spule eingehängt und zwischen den vierkantigen, auf den Zapfen
q1 drehbaren Köpfen
q gefaſst werden kann, worauf durch Zurückfahren
des Bügels o2 in seine
alte Lage der Schenkel o1 festgestellt wird. Mit dem am festen Schenkel gelagerten Kopfe q ist eine Bremsscheibe q2 verbunden, auf welche ein auf einen
Stift o3 des festen
Schenkels o gehängter Bremsbacken p mittels der gegen die Feder p1 drückenden Stellschraube p2 mehr oder weniger
fest angepreſst wird, wodurch sich die Spannung der Drähte leicht reguliren
läſst.
Mit den Scheiben L und M
sind durch die Bügel U und U1 bezieh. V
die Drahtführungen verbunden, von denen eine in Fig. 5 Taf.
9 besonders herausgezeichnet ist. Die Arme U und U1 bezieh. V tragen Kegel f, welche
entsprechend der Anzahl der Litzendrähte eingetheilt sind und diese Drähte
zusammenleiten, so daſs dieselben dann, indem sie über den Kegel H hin durch die Hülse h zu
dem Sterne j geführt werden, sich um die durch das Rohr
J gezogene, von der Spule s1 (vgl. Fig. 4)
abwickelnde Seele s schlingen. Die Hülse h ist auf dem Rohre J
befestigt, welches sich in dem Kegel H verschieben
kann, an der Drehung aber durch die in einen Längsschlitz tretende Stellschraube h1 gehindert ist. Die
Hülse h wird durch eine in der Bohrung des Kegels f liegende und durch die Mutter i stellbare Spiralfeder i1 immer gegen den Kegel H gezogen und preſst dadurch auf die hindurchgehenden Drähte, so daſs
dieselben unmittelbar vor dem Zusammenwinden nochmals gespannt werden. Dadurch
kommen die Drähte auch an drei Stellen – dem Sterne j, der Hülse h und dem Kegel H – zur
Anlage, so daſs alle etwa in dem Drahte noch befindlichen kurzen Biegungen
ausgerichtet werden. Die fertigen Litzen gelangen dann über Rollen r1 (Fig. 4) zu
dem auf das Rohr A gesteckten Sterne B und werden bei der Drehung der Achse A um die durch das Rohr A
laufende Haupt-Hanfseele S herumgewunden. Die Seele S wickelt sich von einer Rolle S1 ab, welche durch den mit Gewicht y1 belasteten Hebel y gebremst wird.
Das fertige Drahtseil wird von der Trommel C abgezogen,
läuft mehrere Male um dieselbe und tritt dann zwischen die beiden fest gegen
einander gepreſsten, der Dicke des Seiles entsprechend hohl ausgedrehten Rollen D1 und D2, wo es zur Erhöhung
der Dichtigkeit und Gleichmäſsigkeit zusammengedrückt wird. Das Seil erhält dabei
etwas gröſsere Länge und müssen deshalb die Rollen D1 und D2 eine entsprechend gröſsere Umfangsgeschwindigkeit
als die Trommel C besitzen. Da sich das Seil in
Schraubenwindungen auf die Trommel C legt, die Auf- und
Abwickelung aber stets an derselben Stelle erfolgt, müssen die einzelnen Seillagen
auf der Trommel verschoben werden. Zu diesem Zwecke sind zu beiden Seiten der
Trommel C Kegelrollen r
angeordnet, deren kleinerer Durchmesser unten liegt und welche daher die Seillagen
etwas schräg von unten fassen, so daſs die Drähte nicht so leicht beschädigt und
abgescheuert werden, als wenn die einzelnen Windungen auf der Trommel C allein durch das auflaufende Seil verschoben werden
müſsten.
Die Hauptachse A wird durch das auf derselben
festgekeilte Rad x1
angetrieben, während die Scheiben M und L der Litzenmaschinen, von dem zwischen den Stellringen
t1 und t2 lose auf der Achse
A drehbaren und durch ein Stirnrad x2 bethätigten
Kegelrade z aus unter Vermittelung des Rades z1 der Welle t und der Kegelräder z2 bis z4 Drehung in entgegengesetzter Richtung erhalten.
Sollen die äuſseren- und inneren Drähte der Litzen nach derselben Richtung gewunden
werden, so wird das Rad z3 entfernt und durch die Schraube e1 die Achse T der
Scheibe M in der Achse e
der Scheibe L festgeklemmt.
Es muſs auffallen, daſs hier gar nicht dafür gesorgt ist, die Verdrehung der
einzelnen Drähte beim Zuschlagen der Litzen wieder aufzuheben, während doch, um ein
festes Anliegen der Litzendrähte zu erzielen, dieselben nur im Kreise herumgeführt
werden dürfen, ohne hierbei eine eigentliche Drehung zu erhalten. (Beim Zuschlagen
von Seilen auf der Bahn erhalten die einzelnen Drähte oder Litzen meistens sogar
eine geringe entgegengesetzte Drehung.) Die Maschine scheint daher auch eher für die
Anfertigung von Hanfseilen geeignet, bei welchen dieser Umstand nicht so ins Gewicht fälltfälllt; doch ist in der Patentschrift dieselbe ausdrücklich als zur Anfertigung
von Drahtseilen oben beschriebener Art, mit doppelten
Litzen, bestimmt angegeben.
Tafeln