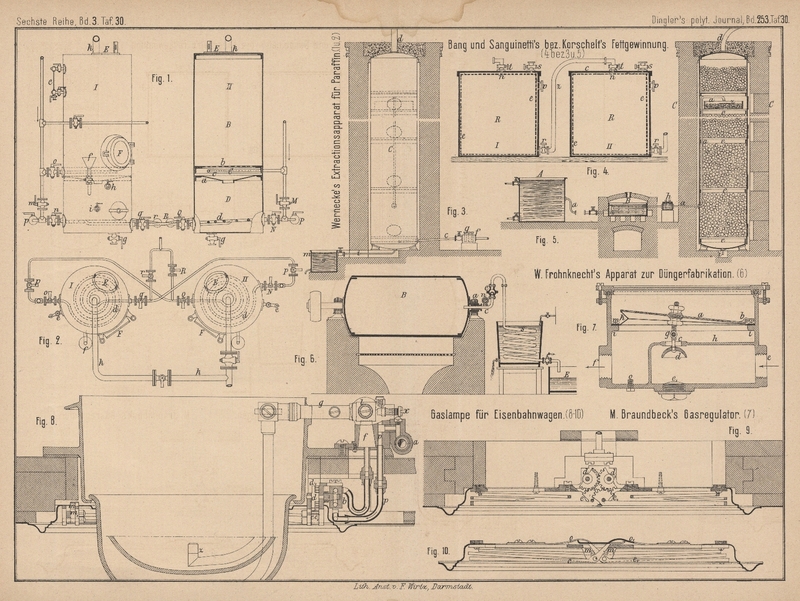| Titel: | Zur Gewinnung und Verarbeitung von Fetten. |
| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 415 |
| Download: | XML |
Zur Gewinnung und Verarbeitung von
Fetten.
Patentklasse 23. Mit Abbildungen auf Tafel 30.
Zur Gewinnung und Verarbeitung von Fetten.
I. A. Bang und Ch. A.
Sanguinetti in Marseille (Oesterr.-Ungarisches Patent vom 5. Juli 1883)
verwenden zum Entfetten von Sesamkörnern, Mais u. dgl.
den bei 40 bis 70° siedenden Antheil des Erdöles, welcher wiederholt mit
Schwefelsäure von 66° B., dann mit 2 bis 3 Proc. rauchender Schwefelsäure
geschüttelt wird. Die durch Abgieſsen erhaltene Flüssigkeit soll weder in dem damit
erhaltenen Oele, noch in dem Samen eine Spur riechender Stoffe zurücklassen.
Die gemahlenen Samen kommen in einen Korb e (Fig.
4 Taf. 30) aus Metallgeflecht, welcher mit abhebbarem Deckel n und zwei Griffen versehen ist, womit der Korb in den
Kessel R gebracht wird. Nachdem der Deckel c dicht aufgesetzt ist, läſst man das reine Benzin
durch den Hahn t eintreten, während durch s die Luft entweicht, bis man am Flüssigkeitszeiger v erkennt, daſs der Behälter gefüllt ist.
Nach etwa 15 Minuten saugt man die Benzinlösung in einen folgenden, mit frischem
Samen gefüllten Apparat II. Zu diesem Zwecke wird der
Hahn s dieses Apparates mit einem Behälter verbunden,
in welchem die Luft vorher verdünnt worden ist, und ebenso der Hahn r des Apparates I durch
ein Metallrohr mit luftdichter Flanschenverbindung mit dem Rohre z des Apparates II. Nun
werden die beiden Hähne s und t von l geöffnet und man läſst die
Luftverdünnung wirken. Das flüssige Gemenge von Oel und Benzin tritt aus dem
Apparate I nach II über,
wo man wieder durch ¼ Stunde die Einsaugung und Diffusion sich vollziehen läſst. In
I wird von Neuem Benzin aufgefüllt, welches wieder
durch 15 Minuten mit den zermahlenen Samen in Berührung bleibt. Unterdessen ist ein
dritter Apparat mit zermahlenen Samen gefüllt worden, in welchen man dann das schon
viel Oel enthaltende Gemenge von Oel und Benzin übertreten läſst. Wenn II dadurch geleert ist, läſst man wieder die
Flüssigkeit aus I dahin übertreten. Auf diese Weise
geht es fort zu einem 4., 5., 6. Apparate, bis man in Folge der in jedem derselben
wirkenden Diffusion reines oder beinahe reines Oel erhält, d.h. solches, welchem
kein Benzin mehr beigemengt ist. Man soll dieses Ergebniſs mittels einer Batterie
von 10 Diffuseuren erreichen.
Sind die Samen im ersten Apparate völlig entölt, so wird der Hahn r desselben mit einem Kühler verbunden und der Hahn s mit einem metallenen Schlangenrohre, welches in einem
heiſsen Oel- oder Chlorcalciumbade liegt. Durch diese Schlange läſst man die Dämpfe
einer kleinen Menge Benzin treten, welches in einer Destillationsblase abdestillirt
wird. Beim Durchstreichen durch das Schlangenrohr erhitzen sich diese Dämpfe bis auf
120 oder 130° und treten dann in diesem Zustande zu den mit flüssigem Benzin
getränkten Samen. Der erstere Theil der Dämpfe wird condensirt und erhitzt dabei die
ganze Masse. Ist dieselbe durch die überhitzten Dämpfe genügend erwärmt, so wird das
die Samenmasse durchtränkende Benzin flüchtig und entweicht durch den Hahn r, um sich in dem vorgelegten Kühler wieder
niederzuschlagen und von dort in den allgemeinen Sammelbehälter abzuflieſsen.
Erkennt man an einem vorhandenen Thermometer, daſs die Temperatur in einem Apparate
über den Siedepunkt des in Verwendung stehenden Benzins steigt, so kann man
annehmen, daſs alles Benzin, welches die Samenmasse durchtränkte, verflüchtigt ist.
Der Strom überhitzter Benzindämpfe wird nun abgeschnitten und man entnimmt die
Samenmasse dem betreffenden Kessel in Form eines vollkommen trockenen Mehles. Will
man alle Spuren von Benzin aus diesem Mehle entfernen, so braucht man nur einen
Strom trockenen Wasserdampfes hindurchtreten zu lassen.
Nach O. Korschelt in Dresden (* D. R. P. Nr. 27321 vom
4. September 1883) ist beim gewöhnlichen Verfahren zur Verseifung von Fetten durch überhitzten Wasserdampf die Temperatur genau
zwischen 310 und 315° zu halten. Bei höherer Temperatur wird Glycerin zersetzt, bei
niedererer geht die
Zerlegung des Fettes zu langsam vor sich. Die Temperatur kann aber zwischen weiteren
Grenzen schwanken, wenn das Fett fein vertheilt dem Dampfe ausgesetzt wird.
Das zu zersetzende Fett wird zu diesem Zwecke in einem Behälter A (Fig. 3 und
5 Taf. 30) auf 100° erwärmt und geht von da in ein schmiedeisernes Rohr
a, welches mit vielen Windungen in einem Metallbade
B liegt. Letzteres besteht aus einem starken
Eisenbehälter, in welchem Blei oder auch eine Blei-Zinnlegirung (am besten eine bei
290° schmelzende Legirung von 100 Th. Blei mit 6 oder 4 Th. Zinn) in geschmolzenem
Zustande oder in einer nur wenig über den Schmelzpunkt hinausgehenden Temperatur
erhalten wird. Das Oel tritt mit ungefähr 300° aus dem Metallbade aus und gelangt in
den Thurm C, in welchem die Zersetzung vor sich geht.
Dieser Thurm ist aus Blechen oder guſseisernen Platten zusammengesetzt, unter
Belassung einer isolirenden Luftschicht mit Mauerwerk umgeben und mit auf Rosten e liegenden gebrannten Thonkugeln u. dgl. angefüllt.
Das heiſse Oel wird entweder bei entsprechender Höhenlage des Behälters A durch eigenen Druck oder mittels einer zwischen
diesem Behälter und dem Metallbade B eingeschalteten
Pumpe durch das im Inneren des Thurmes aufsteigende Rohr a in die Höhe gedrückt und flieſst durch das nach der Mitte des Thurmes
und nach unten umgebogene Ende dieses Rohres auf einen Vertheiler n aus. Dieser besteht aus einer mit Rand versehenen
durchlöcherten Platte von etwas kleinerem Durchmesser als derjenige des Thurmes, so
daſs zwischen den Wandungen des letzteren und dem Rande der Platte noch einige
Centimeter freier Raum bleibt. Behufs gleichmäſsiger Vertheilung des Oeles sind
entweder in die Löcher der Platte kurze, nach unten und oben sich trichterartig
erweiternde Röhrchen eingesetzt, oder die Platte wird mit einer Schicht von
kleineren Ziegelbrocken und darauf mit mehreren Schichten allmählich feiner
werdenden gewaschenen Sandes bedeckt. Um ein Wegspülen des letzteren zu vermeiden,
wird auf denselben an der Stelle, wo das Oel ausflieſst, noch eine kleinere Platte
z aufgelegt. Aus diesem Vertheiler ergieſst sich
das Oel in der ganzen Weite des Thurmes über die Thonkugeln und flieſst an diesen
herunter, kommt dabei mit dem von unten durch ein Rohr c in den Thurm eingeleiteten aufsteigenden überhitzten Dampfe innig in
Berührung, wodurch die Zerlegung der Glyceride in freie Fettsäuren und Glycerin vor
sich geht, welche Zersetzungsproducte mit dem Dampfe durch das Abzugsrohr d nach einem passenden Kühler abgeführt werden.
In das den überhitzten Dampf zuführende Rohr c ist ein
Kasten f eingeschaltet, in welchen zwei oder mehrere
oben offene und unten verschlossene Röhren g eingesetzt
sind; von diesen ist die eine mit Blei (Schmelzpunkt 334°), die zweite mit einer
Legirung von 100 Th. Blei mit 6 Th. Zinn (Schmelzpunkt 289°) und eine dritte mit
Zink (Schmelzpunkt 412°) angefüllt, so daſs eine Beobachtung dieser Röhren genügende
Anhaltspunkte zur
Abschätzung der Temperatur des in den Thurm strömenden Dampfes ergibt. Eine
entsprechende Vorrichtung h ist in das Oelrohr a eingeschaltet. Die Temperatur im Thurme selbst kann
innerhalb der weiten Grenzen von 250 bis 400° schwanken; es ist jedoch gut, dieselbe
nicht unter 280° sinken zu lassen, da dann die Zersetzung sich mehr und mehr
verzögert, während dieselbe bei höheren Temperaturen immer beschleunigter vor sich
geht, so daſs mit derselben Menge Dampf gröſsere Mengen der Zersetzungsproducte
abgeführt werden.
Der Zufluſs des Oeles wird so geregelt, daſs nur wenig oder kein unzersetztes Oel
unten im Thurme anlangt. Das sich dort etwa sammelnde Oel wird durch das Rohr i abgeleitet, geht durch die Schlange s im Kühlgefäſse m und
läuft in einen Sammelbehälter ab. Wird mit einem bei gewöhnlicher Temperatur festen
Fette gearbeitet, so läſst man durch das Ausfluſsrohr i
etwas Dampf mit durchtreten, oder bringt das Kühlwasser in sonst geeigneter Weise
auf den erforderlichen Wärmegrad.
Soll das Verfahren unter Luftleere vorgenommen werden, so bringt man die Vacuumpumpe
hinter den Kühlapparaten an und müssen dann die sich in letzteren verdichtenden
Zersetzungsproducte mittels besonderer Pumpen abgezogen werden.
Tafeln