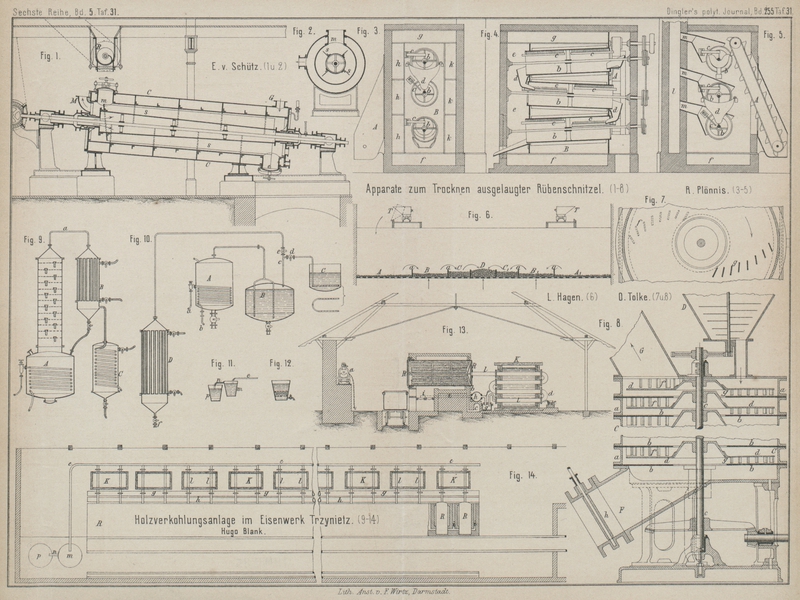| Titel: | Holzverkohlungsanlage von Hugo Blank in Trzynietz. |
| Autor: | O. G. |
| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 435 |
| Download: | XML |
Holzverkohlungsanlage von Hugo Blank in
Trzynietz.
Mit Abbildungen auf Tafel
31.
H. Blank's Holzverkohlungsanlage.
Prof. Wilh. Sóltz in Schemnitz veröffentlicht in den Bányászati és Kohászati lapok (Berg- und
Hüttenmännische Blätter), 1884 S. 171 im Verlaufe eines längeren Reiseberichtes auch
seine Wahrnehmungen bei einem Besuche der Holzverkohlungsanlage in Trzynietz
(Oesterr.-Schlesien), welche deshalb von allgemeinerem Interesse sind, weil die
Anlage gegenüber den englischen manche Verschiedenheiten zeigt und eine Verwerthung
aller Nebenerzeugnisse anstrebt.
Die in Fig. 9
bis 14 Taf.
31 dargestellte Anlage ist auf eine jährliche Verarbeitung von 18000cbm Holz eingerichtet, zu welchem Zwecke 22
Cylinder oder Retorten R neben einander eingemauert
sind; dieselben sind aus Schmiedeisen – 2m,5 lang
und 1m im Durchmesser – und besitzen eine
guſseiserne Thür und einen an einer Stange mit Oehr befestigten falschen Boden aus
Schmiedeisen, welcher behufs Entleerung der Beschickung durch den Laufkrahn a herausgezogen wird, wobei die Kohle in auf
Schienenwagen stehende Blechkästen fällt. Der falsche Boden ist mit 2 bis 3cm weiten Löchern versehen, damit die
Destillationsgase leichter abziehen können. Die Retorten sind eingemauert; die
Feuerung streicht um dieselben herum, zieht sodann durch den Kanal b in den gemeinsamen Kanal c und von hier in den Schornstein. Aus Fig. 14 ist ersichtlich,
daſs je zwei Retorten mit einer Kühlvorrichtung K
verbunden sind, in welche die Destillationsgase durch eine am hinteren Deckel der Retorte befestigte
Röhre l gehen. Die Destillationsproducte flieſsen durch
die kleinen Seitenröhren d in die gemeinsame Rinne e, die nicht verflüssigten Gase aber bei f in einen gemeinschaftlichen Behälter g und von dort durch 2 oder 3 Röhren in die Sammelröhre
h, von wo die Gase durch die in das Mauerwerk
eingefügten Kanäle i unter die Feuerung gehen. Die
Retorten haben angeblich nur eine Dauer von 9 bis 18 Monaten (in England halten
schmiedeiserne Cylinder 6 Jahre, solche aus Guſseisen 15 Jahre lang aus). Zur
Verkohlung von 250k Holz werden 100k Steinkohle benöthigt, die Temperatur wird auf
350 bis 400° erhalten und die Kohlungsdauer beträgt 8 bis 12 Stunden.
Sobald die glühende Kohle in den vorgestellten Kasten gefallen ist, wird dieser mit
einem eisernen Deckel verschlossen, die Fugen mit Lehm verschmiert und die Kasten
sammt den Wagen 24 Stunden lang in der Kühlkammer stehen gelassen.
Die verflüssigten Destillationsproducte gehen aus dem Sammelkanale e in den Bottich m (Fig. 11), von
hier durch den Ueberlaufkanal n in den tiefer stehenden
Bottich p. In diesen beiden Bottichen hat sich der
gröſste Theil des Theeres wohl schon abgesetzt; damit dies jedoch vollkommener
erfolge, wird die oben stehende Flüssigkeit mittels Dampfpumpe in einen höheren
Behälter abgezogen, von wo dieselbe in ähnlicher Weise wie früher in einen zweiten
und schlieſslich in einen dritten Bottich (Fig. 12) abgelassen wird,
welcher aber in seiner Mitte einen eng gelochten, mit klaren Kokes gefüllten
Doppelboden besitzt.
Behufs Gewinnung von Essigsäure, Aceton, Allyl und Methylalkohol wird das vom Theere
vollständig befreite Wasser in den 20 bis 30hl
fassenden, kupfernen Destillationskessel A (Fig. 10)
gebracht und darin mit bei a ein- und bei b austretendem Dampfe von 3 bis 4at Druck durch eine Schlange erhitzt. Das kupferne
Ableitungsrohr der Destillirblase führt in einen luftdicht verschlossenen
Kupferkessel B, wo es sich in zwei Theile abzweigt, die
mit feinen Löchern versehen sind. Aus diesem Kessel führt wieder ein bei c sich verzweigendes Kupferrohr; der eine Zweig geht in
den offenen Kupferkessel C, auf dessen Boden er in
U-Form mit feinen Löchern mündet; der zweite Zweig führt in den kupfernen
Röhrenkühler D. Die Kessel B und C sind zur Bindung der Essigsäure mit
Kalkmilch gefüllt. Sobald die Flüssigkeit in A
verdampft, wird die übergehende Essigsäure von der Kalkmilch in B gebunden und bildet essigsauren Kalk; die anderen
Destillationsproducte gehen nach Abschluſs des Hahnes d
und Oeffnung des Hahnes e in den Kühler D, von wo sie vollständig verdichtet bei f abgelassen werden; das Ergebniſs ist Wasser, Aceton,
Allyl und Methylalkohol. Nachdem die letzteren sehr flüchtig sind und nach
Abdampfung der ersten 10 Procent des Inhaltes von A
auch diese vollständig entweichen, so ist es nothwendig, daſs, wenn die gesammte
Kalkmilch in B schon burch Essigsäure gebunden wäre und
sich noch essigsaure Dämpfe zeigten, diese durch Schlieſsen des Hahnes e und Oeffnen von d in den
Kessel C gelangen, um da vollständig gebunden zu
werden.
Die in B und C gebildete
Lösung von Calciumacetat wird sodann in eisernen Vorwärmern und Abdampfgefäſsen über
freiem Feuer, oder in treppenförmig über einander gestellten, mit Blei gefütterten
Holzgefäſsen durch Dampfschlangen so lange concentrirt, bis sich auf der Oberfläche
Salzschichten zeigen. Um das so ausgeschiedene Salz von den anhaftenden
Theerbestandtheilen zu befreien, wird es durch die Ueberhitze der
Dampfkesselfeuerung vorsichtig erhitzt bezieh. geglüht. Soll vollkommen reines
Calciumacetat gewonnen werden, so wird das calcinirte Rohsalz durch Lösung und
Krystallisation gereinigt.
Will man bloſs Essigsäure darstellen, dann wird das Calciumacetat mit Salzsäure
aufgeschlossen (auf 100 Th. Salz kommen 90 bis 95 Th. HCl von 1,16 sp. Gew.) und in
kupfernen Gefäſsen destillirt; das Kühlgefäſs wird am besten aus Zinn hergestellt.
Zur Darstellung chemisch reiner Essigsäure ist Natriumacetat zu nehmen.
Die Abscheidung des Acetons, Allyls und Methylalkohols vom Wasser und von einander
beruht auf der Verschiedenheit ihrer Siedepunkte und erfolgt deshalb durch
fractionirte Destillation, welche in Trzynietz in einer dem Savalle'schen Colonnenapparate ähnlichen, stetigen
Destillationsvorrichtung Fig. 9 stattfindet. Die zu
destillirende Flüssigkeit kommt in den mit Dampf erwärmten, nach oben in einen
thurmartigen Aufsatz endigenden Kessel A, welcher durch
eine Anzahl Kupfersiebe in mehrere Colonnen getheilt ist; die aufsteigenden Dämpfe
ziehen durch die Siebe und scheiden die leichter sich niederschlagenden
Wassertheilchen ab, welche sodann auf den einzelnen Sieben eine Wasserschicht von
bestimmter Höhe bilden. Indem die Dämpfe durch diese Wasserschicht hindurchgehen
müssen, werden dieselben noch mehr entwässert, bis die Dämpfe durch das Rohr a in den Röhrenkühler (Dephlegmator) B gelangen. Die in demselben verdichtete, noch Wasser
enthaltende Flüssigkeit wird nach A zurückgebracht,
während die dampfförmigen alkoholischen Bestandtheile sich im Kühler C verdichten und, je nach ihrem Siedepunkte zu
verschiedener Zeit, zuerst Aceton, dann Methylalkohol und zuletzt Allylalkohol bei
der Ausströmung abflieſsen.
Diese Trzynietzer Anlage bietet ein Beispiel für die Vortheile der Retortenverkohlung
und ihrer Ertragsfähigkeit unter solchen Verhältnissen, wo die Nebenerzeugnisse
verwerthet werden können. Bei dem stets gröſser werdenden Mangel an billiger
Holzkohle bereitet dieses Verfahren in Gegenden mit groſsen Wäldern und reichen
Eisenerzlagern eine Umwälzung vor, welche von wesentlichem Einflüsse auf die
Concurrenzfähigkeit mancher Werke sein wird. Es werden jedoch noch Erfahrungen
darüber zu sammeln sein, in wie fern die so gewonnene Holzkohle die Meilerkohle
vollständig ersetzen kann; diesbezügliche Versuche mit Trzynietzer Kohle auf dem Erzherzog Albrecht'schen Werke in der Bindt (Zips) haben solche Bedenken nicht unbegründet
erscheinen lassen.
O. G.
Tafeln