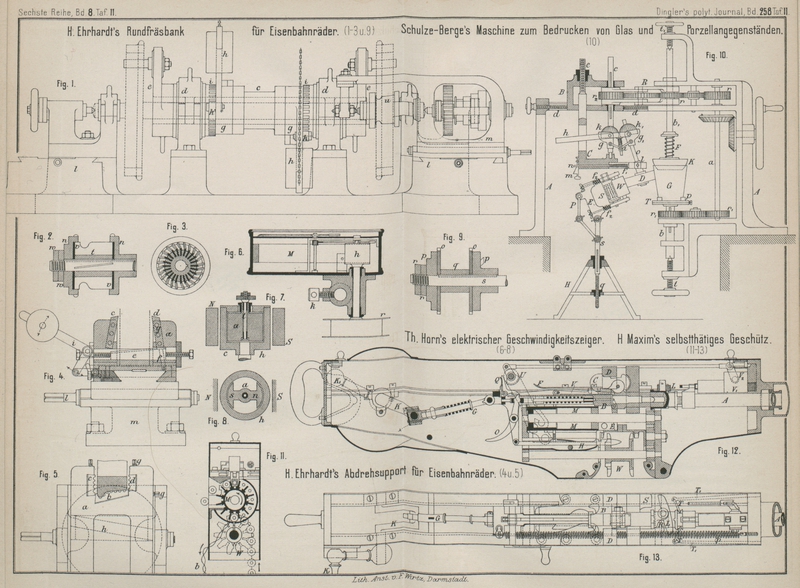| Titel: | P. Schulze-Berge's Verfahren und Maschine zum Bedrucken von Glas- und Porzellangegenständen. |
| Autor: | R. |
| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 154 |
| Download: | XML |
P. Schulze-Berge's Verfahren und Maschine zum
Bedrucken von Glas- und Porzellangegenständen.
Mit Abbildung auf Tafel
11.
P. Schulze-Berge's Druckmaschine für Glasgegenstände u.
dgl.
Um Gläser, Tassen, Lampenschirme und ähnliche runde Gegenstände, von welchen eine
groſse Zahl mit dem gleichen Muster auszuschmücken sind, in diesem Muster zu
bedrucken, hat P. Schulze-Berge in New-York
(Nordamerikanisches Patent Nr. 316836 vom 26. April 1885) eine Maschine angegeben,
bei deren Anwendung eine groſse Billigkeit in der Herstellung namentlich einfarbiger
Muster zu erzielen ist.
Bei dem jetzt gebräuchlichen Verfahren zum schnellen Bemalen runder Gegenstände mit
Hilfe von Schablonen, wie auch bei dem Bedrucken (vgl. Koppe 1878 229 * 547) tritt der Umstand
erschwerend auf, daſs die Gegenstände, wenn sie auch mit der gleichen Form erzeugt
wurden, nach dem Brennen doch verschiedene Durchmesser zeigen. Die Enden der
Schablone passen dann beim Auflegen auf den zu bemalenden Gegenstand nicht immer
zusammen und das Muster der Druckwalze geht nicht vollkommen auf dem Umfange der
Stücke aus, wodurch namentlich bei in einander übergehenden Mustern Unrichtigkeiten
und Fehler entstehen. Schulze-Berge gibt deshalb bei
seiner Maschine der Druckfläche des Gegenstandes und der Musterrolle nicht gleiche
Umfangsgeschwindigkeit, sondern treibt sowohl Gegenstand, als Druckrolle an und
läſst dieselben in genau der gleichen Zeit immer eine Umdrehung machen. Bei den
verschiedenen Durchmessern der Gegenstände tritt dann allerdings ein Gleiten
desselben an der Druckrolle oder umgekehrt ein; doch schadet dies bei den kleineren
Unterschieden der Durchmesser der Reinheit des Musters nicht viel: stets wird jedoch
bei dieser Einrichtung ein vollkommen geschlossener Aufdruck erreicht.
Eine Schwierigkeit bietet die Ausführung dieser Einrichtung insofern, als
entsprechend der verschiedenen Form und Gröſse der zu bedruckenden Gegenstände die
Druckrolle zu dem Gegenstande die verschiedensten Stellungen einzunehmen hat, dabei
aber immer zu drehen ist. Der Antrieb der Druckrolle muſs daher eine freie
Beweglichkeit derselben gestatten; dabei muſs jedoch die Drehungsübertragung
gleichförmig sein, so daſs nicht gut Universalgelenke o. dgl. zu benutzen sind. Bei
einer älteren Ausführung seiner Maschine hatte Schulze-Berge Rollen mit endlosen Schnuren zur Bewegungsübertragung
zwischen Gegenstand und Druckrolle angewendet. Damit war allerdings eine freie
Beweglichkeit der Druckrolle erreicht; doch stellte sich hier als Uebelstand das
Gleiten der Schnuren auf den Rollen ein, so daſs diese Einrichtung wieder aufgegeben
wurde. Bei der neuesten Ausführung erfolgt daher die Bewegungsübertragung zwischen
den Achsen des Gegenstandes und der Druckrolle nur durch Zahnräder, wobei in
Gelenken drehbare Zwischenräder und kugelförmige Zahnräder die freie Beweglichkeit
sichern.
Der zu bedruckende Gegenstand G (Fig. 10 Taf. 11) wird auf
einen Teller T gesetzt und auf demselben durch drei
Nasen, von denen die eine p mittels einer Schraube
angezogen werden kann, genau centrisch erhalten. Oben setzt sich auf den Gegenstand
oder in dessen Höhlung die kegelförmige Scheibe K,
welche auf der Achse b1
verschiebbar ist und durch die Feder F den Gegenstand
G an den Teller T
preſst. Dieser sitzt auf der Achse b und werden beide
Achsen b und b1 mit gleicher Geschwindigkeit durch die Zahnräder
r und r1 von der durch ein Handrad mittels Kegelräder in
Umdrehung versetzten Achse a getrieben. In dem
Maschinengestelle A ist der Lager bock B verschiebbar und mit Hilfe der Schraube d entsprechend einstellbar. In dem Lagerbocke B ist der Winkel C durch
seinen mit Gewinde versehenen Schenkel e in der
Lothrechten zu verstellen und ruht in dem anderen Winkelschenkel mit einem
Fuſszapfen die auch im Bocke B gelagerte Achse c. Diese Achse c wird von
der Achse b1 durch ein
auf ihr sitzendes mittels Keil und Nuth verschiebbares Rad r2 getrieben, wobei ein in dem Gelenke R zwischen den beiden Achsen b1 und c
sitzendes Zwischenrad bei den verschiedenen Stellungen des Lagerbockes B immer die richtige Bewegungsübertragung ergibt. Auf
der Achse c steckt fest das halbkugelförmige Zahnrad
k, welches in ein zweites gleiches Rad k1 auf der Achse o eingreift. Am anderen Ende dieser Achse steckt die an
ihrer Umfangsfläche mit dem zu druckenden Muster versehene, je nach der Form des
Gegenstandes cylindrische oder mehr oder weniger kegelförmige Rolle D. Die Achse o dreht sich
in einer Lagerbüchse l, die mit zwei senkrechten Zapfen
in einem verschiebbaren Gleitstücke ruht, und kann damit die Achse o jede beliebige Winkelstellung erhalten. Eine hinter
dem Gleitstücke in der Führung für dasselbe liegende Feder f1 preſst die Rolle D immer sanft an den Gegenstand G. Auf den Achsen c und o stecken unterhalb den Halbkugelrädern k und k1 die Glocken g und g1 welche unter
einander durch einen den richtigen Eingriff der Zähne bei den verschiedenen
Stellungen der Räder k und k1 sichernden Gelenkhebel h verbunden sind. Dieser Hebel h ist auf einer Seite verlängert und kann dort mit einem Gewichte
beschwert werden, wodurch einestheils die Achse in der Höhe und die Rolle D im Anlaufe an der Lagerbüchse l erhalten, anderentheils das Anpressen der Rolle D beim Drucken zu regeln ist. Die beiden Glocken g und g1 sind
auch noch durch ein Kniegelenk unter einander in Verbindung und befindet sich der
Gelenkzapfen im Knie auf einem Gleitstücke t, das auf
einem senkrechten Arme des Hebels h durch eine Feder
immer nach auſsen gedrückt wird. Diese Feder sucht also den Winkel der beiden Achsen
c und o immer zu
verkleinern und wirkt demnach dem Andrucke der Rolle durch die Feder f1 und das
Belastungsgewicht von h etwas entgegen. Auf das Ende
des Hebels h kann auch nur der die Maschine bedienende
Arbeiter mit der Hand drücken, wenn, nachdem der Gegenstand G festgestellt ist, derselbe bedruckt wird. Beim Aufhören des Handdruckes geht
dann die Rolle D durch die Wirkung der Feder unter dem
Gleitstücke i zurück, der bedruckte Gegenstand wird
frei, kann nun herausgenommen und durch einen frischen ersetzt werden. Um das
Zurückgehen der Rolle D zu erleichtern, wird auch die
Wirkung der dieselbe anpressenden Feder f1 aufgehoben, zu welchem Zwecke dieselbe durch den
schrägen Riegel m und die mit ihrem einen Ende über
denselben greifende Stange n, welche am anderen Ende
eine vor der Feder f sitzende Blechscheibe trägt oder
unmittelbar in das Gleitstück eingeschraubt ist, zusammengedrückt wird, so daſs das
Gleitstück der Lagerbüchse l frei oder zurückgezogen
wird. Die Achsen b und b1 laufen auf den mit Handrädern
versehenen Schrauben t und t1, womit die Höhe des Gegenstandes G zur Druckrolle D genau
einzustellen ist. Hierdurch und durch die senkrechte Verstellbarkeit des Winkels C ist jede beliebige Lage der Rolle D zu erreichen.
Die Druckrolle kann nun die Farbe entweder von einem Tische abnehmen, oder es wird,
wie in Fig.
10 veranschaulicht, ein besonderer Zuführungsapparat mit Walzen verwendet.
In einem Gestelle H ist mit Hilfe der Mutter q die durch einen Keil gegen Drehung geschützte Spindel
s senkrecht verstellbar. Am Ende derselben ist der
Rahmen E drehbar, dessen Schrägstellung durch eine
Gelenkverbindung P bestimmt wird. Die Flügelmuttern auf
den Gelenkzapfen gestatten dabei eine schnelle Veränderung der Lage. In dem Rahmen
E führen sich die Lager für die Farbwalze S und die Vertheilungswalze W und werden durch zwischengelegte Federn f2 diese Walzen gegen die Rolle D hin gedrückt. Die Farbwalze S ist hohl, in der Umfangswand mit kleinen Löchern versehen und mit einem
schwammigen Materiale ausgefüllt; dieses saugt die durch den oberen Hohlzapfen in
die Walze gegossene Farbe auf und gibt sie durch die zahlreichen Löcher der Wandung
an die Vertheilungswalze W, welche die Farbe dann auf
die Druckrolle D überträgt.
Mit einer solchen Druckmaschine, welche auf den Tumbler
Works in Rochester (Penns.) im Betriebe ist, soll ein Mädchen von 12 bis 15
Jahren ungefähr 1000 bis 1400 Gläser in einem Tage bedrucken können.
Mit dieser Druckmaschine soll nun das Muster nicht bloſs mit den eingeriebenen
Schmelzfarben aufgedruckt werden, sondern Schulze-Berge
will, wie in dem Nordamerikanischen Patente Nr. 296226 angegeben, vielmehr das
Muster mit Firniſs oder Oelen von entsprechender Zähigkeit auf die Gegenstände
drucken und diese dann mit der pulverförmigen Farbe bestreuen (vgl. J. B. Miller 1881 242 57).
Dabei nehmen nur die gefirniſsten Stellen Farbepulver auf. Auf diese Weise sollen
auch mehrfarbige Muster erzeugt werden. Es wird dann zuerst das ganze Muster mit
Firniſs gedruckt und dieses mit der Grundfarbe gepudert. Wenn der Grund dann
trocken, werden die verschiedenen Farben nach einander gedruckt, aufgepudert und
immer wieder trocknen gelassen. Die Umrisse des Musters sollen dabei in genügender Schärfe
nach dem Brennen hervortreten. Auch zum Verzieren von Gläsern durch matte Muster,
was jetzt entweder durch Sand blasen (vgl. Tilghman
1874 212 * 14 bezieh. J. B.
Miller 1881 241 197), oder durch Aetzen des
vorher in einen Firniſsüberzug gravirten oder aufgeklebten Musters mittels
Fluſssäure (vgl. Hock 1875 215 * 129) erfolgt, will Schulze-Berge seine
Druckmaschine verwenden. Da die Einwirkung der Fluſssäure von entsprechender Stärke
auf das Glas mit der Temperatur desselben wechselt, so daſs bei Temperaturen von
über 40° die Fluſssäure nur eine geringe Wirkung auf das Glas besitzt, so sollen
nach dem Nordamerikanischen Patente Nr. 276895 die heiſs gemachten Gläser
unmittelbar mit der Fluſssäure bedruckt werden. Dieses Verfahren dürfte jedoch wegen
der gesundheitsschädlichen Säuredämpfe nicht zu empfehlen sein. Endlich sollen auch
durch Aufdrucken von Lösungen von Fluorsalzen auf Glasgegenstände und darauf
folgendes Brennen verschiedene Muster erzeugt werden.
R.
Tafeln