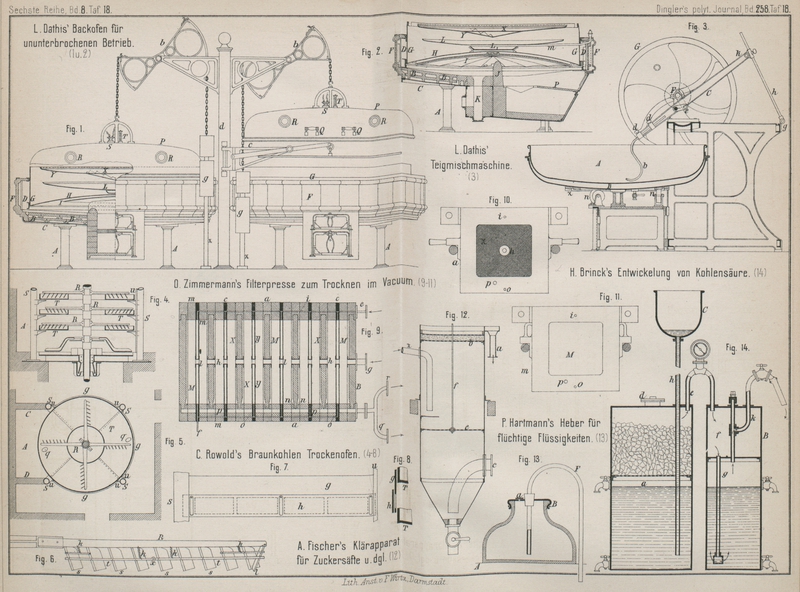| Titel: | Neuerungen an Feuerluft-Trockenöfen für Braunkohlen u. dgl. |
| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 262 |
| Download: | XML |
Neuerungen an Feuerluft-Trockenöfen für
Braunkohlen u. dgl.
Patentklasse 10. Mit Abbildungen auf Tafel 18.
Neuerungen an Feuerluft-Trockenöfen für Braunkohlen u.
dgl.
Bei Telleröfen zum Trocknen der Braunkohle (vgl. 1885 257
* 319) macht die ungehinderte Entwickelung und Verbreitung von Staub und Wärme den
Aufenthalt in der Nähe des Ofens und in den angrenzenden Räumen zu einem
unangenehmen und gesundheitsschädlichen, wie denn auch die Feuergefährlichkeit eine
bedenkliche werden kann. Ferner ist bei solchen Oefen, wo sich der Abzugsschlot für
die aufsteigenden Wasserdämpfe in der Mitte befindet, die Zugänglichkeit zum
Rührwerke erschwert und durch letzteres der Schlotquerschnitt verengt. Zur
Beseitigung dieser Uebelstände schlieſst Carl Rowold in
Meuselwitz (* D. R. P. Nr. 32985 vom
31. Januar 1885) die zwischen den einzelnen Tellern befindlichen
Zwischenräume ab und ordnet den Abzugsschlot seitlich an den Tellern aufsteigend an.
Wie in Fig. 4
und 5 Taf. 18
zu ersehen, werden an den Tragsäulen S des Ofens
U-Eisen u befestigt, in welche sich die den Ofen
umschlieſsenden gebogenen Blechplatten g einsetzen
lassen. Für jeden Ringraum zwischen den Trockentellern T sind solche Blechplatten vorhanden, welche nach Fig. 7 und 8 Taf. 18 in ihrem unteren
Theile mehrfach ausgeschnitten sind; diese Ausschnitte werden durch Schieber h verschlossen. Die Beobachtung der Trocknung auf den
einzelnen Tellern ist durch diese der Höhe nach verstellbaren Schieber h nicht gehindert und bei etwa vorkommenden
Ausbesserungen lassen sich die Blechplatten g leicht
aus den U-Eisen herausnehmen.
Um den seitlichen Abzugsschlot zu bilden, werden einfach von zwei Säulen S bis zur Wand des Gebäudes Mauern C und D aufgeführt und
bleiben für den Abzugskanal A dann die
Tellerzwischenräume offen. Durch die Verstellbarkeit der Schieber h an den übrigen Stellen der Zwischenräume läſst sich
für jeden Teller der Luftzutritt regeln.
Da bei Telleröfen ein vollständiges Auf- und Umrühren der Kohle auf den Tellern zur
Erreichung einer guten Trocknung Bedingung ist, die Thätigkeit der Rührschaufeln
durch Ungenauigkeiten der Tellerbodenfläche sich jedoch nicht überall bis auf
dieselbe erstreckt, hat C. Rowold (* D. R. P. Nr. 32593
vom 31. Januar 1885) die Rührschaufeln beweglich mit den
Rührarmen verbunden. Indem die festen Rührschaufeln, wenn sich der Tellerboden durch
die Hitze verbogen hat, nicht mehr überall die Bodenfläche bestreichen, bleiben
Kohlentheilchen unaufgerührt liegen und bilden diese dann einen schlechten
Wärmeleiter für die darüber zu liegen kommenden Kohlentheilchen, oder geben zu
Entzündungen Anlaſs. Andererseits erfolgt bei festen Rührschaufeln durch am
Tellerboden vorstehende Nietenköpfe u. dgl. leicht ein Verbiegen derselben, worauf
die vorher beschriebene nachtheilige Wirkung noch in erhöhtem Maſse eintritt. Die
Schaufeln s (Fig. 6 Taf. 18) sind
deshalb nicht an dem Rührarme R befestigt, sondern
sitzen an zwei in der Mitte (bei x) gelenkig
verbundenen Stangen t, welche durch kurze Ketten k an den Rührarm R gehängt
sind. Die Schaufeln s sind auch nicht senkrecht zur
Tellerbodenfläche, sondern bilden mit dieser einen Winkel von etwa 65°, wodurch eine
gröſsere Rührfläche, also ein besseres Durchmischen der Kohlen erreicht ist. Die
Schneide der Rührschaufeln ist sichelförmig abgerundet, um ein leichteres
Durchziehen derselben in der Kohle zu ermöglichen. Die am Ende des Rührarmes
angeordnete Kratze l hat den Zweck, die an den
Abfalllöchern q (vgl. Fig. 5) der Teller T sich bildenden Kohlenhäufchen besser zu
vertheilen.
Bei Entzündungen der trocknenden Kohle in Feuerluft-Rundöfen läſst man mit Erfolg
Dampf zum Löschen in den Ofen einströmen. Um nun den Dampf möglichst schnell im ganzen Ofen zu
verbreiten, soll nach L. Göderitz in
Deuben (* D. R. P. Nr. 32940 vom 7.
März 1885) der Dampf in die Tragsäulen des Ofens eintreten, aus welchen
derselbe durch Düsenöffnungen in alle Tellerzwischenräume gleichzeitig ausströmen
kann.
Tafeln