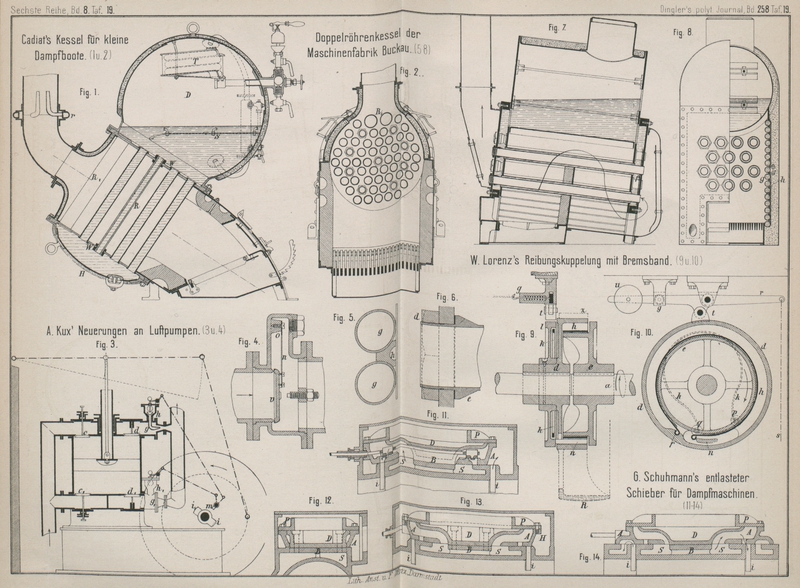| Titel: | W. Lorenz's Reibungskuppelung mit Bremsband. |
| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 301 |
| Download: | XML |
W. Lorenz's Reibungskuppelung mit
Bremsband.
Mit Abbildungen auf Tafel
19.
W. Lorenz's Reibungskuppelung mit Bremsband.
Bei der von W. Lorenz in Karlsruhe (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 32684 vom 18. November 1884)
angegebenen Reibungskuppelung wird eine einfache Bandbremse zwischen den beiden
Kuppelungshälften eingeschaltet und unterscheidet sich die vorliegende von älteren
derartigen Einrichtungen (vgl. Steiner 1883 247 * 55. Pechan 1880 235 * 10) hauptsächlich durch das selbstthätige Anziehen der Bremse für die Bewegungsübertragung.
Das Bremsband h (Fig. 9 und 10 Taf. 19), welches mit
Leder o. dgl. belegt sein kann, umschlieſst die auf der treibenden Welle a festsitzende Scheibe e
und ist mit einem Ende am Kranze der anzutreibenden Scheibe d bei f befestigt, während das andere Ende
sich vor den Zapfen n der lose drehbaren Scheibe l legt. In der Scheibe d
ist eine Feder k angeordnet, welche mit einem Ende an
einen vorstehenden Zapfen p der Scheibe d und mit dem anderen Ende an den Zapfen q der Scheibe l angehängt
ist. Diese Feder sucht sich auszuspreizen und zieht dabei durch Drehung der Scheibe
l mittels des Zapfens n das Bremsband an, so daſs die Scheibe d von
der Scheibe e mitgenommen wird. Um die Kuppelung zu
lösen, muſs die Wirkung der Feder k aufgehoben werden,
was durch ein Bremsen der Scheibe l geschieht. Ueber
derselben befindet sich an dem mit Gewicht u belasteten
Hebel r ein Backen t,
welcher sich auf den Rand der Scheibe l preſst, dadurch
dieselbe an der Drehung aufhält, in Folge dessen dann der Zapfen n das Bremsband h
freigibt.
Damit der Bremshebel für gewöhnlich ausgerückt bleibe und doch jederzeit zur Wirkung
gebracht werden könne, ist der federnde Riegel g
angeordnet, welcher mit seiner schrägen Nase in eine entsprechende Einkerbung des
Bremshebels schnappt und denselben in der höchsten Lage festhält. Zieht man an dem
Riegel g, so wird der Bremshebel frei und drückt durch
sein Gewicht u den Bremsbacken t gegen die Scheibe l. Der Zug am Riegel g kann durch einen Draht o. dgl. von beliebiger
Entfernung hergeleitet werden. Zum Wiedereinrücken muſs man sich an den Ort der
Kuppelung begeben und an der Kette s ziehen, bis der
Bremshebel über den Riegel g emporgehoben ist bezieh.
von letzterem festgehalten wird.
Bei Anwendung dieser Kuppelung für den unmittelbaren Antrieb von Zahnrädern,
Riemenscheiben, Schwungrädern u. dgl. bleiben die Kuppelungstheile im Wesentlichen
unverändert; dagegen ist die Welle a durchgehend zu
denken, auf welcher die Scheibe d lose sitzt und, wie
punktirt angegeben, zum Zahnrade z oder zur
Riemenscheibe R ausgebildet ist.
Tafeln