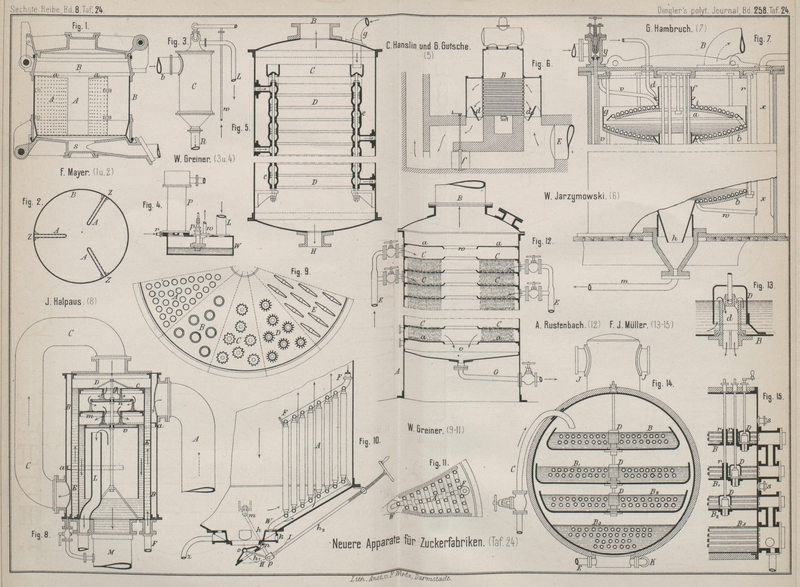| Titel: | Ueber neuere Apparate für Zuckerfabriken. |
| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 357 |
| Download: | XML |
Ueber neuere Apparate für
Zuckerfabriken.
(Patentklasse 89. Fortsetzung des Berichtes Bd.
256 S. 503.)
Mit Abbildungen auf Tafel
24.
Ueber neuere Apparate für Zuckerfabriken.
Die Société
Cail in Paris (* D. R. P. Nr. 30345 vom 27. März 1884) schlägt vor, die zerkleinerten
Rüben oder das Zuckerrohr zur Entsaftung in
Verdrängungsfilterpressen, wie sie zum Entzuckern des Schaumes gebräuchlich
sind, unter mäſsigem Drucke auszulaugen. Die
Filterpressen können dabei einzeln oder zu Batterien vereinigt benutzt und in
letzterem Falle bei Schnitzeln zwischen jede Filterpresse ein Apparat zum Warmhalten
des Saftes eingeschaltet werden. Statt der gewöhnlichen Filtertücher werden solche
aus Ziegenhaar oder feinem Metallgewebe benutzt und die einzelnen Platten der
Filterpressen durch zwischengelegte Gummiringe abgedichtet.
F.
Mayer in Petöhaz (* D. R. P. Nr. 30918 vom 19. August 1884) bringt zur Beschleunigung der Auslaugung in die Diffusionsgefäſse
Doppelsiebe aus gelochtem Bleche. Die in Fig. 1 und 2 Taf. 24
gezeichnete Vorrichtung besteht z.B. aus doppelwandigen Hohlkörpern A, welche oben geschlossen, unten aber offen sind. Mit
ihrem rückwärtigen geraden Theile Z werden die
Schlitzensiebe A durch Laschen mit Haken oder Schrauben
u. dgl. derart an der Zarge des Diffuseurs B befestigt,
daſs sie radial nach der Mitte des Gefäſses zu stehen und bei geschlossenem unterem
Deckel s des Diffuseurs mit dessen Siebboden in
unmittelbarer Verbindung stehen. Die oberste Kante a
der Siebe reicht nur bis zur Zargenoberkante, damit noch eine schwache
Schnitzelschicht ganz von der Flüssigkeit zu durchströmen übrig bleibt.
G.
François in Warschau (D. R. P. Nr. 30683 vom 18. September 1884) empfiehlt, die
Schnitzel in einem Behälter aufzunehmen, welcher zwischen dem eigentlichen Deckel
und dem Boden des Diffuseurs angeordnet und derart drehbar gelagert ist, daſs er mit dem ganzen
Schnitzelinhalte behufs rascher Entleerung zur Seite
schwingen kann. Die Abdichtung des Schnitzelbehälters
erfolgt mittels eines hydraulischen Kolbens.
Bei dem Diffusions-Controlapparate von Fischer und
Stiehl in Essen (* D. R. P. Nr. 30917 vom 12. August 1884) geht der Rübensaft
auf seinem Wege von den Diffuseuren zum Sammelgefäſse durch einen
Flüssigkeitsmesser, welcher die durchgeflossene Saftmenge an seinem Zählwerke
aufzeichnet.
Bei dem Condensator von J. Halpaus
in Ustie (* D. R. P. Nr. 30529 vom 17.
August 1884) geht der durch das Rohr A (Fig. 8 Taf. 24)
vom Verdampfapparate kommende Dampf zuerst durch das ringförmige Gefäſs B so hindurch, daſs derselbe in Folge der
halbkreisförmig angebrachten Eckeisen a einen
gewundenen Weg machen muſs, um die ersten Kühlflächen, welche nach auſsen
Luftkühlung, nach innen Wasserkühlung haben, möglichst zu berühren. Hierauf geht der
noch nicht verflüssigte Dampf durch das Rohr C in den
oberen Theil des Gefäſses D mit Einsatz E, wo sich der Dampf an der Wasserfläche c abkühlt. Das durch das Rohr F in das Gefäſs D zuströmende Wasser läuft
bei der Oeffnung g in einen Untersatz n, dann auf den ringförmigen Teller m, von da auf den oberen Boden des Einsatzes v und an dessen Auſsenwänden gleichmäſsig herab. Da der
Dampf diesen Weg mitzumachen gezwungen ist, bietet sich demselben eine groſse
Kühlfläche dar. Schieſslich wird die in dem Dampfe enthalten gewesene Luft durch das
Rohr L mittels einer Luftpumpe abgesaugt; das zur
Kühlung erforderliche Wasser dagegen läuft durch das Hauptrohr M ab.
W.
Greiner in Berlin (* D. R. P. Nr. 32014 vom 25. Oktober 1884) läſst zum Niederschlagen der Brüden diese in bekannter Weise
durch das Rohr b (Fig. 3 und 4 Taf. 24) in den
Condensator C treten, während das durch Rohr w eintretende Wasser durch das Fallrohr R abflieſst. Zur Entfernung der Luft durch Rohr L werden Pumpen P (Fig. 4) verwendet, in
welche durch Rohr r etwas Wasser zum Dichten der
Ventile eintritt. Das in dem Behälter W sich
ansammelnde Wasser wird durch die Pumpe p entfernt.
Diese Pumpe kann man auch für die sogen. nasse Condensation ohne weiteres anwenden,
wenn man Luft und Einspritzwasser vom Condensator durch das Rohr L in den Behälter W
einführt, die Luft durch die Pumpen P und das Wasser
durch eine entsprechend erweiterte Wasserpumpe p
entfernt.
Um die Wärme der Brüden nutzbar zu machen, führt L.
Wüstenhagen in Hecklingen (* D. R. P. Nr. 30388 vom 9. Juli 1884) die Brüden zunächst
durch einen Oberflächencondensator, um in demselben mittels durchströmender Luft
fast vollständig niedergeschlagen zu werden und an diese Luft den Haupttheil ihrer
Wärme abzugeben. Der verbleibende Rest der Brüden geht zur Einspritzcondensation, um
dort mittels des fein zertheilten Einspritzwassers verflüssigt zu werden. Die so
gewonnene warme Luft kann nun zur Trocknung beliebiger
organischer oder unorganischer Substanzen, z.B. Rübenschnitzel, oder zum Heizen
benutzt werden, je nachdem der Fabrikbetrieb, in welchem die betreffenden Verdampf-
oder Vacuumapparate arbeiten, für dieselben Verwendung bietet.
C. Hanslin und G. Gutsche in
Breslau (* D. R. P. Nr. 31353 vom 10.
August 1884) verwenden zum ununterbrochenen
Abdampfen mittels Abdampf ein schmiedeisernes Gefäſs, dessen Stutzen B (Fig. 5 Taf. 24) mit der
Luftpumpe verbunden ist. Der Heizkörper D besteht aus
Röhren, welche durch zwei Schrauben e so mit einander
verbunden sind, daſs der Dampf von entgegengesetzten Seiten abwechselnd von einem
Heizringe in den folgenden gelangen kann. An der unteren Seite eines jeden Ringes
ist ein kurzes cylindrisches Stück angelöthet, welches genau auf die obere Seite des
nächstfolgenden Ringes paſst und so den Heizkörper in einen inneren und einen
äuſseren wellenartig geformten Mantel theilt. Die zu verdampfende Flüssigkeit
gelangt durch das Rohr g in die Vertheilungsrinne C, von hier durch die am Boden derselben angebrachten
Oeffnungen auf den inneren und äuſseren Mantel des Heizkörpers D, über welche sie herunterrieselt, indem sie dabei von
dem durch die Heizringe gehenden Abdampfe verdampft wird, und verläſst schlieſslich
durch den Stutzen H den Apparat.
Der Abdampfapparat von G. Hambruch in
Berlin (* D. R. P. Nr. 30916 vom 24.
Juli 1884) enthält als Rieselfläche für die
zu verdampfende Lösung in dichten Spiralen aufgerollte Heizschlangen auf den Schalen
a und b (Fig. 7 Taf.
24), welche an Stangen r hängen. Die Windungen der
Spiralen t sind unter einander so verlöthet, daſs die
Flüssigkeit mit den Schalen selbst nicht in Berührung kommt. Die Lösung tritt durch
Rohr d auf die obere Schale, wobei der an der
rohrartigen Wand f angebrachte Rand eine gleichmäſsige
Vertheilung der Flüssigkeit bewirkt. Die letztere rieselt über die Rohre i hinweg und fällt am äuſseren Rande der oberen Schale
a auf die unterhalb gelegene Schale b herab, an deren äuſserem Rande eine Wand g angebracht ist, damit die Flüssigkeit nicht über den
Rand der Schale b flieſst. Die Flüssigkeit flieſst nun
nach dem innneren Rande der Schale b und dann auf eine
darunter liegende Schale, wobei in gleicher Weise wie bei der obersten Schale der
richtige Weg für die Flüssigkeit bestimmt wird u.s.w., um schlieſslich durch den
Trichter h in das Abfluſsrohr m zu gelangen. Die Rohre i sind durch die
Rohre v mit Einlaſsventilen y für den Heizdampf verbunden, während die Rohre w zum Wasserableiter x führen; das Rohr B geht zur Luftpumpe.
Bei dem Verdampfapparat von F. J.
Müller in Prag (* D.
R. P. Nr. 30677 vom 23. August 1884) wird das Hauptgewicht darauf gelegt,
daſs die Flüssigkeit nur eine wenig Centimeter hohe Schicht bildet, wodurch die
Verdampfung begünstigt werden soll. In der Mitte des in Fig. 14 und 15 Taf. 24
veranschaulichten Apparates befindet sich oben der Dampfdom mit den
Dampfabzugsstutzen J, um den sich entwickelnden Dampf
in andere Apparate oder zum Niederschlagen zu leiten. An der unteren Seite hat der
Apparat ein Mann- oder Einsteigloch mit Verschluſsdeckeln, den Stutzen E zum Dicksaftablaſs und den Stutzen K zum Reinigungswasserablaſs. An den beiden
Apparatböden sind ferner die üblichen Schaugläser s,
Vacuummeter, Thermometer und Saftstandglashalter angebracht. Der Dünnsaft tritt
durch das Rohr C in die oberste Pfanne B ein und ergieſst sich, wenn der normale Stand
erreicht ist, durch den Ueberlaufstutzen D (Fig. 13 Taf.
24) in die darunter liegende Pfanne B1 aus dieser unter denselben Bedingungen in die
Pfanne B2 und von da in
B3, aus welch
letzterer die concentrirte Flüssigkeit oder der Dicksaft mittels einer Pumpe oder
einer anderen Vorrichtung abgesaugt oder abgelassen werden kann. Beim Entleeren der
Innenpfannen wird das hohle Ablaſsventil d durch die
Kurbelspindel gehoben, während die die Ventilspindeln umgebenden Rohre r fest bleiben.
W.
Greiner in Berlin (* D. R. P. Nr. 31022 vom 16. Juli 1884) will als Heizrohre bei Kochapparaten, wie in Fig. 9 Taf. 24 skizzirt,
einfache Rohre A, Doppelrohre B, Wellrohre C, Rippenrohre D oder flache Rohre E
verwenden, welche nach Fig. 10 und 11 Taf. 24 mit
dem Dampfrohre F verbunden sind. Das im Rohre W gesammelte Wasser flieſst aus der Kammer k durch ein Rohr z ab. Das
Gelenk n zeigt, wenn die Klappe geschlossen ist, eine
kleine Schlitzerweiterung in senkrechter Richtung, damit die Verschluſsfläche in
wagerechter Richtung eine freie Bewegung nach oben und unten, wenn auch in kurzer
Begrenzung, behält. Der Punkt o bewegt sich also nur
annähernd im punktirten Kreise II um n als Mittelpunkt.
Der Kniehebel wird gebildet aus dem in Zapfen m
drehbaren Bügel h und dem sich darauf und gegen den
Punkt o des Verschluſsdeckels stützenden Hebel h1. Die Drehung des
Vereinigungspunktes
p um m geschieht in dem
punktirten Kreise I. An demselben Gelenkpunkte greift die Spindelstange h2 an, welche am oberen
Ende ein Handrad trägt und in einem Auge geführt wird.
Nach A.
Rustenbach in Schöningen (* D. R. P. Nr. 32234 vom 23. Januar 1885) wird der heiſse
Dünnsaft durch einen sogen. Colonnenverdampfapparat
geleitet, bevor er in den Dicksaftapparat gelangt. Zu diesem Zwecke enthält der
durch das Brüdenrohr B (Fig. 12 Taf. 24) mit dem
Condensator des Dicksaftapparates verbundene Apparat A
eine Anzahl Siebböden C, während der obere und der
unterste Boden a nicht durchlöchert ist. Der heiſse
Saft wird mittels der Luftverdünnung durch die Röhren E
auf die obersten Siebböden geleitet, tropft dann durch die kleinen Löcher über alle
darunter liegenden Böden bis in den untersten Raum v,
woraus er durch das Abzugrohr G in den Dicksaftkörper
gelangt. Der bei dem Heruntertropfen des heiſsen Saftes entweichende Brüden- oder
Wasserdampf gelangt in die Mitte des Apparates zur Oeffnung w und wird von dem Condensator durch das Brüdenrohr B angezogen, wobei der Saft sich entsprechend
abkühlt.
W.
Jarzymowski in Bogatoge, Ruſsland
(D. R. P. Nr. 31245 vom 5. August 1884) beabsichtigt,
die abziehenden Heizgase vom Dampfkessel zum Verdampfen
zu verwenden. Der Apparat wird so in den Rauchkanal eingebaut, daſs man die vom
Dampfkessel E (Fig. 6 Taf. 24)
abziehenden Rauchgase durch das Heizrohrsystem B
streichen lassen kann, je nach Stellung der Schieber d
und f.
Tafeln