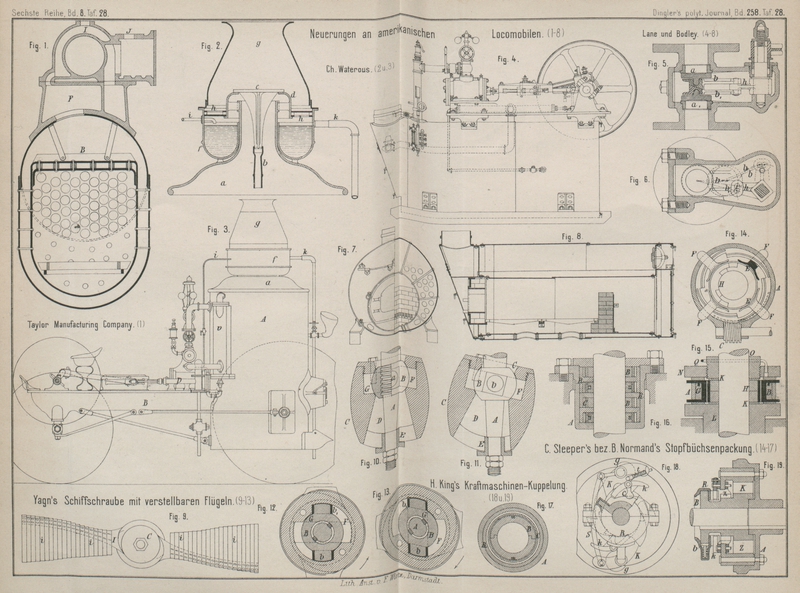| Titel: | H. J. King's Kraftmaschinen-Kuppelung. |
| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 434 |
| Download: | XML |
H. J. King's Kraftmaschinen-Kuppelung.
Mit Abbildungen auf Tafel
28.
H. King's Kraftmaschinen-Kuppelung.
Bei Kuppelungen zur Verbindung zweier Kraftmaschinen behufs Uebertragung der von
denselben abgegebenen Betriebskraft auf ein
Triebwerkselement werden Klinken benutzt, welche durch einen Reibungsring bei
langsamerem Gange der einen Kuppelungshälfte aus den Zähnen eines Klinkenrades auf
der anderen Kuppelungshälfte ausgehoben werden. Bei schweren Klinken, wie sie bei
gröſseren Kraftleistungen bedingt sind, muſs die Reibung für das Ausheben der Klinken groſs sein;
da nun die Reibungsflächen sich dann leicht abnutzen, so vermag der Ring die Klinken
nicht mehr ordentlich auszuheben und es entsteht durch das Schleifen der Klinken auf
dem zugehörigen Rade eine starke Abnutzung und ein unangenehmes Geräusch. Zur
Vermeidung dieses Uebelstandes (vgl. Kankelwitz 1883
250 * 191) wirkt bei der von H. J. King in Newmarket (Englisches Patent Nr. 2645 vom 4. Februar 1884)
angegebenen Kraftmaschinen-Kuppelung der Reibungsring nicht
unmittelbar auf die Uebertragungsklinken, sondern durch Vermittelung eines
zweiten kleineren Klinkenpaares. Für die Uebertragungsklinken sind dabei
Gegengewichte vorgesehen, so daſs das Ein- und Ausheben derselben mit ganz geringer
Kraftäuſserung ermöglicht ist.
In Fig. 18 und
19 Taf.
28 ist die neue Anordnung dargestellt. Es ist A die
eine durch die zugehörige Welle Kraft empfangende Kuppelungshälfte, welche auch zu
einem Zahnrade oder einer Riemenscheibe ausgebildet werden kann und an zwei Bolzen
die einander gegenüber liegenden Klinken K trägt.
Dieselben sind unter einander durch die Gelenkstange S
so verbunden, daſs sie gleichzeitig ihre Schwingungen ausführen. Auſserhalb der
Scheibe A besitzen die Klinken Gegengewichte g und auf Zapfen drehbar die kleineren Klinken k, welche ebenfalls wieder nach hinten verlängert sind,
wodurch auch die Leichtigkeit der Bewegung dieser Klinken gesichert ist. Die zweite
Kuppelungshälfte B besitzt neben einander zwei
Verzahnungen: eine grobe Z für die Klinken K und eine feinere z für
die Klinken K; auſserdem hat B einen Rand, über welchen der zweitheilige Reibungsring R greift. Durch einen in der einen Ringhälfte
eingelegten Backen 6, welchen eine untergelegte Feder an den Umfang des Randes von
B preſst, wird die nöthige Reibung zur Mitnahme des
Ringes R seitens B
hervorgebracht. Der Ring R besitzt an der den Klinken
zugekehrten Seite zwei Vorsprünge, welche gegen die mit den Klinken k verbundenen Arme c
treffen und dadurch entweder die Klinken k aus der
zugehörigen Verzahnung z heben, oder in dieselbe
einlegen. Fängt die Hälfte A an langsamer zu gehen, so
werden bei der voreilenden Drehung der Hälfte B durch
den einen Vorsprung am Ringe R, indem derselbe die eine
obere Klinke k zu drehen sucht, die Klinken K ausgehoben und bei voreilender Drehung von A die Klinken K durch
Antreffen der Klinken k gegen die Zähne z eingelegt. Im ersten Falle hindert die Verdrehung der
oberen Klinke k an der Klinke K das federnde Zwischenstück t.
Tafeln