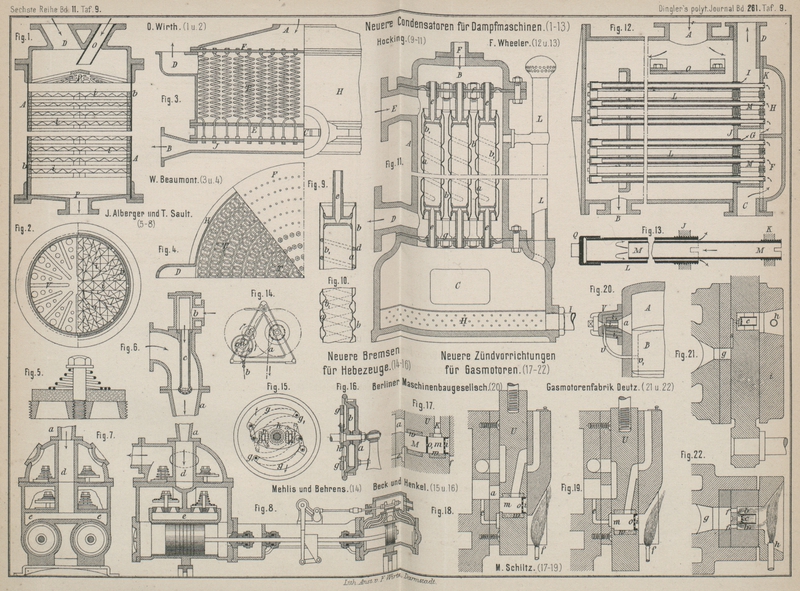| Titel: | Neuere Bremsen für Hebezeuge. |
| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 154 |
| Download: | XML |
Neuere Bremsen für Hebezeuge.
Patentklasse 35. Mit Abbildungen auf Tafel 9.
Neuere Bremsen für Hebezeuge.
Um beim Loslassen der Handkurbel oder beim Ausrücken der Antriebsrolle eines
Hebezeuges die Last selbstthätig zu bremsen, bringt die Maschinenfabrik Cyclop, Mehlis und Behrens in Berlin (* D. R. P. Nr. 33269
vom 22. Januar 1885) die Bremse nicht, wie dies bisher meist geschehen, auf der
Antriebsachse unmittelbar neben der Kurbel oder Rolle an (vgl. Zobel u.a. 1884 253 * 447.
H. Mohr 1885 256 * 154),
sondern auf einer besonderen Welle, welche mit der
Kurbel durch Zahnräder in Verbindung steht. Die Bremse, welche bei der
entsprechenden Drehung ihrer Welle durch Sperrrad und in dasselbe fallende Klinken zur
Wirkung kommt, wird von der Last selbst angezogen.
Wie aus Fig.
14 Taf. 9 zu entnehmen, ist das eine Ende a
der Lastkette an der Windetrommel und das andere Ende b
derselben an einem Bremsbande c befestigt, welches um
eine auf der Welle d sitzende Scheibe e gelegt ist. Auf der Welle d sitzt noch fest eine die Sperrklinken tragende Scheibe neben einem lose
drehbaren Zahnrade, welch letzteres mit einem gleichen, fest auf der Vorgelegewelle
f sitzenden Rade in Eingriff steht. An dem ersteren
Zahnrade sind auch die Sperrzähne angebracht, in welche die Klinken durch Federn
gedrückt werden. In Folge dieser Anordnung steht beim Aufwinden der Last die Welle
d still, da die Klinken über die Sperrzähne
gleiten. Läſst man die Kurbel los, so versucht die Last, die Welle f in der Richtung des eingezeichneten Pfeiles zu
drehen, wodurch die Klinken in die Sperrzähne einfallen und die Bremsscheibe e zu drehen versucht wird. Dies wird jedoch von dem
durch die Last angezogenen Bremsbande verhindert. Hierbei wächst mit dem
Lastgewichte auch der Bremsdruck und wird somit selbstthätig jeder beliebigen Last
Gleichgewicht gehalten. Beim Senken der Last ist man genöthigt, die Handkurbel
rückwärts zu drehen, wobei die Welle d unter
Ueberwindung der durch das Bremsband verursachten Reibung gedreht wird.
J. Weidtman in Dortmund (* D. R. P. Nr. 31966 vom 11.
December 1884, Zusatz zu * Nr. 13639, vgl. 1882 243 *
272) hat an seiner Sicherheitskurbel zwischen der
äuſseren Hälfte der Reibungskuppelung und der Kurbel und einer Verlängerung des
Armes derselben frei liegende gespannte Federn angeordnet, welche, wie früher die in
der vorderen Kuppelungshälfte selbst untergebrachten Federn, das Zusammendrücken der
Kuppelung bewirken.
Bei der von Beck und Henkel in Cassel (* D. R. P. Nr.
33725 vom 3. April 1885) vorgeschlagenen Geschwindigkeitsbremse für Hebezeuge (vgl. Mégy 1874 213 * 108. H.
Mohr 1885 256 * 338) wird durch von der
Centrifugalkraft beeinfluſste Gewichtstücke eine Reibungskuppelung zusammengepreſst
und dadurch ein zu rasches Senken der Last selbstthätig verhindert. Die
Schwunggewichte g (Fig. 15 und 16 Taf. 9)
sind um Zapfen g1
drehbar an der Kuppelungshälfte b und werden bei nicht
übermäſsiger Geschwindigkeit durch in den Figuren nicht angegebene Federn in der
punktirt gezeichneten Lage gehalten. Bei zunehmender Geschwindigkeit schlagen die
Gewichte g aus und verdrehen damit das Glied h, dessen Rollen r dann
auf keilförmige Ansätze an der Kuppelungshälfte b
laufen und diese gegen die festgehaltene Kuppelungshälfte a pressen. Die letztere Kuppelungshälfte könnte mit einer Handkurbel auf
die von Weidtman u.a. angegebene Weise verbunden und
damit die Einrichtung zum Antriebe des Hebezeuges benutzt werden.
Tafeln