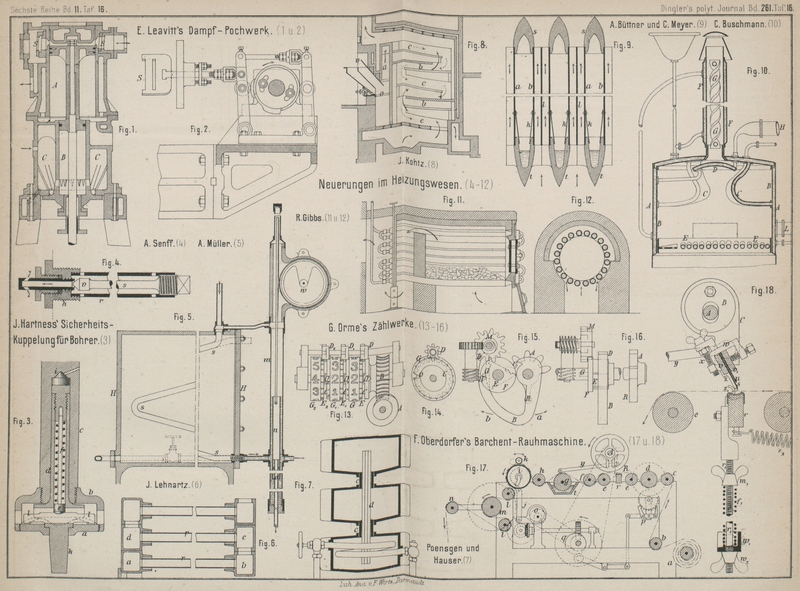| Titel: | E. Leavitt's Dampf-Pochwerk. |
| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 239 |
| Download: | XML |
E. Leavitt's Dampf-Pochwerk.
Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 16.
E. Leavitt's Dampfpochwerk.
Ueber Dampfpochwerke hat F. Cogging von den Calumet and Hecla Mills in Lake Linden, Mich., vor der
American Society of Mechanical
Engineers einen Vortrag gehalten, welchem die nachfolgenden
Mittheilungen nach Engineering and Mining Journal, 1886
Bd. 41 * S. 210 bezieh. Engineering, 1886
Bd. 41 * S. 119 entnommen sind.
Für die Zerkleinerung von Erzen nahm W.
Ball in Chicopee, Mass. Nordamerika, im J. 1856 das erste Patent auf ein
Pochwerk mit Dampfbetrieb, welches in der Hauptsache einem doppeltwirkenden
Dampfhammer glich. Die Schiebersteuerung wurde dabei von einer mit Riemen
angetriebenen Hilfswelle, auf welcher das Schieberexcenter saſs, abgeleitet. Durch
diese Anordnung war die Schieberbewegung von den Kolbenwegen unabhängig;
andererseits ertheilten eingeschaltete elliptische Zahnräder der Excenterwelle eine
ungleichförmig beschleunigte Drehbewegung, der zu Folge der Schieber eine
beschleunigte Bewegung im oberen Hubtheile erhält, wodurch ein rascher
Dampfabschluſs beim Fallen und ein langsameres Eröffnen des Dampfkanales beim
Ansteigen des Kolbens erreicht wurde. Der Dampfcylinder sowie die Führungen für das
Gestänge waren an einem Balkengerüste seitlich angeschraubt. Der flaschenartig
gebildete Mörser stand auf einem Guſsblocke und dieser, sowie das Gerüst, auf einer
Bohlenunterlage aus Eichenholz. Der Pochschuh saſs in der unten erweiterten
Kolbenstange. Die Erztrümmer wurden von einem stetigen Wasserstrome durch einen
Siebkorb abgeführt.
Die ersten von der Arnes Manufacturing
Company in Chicopee gebauten Ball'schen
Dampfpochwerke hatten 230mm Cylinderdurchmesser,
610mm Hub, 910k Stempelgewicht, machten bei 5at,5
Dampfdruck 75 Hübe in der Minute und lieferten 50t
Erz in 24 Stunden.
Bis zum J. 1875 wurden die Abmessungen solcher Ball'scher Pochwerke stetig vergröſsert, so zwar, daſs
Dampf-Pochwerke mit 380mm Cylinderdurchmesser,
610mm Hub, 2040k Stempel- und 11t Ambosgewicht mit 5at,6 Dampfspannung 90 Doppelhübe erhielten,
wodurch die Leistungsfähigkeit auf 150t Erz in 24
Stunden gebracht wurde. Der schädliche Raum im Dampfcylinder betrug etwa 50 Procent
des Cylinderinhaltes für den vollen Hub von 610mm.
Da aber die Beschickung des Mörsers selten den vollen Hub gestattete, so war ein
unverhältniſsmäſsig hoher Dampfverbrauch die Folge.
Diesem Uebelstande half E. D. Leavitt von der Calumet and Hecla Mining Company durch sein im J. 1879
entworfenes Dampfpochwerk erfolgreich ab, so daſs mit geringerem Dampfverbrauche
eine bedeutend höhere Leistung erzielt werden konnte.
Wie aus Fig. 1
Taf. 16 zu entnehmen ist. stehen auf einem guſseisernen Dreiecksgestelle, welches in
den Querverbindungen die Führungen für das Gestänge enthält, zwei Dampfcylinder über
einander. Der obere groſse Cylinder A hat 545mm Durchmesser und der untere kleine Cylinder B 356mm Durchmesser,
so daſs nach Abzug der Kolbenstange ein wirksames Flächenverhältniſs von 2,36 folgt.
Der Kolbenhub beträgt 610mm. Auf der
gemeinschaftlichen Stange sind die Kolben in durch eine Zwischenhülse genau
bestimmten Abständen befestigt. Die Cylinderräume zwischen den inneren Kolbenflächen
sind frei und stehen mit einem Condensator in Verbindung. Auf den groſsen Kolben
wirkt von oben Kesseldampf von 5at,5 Spannung; das
Füllungsverhältniſs ist etwa 0,20 bis 0,25. Die Compression des Hinterdampfes ist
ziemlich stark.
Die Dampfvertheilung wird durch zwei Gitterschieber S in
getrennten Schiebergehäusen bewirkt. Die Schieber werden, wie in Fig. 2 Taf. 16 ersichtlich
ist, mittels entsprechender Rollenhebel durch je zwei Daumenscheiben bethätigt (vgl.
Condict 1884 252 * 226),
welche auf einer wagerecht gelagerten Welle aufgekeilt sind und durch diese ihre
Drehung von der Haupttriebwelle empfangen. Im Falle der Gang derselben zu
unregelmäſsig wäre, wird empfohlen, die Steuerwellen von einer eigens dazu
bestimmten kleinen Dampfmaschine anzutreiben.
Der obere groſse Dampfcylinder besitzt einen Dampfmantel, welcher durch eine Filz-
und Holzbekleidung eingehüllt wird. Der untere kleine Dampfcylinder ist in einem
gröſseren Cylindermantel eingegossen. Dieser Mantelraum C steht mit dem Cylinderraume unter dem kleinen Kolben in Verbindung. Zu
diesem Zwecke ist der einspringende Rand des unteren Cylinders zackenförmig
ausgespart.
Der Raum unter dem kleinen Kolben und der Mantelraum seines Cylinders sind mit Dampf
von beliebiger gleichbleibender Spannung erfüllt und, sobald über dem groſsen Kolben
Ausströmung des Dampfes hergestellt ist, wird dieser Druck den Aufstieg des Kolbens
veranlassen, ähnlich wie bei Condict's
Zwillingsdampfpochwerk. Hierdurch ist jeglicher schädliche Raum auf der unteren
Arbeitseite vermieden und sind bloſs noch Verluste in Folge Undichtheit und
Abkühlung vorhanden.
Die mechanische Arbeit, welche beim Heben des Gestänges der Unterdampf leistet, gibt
der Oberdampf während des Fallhubes wieder ab, indem der Oberdampf den Unterdampf in
den ursprünglichen Raum verdichtet. Soll aber Pressung des Unterdampfes vermieden
werden, so wird in das Dampfzuleitungsrohr eine Ausgleichklappe eingeschaltet. Die
Anbringung einer Buffervorrichtung ermöglicht die Verringerung des Spielraumes
zwischen Kolben und oberem Cylinderdeckel, wodurch der schädliche Raum von 16,5 auf
5,7 Proc. sich vermindert und wegen der stattfindenden Compression ohnedies
belanglos wird. Der Bufferteller a steckt in der oberen
Querverbindung des Gestelles und hat 636mm
Durchmesser. Der Bufferkolben b bildet zugleich eine
etwas elastische Kuppelung zwischen Kolbenstange und Pochstempel.
Textabbildung Bd. 261, S. 240
Zur Sicherheit des Anschlages sind im Boden des Buffertellers
etwas vorspringende Gummiringe eingesetzt, damit bei Luftdurchlässigkeit das
Gestänge nicht zertrümmert werde. Es ist demnach leicht ersichtlich, daſs bei vollem
Aushube auf das Kolbengestänge auſser dem Dampfüberdrucke noch eine starke
Druckspannung hinzutritt, welche durch die Verdichtung der Luft im Buffergehäuse
entsteht, deren Spannung im günstigen Falle bis auf 12at steigen kann und welche bei Beginn der Fallbewegung beschleunigend einwirkt. Diese Arbeit
liefert aber wieder der Unterdampf am kleinen Kolben und, wie schon erwähnt ist,
dieser wieder dieselbe Arbeit des Oberdampfes am groſsen Kolben. Weil aber während
des Fallhubes der Unterdampf mit annähernd gleichbleibender Spannung, groſsen
Mantelraum C vorausgesetzt, dem Oberdampfe
entgegenwirkt und die gleichbleibende Kraft, welche durch das fallende Gewicht des
Gestänges gegeben ist, vollständig aufzehrt, so bleibt bloſs der wirksame Ueberdruck
am groſsen Kolben übrig, welcher in Folge der Expansion an Stärke um so mehr
abnimmt, je mehr sich der Kolben der unteren Hubgrenze nähert.
Mit diesem Leavitt'schen Dampfpochwerke werden bei 92
Stempelhüben in der Minute in 24 Stunden 230t Erz
zerkleinert, was im Vergleiche zur sonst wirksamen Ball'schen Maschine mit 40 Proc. Dampfersparniſs erreicht wird. Die in den
angegebenen Quellen ersichtlichen Indicator- und Geschwindigkeitsdiagramme lassen
die Wirkungsweise der Ball'schen und Leavitt'schen Maschine leicht vergleichen.
Tafeln