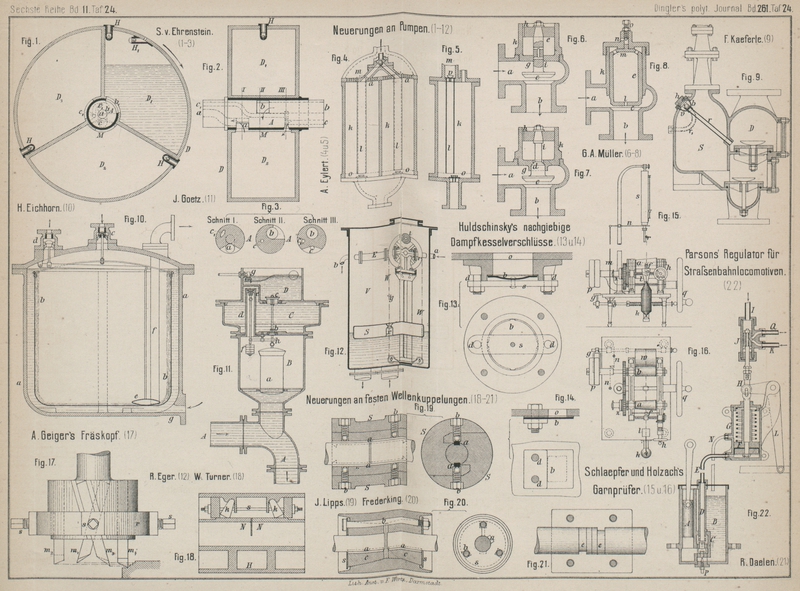| Titel: | C. Schlaepfer und Fritz Holzach's Garnprüfer. |
| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 368 |
| Download: | XML |
C. Schlaepfer und Fritz Holzach's Garnprüfer.
Mit Abbildungen auf Tafel
24.
Schlaepfer und Holzach's Garnprüfer.
Zur Untersuchung der Gleichmäſsigkeit gesponnener Garne
wird bei dem von C. Schlaepfer und Fritz Holzach in Frate di Salerno, Italien, (* D. R. P.
Kl. 42 Nr. 34305 vom 6. August 1885) angegebenen Apparate die Prüfung der mit der
Ungleichmäſsigkeit wechselnden Elasticität des Fadens vorgenommen (vgl. dagegen P. See 1881 239 * 109). Wird
nämlich ein Faden zwischen zwei mit verschiedener Umfangsgeschwindigkeit laufenden
Walzenpaaren über eine elastisch gehaltene Spannrolle geführt, so kann man aus den
Bewegungen der letzteren beim Durchziehen des Fadens auf dessen Ungleichmäſsigkeit
schlieſsen. Um die Prüfung des Fadens dabei unter verschiedener Anspannung desselben
vornehmen zu können, werden die Walzen des einen Paares kegelförmig gemacht und ist
also durch Verschiebung des Fadenlaufes in der Breite der Walzen eine Aenderung der
Fadenspannung möglich.
Fig. 15 und
16 Taf.
24 veranschaulichen einen solchen Garnprüfer, wie derselbe von Wenner, Schwarz und Gutmann in Zürich in den Handel
gebracht wird. Der zu untersuchende Faden läuft von dem Kötzer k über ein Plüschklötzchen l zwischen das erste kegelförmige Walzenpaar a und von diesem weg in die Höhe über die mit einer Feder verbundene Rolle
r, dann wieder absteigend zu dem zweiten
Walzenpaare b, hinter welchem sich der Faden auf eine
an das Walzenpaar federnd gedrückte Rolle w wickelt.
Die oberen Walzen sind bei a mit Gummi, bei b mit Leder bezogen und beide werden durch Spiralfedern
fest auf ihre Unterwalzen gedrückt. Die Unterwalzen stehen mit einander durch
Zahnräder in Verbindung und werden von Hand mittels des Kurbelrades q oder durch einen auf das Scheibenpaar p laufenden Riemen getrieben. Der Fadenführer f sitzt auf einer Schraubenspindel und wird von dem
Handrade h aus je nach der gewünschten Fadenanspannung
gestellt. Die Feder der Spannrolle r steckt in einer
Hülse s und trägt einen Zeiger, durch welchen an einer
Eintheilung auf der Hülse s die Schwankungen der
Fadenelasticität leicht erkannt werden. Um die weitere Lieferung von Garn bei Bruch
desselben schnell aufheben zu können, ist das Antriebsrad für das erste Walzenpaar
auf seiner Achse lose und wird nur durch einen Klauenmuff z gekuppelt, so daſs durch Zurückziehen des letzteren jede weitere Faden
Zuführung unterbleibt. Uebrigens besitzt der Apparat auch eine selbstthätige
Abstellung bei Fadenbruch. Wenn die Rolle r beim
Reiſsen des Fadens durch die Federwirkung zurückschlägt, so trifft dieselbe gegen
das Ende des Hebels n, welcher mittels des Drahtes m eine den Riemenführer g
in eingerücktem Zustande erhaltende Klinke o auslöst,
wodurch mittels Feder der Riemen auf die Losscheibe übergeführt wird.
Der beschriebene Apparat dürfte sich namentlich zur Untersuchung gröſserer Garnlängen
dienlich erweisen, wenn die sich im fertigen Faden in groſsen Abständen befindenden
Ungleichheiten, welche durch Fehler in der Vorbereitung verursacht wurden,
festgestellt werden sollen.
Tafeln