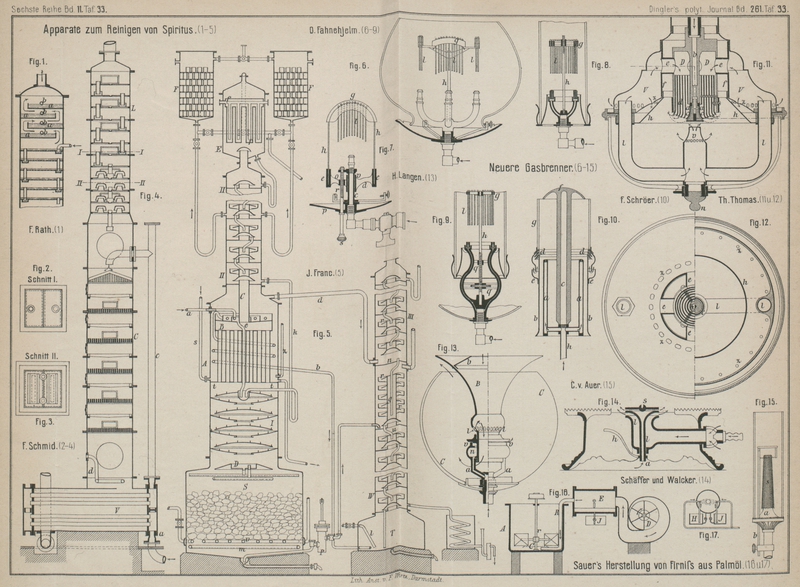| Titel: | Neuere Verfahren und Apparate zur Reinigung von Spiritus. |
| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 542 |
| Download: | XML |
Neuere Verfahren und Apparate zur Reinigung von
Spiritus.
(Patentklasse 6. Fortsetzung des Berichtes Bd. 259
S. 224.)
Mit Abbildungen auf Tafel
33.
Neuere Verfahren zur Reinigung von Spiritus.
Nach R. Eisenmann und J.
Bendix in Berlin (* D. R. P. Nr. 35003 vom 23. Juni 1885) bildet sich bei
der Filtration von Spiritus über Holzkohle durch den in
den Poren der Kohle vorhandenen Sauerstoff Aldehyd. Um dies zu vermeiden, soll die
Filtration unter Luftausschluſs stattfinden und soll sowohl die Kohle, als der
Spiritus vorher luftfrei gemacht werden.
H. Deininger in Berlin (* D. R. P. Nr. 30843 vom 24.
Juli 1884 und Nr. 35510 vom 24. Juli 1885) will Rohspiritus
durch Verbindungen des Bleioxydes und Bleisuperoxydes mit Basen in
Gegenwart von Glycerin reinigen. Dabei soll das Fuselöl
in die entsprechenden Säuren übergeführt werden, unter Ausscheidung von metallischem
Blei.
Die Lösung von Bleioxydkali wird mit so viel Glycerin versetzt, daſs die Alkalescenz
aufgehoben wird. Hiermit wird die eine Abtheilung des verwendeten Apparates
gefüllt, eine andere mit pulverförmigem Kalkhydrat, die letzte mit Holzkohle. Die
Bleioxydkalilösung wird durch eine Dampfschlange erwärmt, damit die Verflüssigung
von Spiritusdämpfen in dieser Abtheilung verhindert wird.
Die Rohspiritusdämpfe gelangen aus dem Maischdestillirapparate in die erhitzte,
Glycerin enthaltende Bleioxydkalilösung. Es sollen dann die mitgeführten Fuselöle in
Baldriansäure, Buttersäure u.s.w. umgewandelt werden, welche mit allen anderen
mitgeschleppten Gährungsproducten, Fett u.s.w., an Kali gebunden werden. Die frei
gewordenen Spiritusdämpfe werden mittels Wasser gewaschen, gelangen in eine
Abtheilung, in welcher die durch die Strömung der Spiritusdämpfe noch mitgerissenen
Gährungsproducte u.s.w. an Aetzkalk oder gebrannte Magnesia gebunden werden, und
schlieſslich in die Kohlenabtheilung, in welcher der von den Spiritusdämpfen
mitgeführte Kalk- oder Magnesiastaub und alle noch mitgeführten Gase von der Kohle
aufgenommen werden. Der Spiritus soll während seines Durchganges durch Kalk oder
Magnesia und Kohle auch von dem denselben begleitenden bitteren Geschmack befreit
werden.
Nach F. Rath in Neuhaldensleben (* D. R. P. Nr. 34117
vom 20. Februar 1885) soll man die Alkoholdämpfe in unmittelbare Berührung mit der
Kühlflüssigkeit bringen, um eine vollständigere Abscheidung
des Fuselöles zu erzielen. Zu diesem Zwecke enthält die Colonne, wie aus
Fig. 1
Taf. 33 zu entnehmen ist, oben offene Becken a, in
welche von einem mit einer entsprechenden Zahl Stutzen versehenen Rohre die
Kühlflüssigkeit eingeleitet wird. Der Zufluſs zu jedem einzelnen Becken ist durch
einen Hahn regelbar, wodurch zugleich auch die geeignetste Temperatur in den Becken
erhalten werden kann. Für jedes Becken a ist an
geeigneter Stelle ein Abfluſsrohr b vorgesehen. Die aus
dem Rectificator emporsteigenden Alkoholdämpfe streichen mit Gegenströmung über die
Kühlwasserflächen hinweg, wobei sie gezwungen werden, die Unreinigkeiten an die
Kühlflüssigkeit abzugeben.
J. Franc in Kolin (* D. R. P. Nr. 35807 vom 8. Juli
1885) will Rohspiritus ununterbrochen in einem einzigen
Apparate durch Destillation in drei Sorten zerlegen. Bei dem zu diesem Zwecke benutzten, in Fig. 5 Taf. 33
dargestellten Apparate wird der Rohspiritus durch Rohr s über dem Boden t in die Abtheilung A eingeführt, steigt bis über den Deckel des Gefäſses
B, flieſst über die spiralförmige Rinne, um durch
Rohr e abzuflieſsen, nachdem dort der Spiritus durch
das Dampfrohr ab erwärmt ist. Die leichtflüchtigen
Bestandtheile entweichen durch Rohr d, der übrige
Spiritus flieſst über den Vertheilungsapparat D in die
Blase S. Die hier entwickelten Spiritusdämpfe steigen
durch Colonne I, die senkrechten Rohre und das Gefäſs
B, das Rohr C und
Colonne II in den kleinen, mit Kühler f versehenen Dephlegmator E und von da abwechselnd durch einen der beiden Entfuselungsapparate F zum Kühler. Diese Entfuselungsgefäſse bestehen aus einer Anzahl
wagerechter Siebe, zwischen welchen kleine, durchlöcherte, oben und unten offene
Töpfe aus Steingut sich befinden, während die Zwischenräume mit Kork und
Korkabfällen, Metallstücken, Holzkohlen, Spodium oder ähnlichen zum Absetzen der
Fuselöle dienenden Körpern angefüllt werden.
Die am Boden der Blase S zurückgebliebene an Alkohol
arme Flüssigkeit sammelt sich in einer Mulde an der tiefsten Stelle des Bodens und
wird von da über den Boden u der höchsten Kapsel der
Colonne IV gefördert, was mittels einer Pumpe P geschehen kann. In dieselbe Colonne flieſst auch der
am Boden der Colonne III über dem Boden n sich ansammelnde Lutter, welcher durch das Rohr g bis an den Boden des weiteren Rohres herunterflieſst,
in demselben aufsteigt und dann über dessen Rand und über eine Anzahl Doppelteller
r an den Boden u
flieſst und hier, vereinigt mit der vom Boden der Blase S anlangenden Flüssigkeit, weiter die Colonne IV durchflieſst und das Product dritter Güte liefert. Die Blase T dient zum Ansammeln der zurückgebliebenen
alkohollosen Flüssigkeit, sowie zum Nachwärmen entweder mittels direkter
Dampfeinströmung durch ein Dampfrohr l, oder auch durch
den bereits gebrauchten Dampf, welcher aus A oder aus
der Blase S ausströmt. Die Heizung der Blase S geschieht durch die Dampfschlange v und ein nach innen gelochtes Dampfrohr m. Darüber
wird die Blase mit Kieselsteinen, Glasscherben, Steinen oder mit ähnlichem, vom
Spiritus nicht angreifbarem Materiale, welches die Verdampfungsfläche vergröſsert,
angefüllt.
Das Rohr k dient zur Ueberführung des Lutters aus
Colonne II in die Colonne I, hat auſserdem aber auch noch den Zweck, den Inhalt des Vorwärmers A unberührt lassen zu können, falls man die Colonnen
II und I von oben
ausspülen will. Bei vollständiger Einstellung des Betriebes läſst man durch das Rohr
z Wasser ein, um den Spiritus in A herauszutreiben, welcher über B ganz verdampft werden kann.
F. Schmid in Darmstadt (* D. R. P. Nr. 36107 vom 30.
December 1885) empfiehlt aus Roststäben gebildete
Colonnenböden. Die zu destillirenden Flüssigkeiten treten bei a (Fig. 4 Taf. 33) in den
Vorwärmer F, dann durch Rohr c in den Colonnenapparat C. Von dem oberen
schrägen Roste fällt die Maische von einem Roste auf den anderen und wird durch die
hochsteigenden Dämpfe, welche durch das Rohr d im
unteren Theile des Apparates einströmen, vollständig entgeistet. Die Schlempe lieſst
in den unter dem Apparate befindlichen Vorwärmer und gibt hier ihre Wärme an die in
den Heizrohren des Vorwärmers befindliche Maische ab. Die aus der Maische
entwickelten Alkoholdämpfe steigen hoch nach der Luttercolonne L und kommen zuerst in vier Haubenböden und dann in
eine Anzahl Siebböden. Die Hauben- und Siebböden bestehen aus zwei oder mehreren
Theilen und können, wenn dieselben gereinigt oder ausgewechselt werden, leicht durch
die am Apparate angebrachten Handlöcher herausgenommen werden. Ebenso können die Roststäbe in der
Maischcolonne durch die Handlöcher herausgenommen und gereinigt werden. Aus der
Luttercolonne steigen die Alkoholdämpfe nach dem Condensator und von da nach dem
Kühler, wo sie vollständig verdichtet werden.
Tafeln