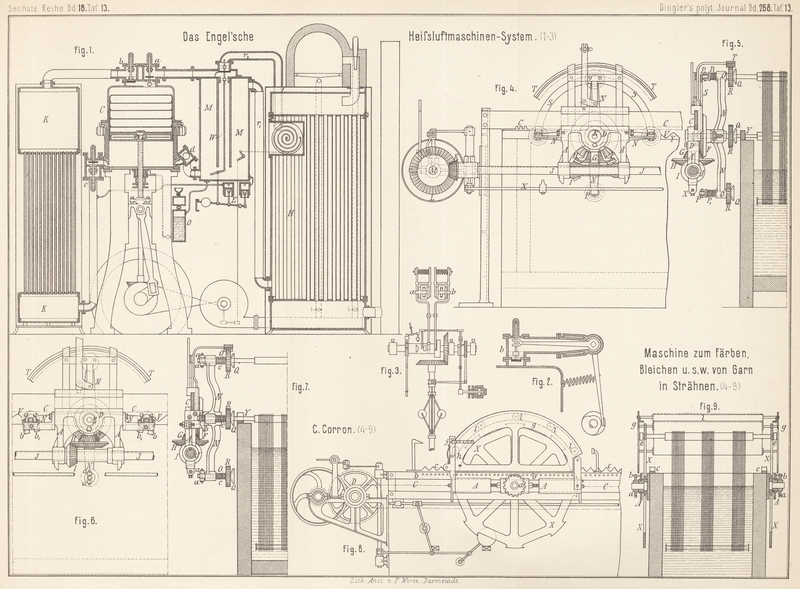| Titel: | Das Engel'sche Heissluftmaschinen-System. |
| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 193 |
| Download: | XML |
Das Engel'sche
Heiſsluftmaschinen-System.
Patentklasse 46. Mit Abbildungen im Texte und auf
Tafel 13.
Das Engel'sche Heiſsluftmaschinen-System.
Eine groſse Unvollkommenheit der bisher in die Praxis eingeführten Heiſsluftmaschinen
lag in deren mangelhafter Geschwindigkeitsregulirung.
Die ohnehin nur für kleinen Kraftbedarf geeigneten Verdrängermaschinen bedürfen der
Bremsregulirung, so daſs diese Motoren bei jeder Beanspruchung den
Brennstoffverbrauch für volle Kraftleistung erfordern.
Für die Maschinen nach den Systemen von Belou, Hock,
Roper u.A. hat man es mit anderen Regulirungen versucht, indes ohne
Erfolg.Vgl. Hock 1880 237 *
94.
Bei dem Hock'schen Motor beeinfluſste der Regulator ein
Ventil, welches comprimirte, aber noch unerhitzte Luft aus der Maschine auslieſs,
sobald deren Gang sich zu sehr beschleunigte. Diese Regulirung wirkte nun zwar,
abgesehen von dem aus dem Abblasen gespannter Luft entstehenden ziemlich erheblichen
Arbeitsverlust, wärmesparend; aber es war doch nicht zu vermeiden, daſs der Druck
der Luft bei geringer Beanspruchung der Maschine stark herabsank – bis auf 0at,1 Ueberdruck – und daſs, wenn die Maschine von
geringer auf volle Beanspruchung, zu welcher 0at,5
Ueberdruck erforderlich waren, übergehen sollte, die fehlende Kraft für einige
Umdrehungen dem Schwungrade entnommen werden muſste, so daſs diese Motoren bei
wechselnder Beanspruchung unregelmäſsig liefen.
An die Construction von geschlossenen Hochdruckmaschinen durch Einschalten eines
geschlossenen Kühlraumes zwischen den Aus- und Einlaſsventilen eines offenen Motors
war unter diesen Umständen nicht zu denken; denn bei solchen Maschinen würden sich
ja alle Uebelstände der offenen Motoren in erhöhtem Maſse zeigen.
Das in Deutschland durch * D.R.P. Nr. 41139 vom 26. Oktober 1886 geschützte Engel'sche System scheint das Problem einer im
Verhältnisse der Kraftleistung wärmesparenden Regulirung bei regelmäſsigem Gange der
Maschine auch für wechselnde Beanspruchung zu lösen.
Der Grundgedanke dieses Systemes ist der, den Druck in den offenen Maschinen sowohl
als die Drucke im Heizraum und Kühlraum der geschlossenen Maschinen nach dem System
Belou u.s.w. gleichbleibend zu erhalten und nun
einen gleichmäſsigen Gang der Maschine dadurch zu erzeugen, daſs die Luftpumpe
gleichen Hubraum wie der Treibcylinder erhält, aber je nach der Kraftleistung
veränderliche Füllung, so daſs bei zu schnellem Gange der Maschine das Diagramm der
Luftpumpe gleich dem Diagramm des Treibcylinders wird, also die Kraftleistung völlig
aufhört, während bei langsamerem Gange noch unerhitzte und nicht gepreſste Luft in
die Atmosphäre oder bei geschlossenen Maschinen in den Kühlraum wieder ausgestoſsen
wird. Diese Wirkung kann
leicht durch eine einfache variable Steuerung des Einlaſsventiles der Luftpumpe
erreicht werden, und eine solche Steuerung erfordert, weil dieses Ventil während des
Einsaugens der Luft nicht belastet ist, nur sehr wenig Kraftaufwand.
Wegen der veränderlichen Füllung der Luftpumpe wird natürlich auch die Zufuhr
gepreſster Luft in den Erwärmungsraum und die damit in unmittelbarem Zusammenhange
stehenden Räume veränderlich sein. Soll nun, wie vorausgesetzt, der Druck in der
Maschine unverändert bleiben, so muſs auch die Erwärmung dieser eingepumpten Luft
eine veränderliche sein.
Wenn die Maschine volle Kraft leistet, und die Luftpumpe also sehr wenig unerhitzte
Luft comprimirt, muſs die Luft gleich wie bei den bisherigen Motoren auf den
höchsten zulässigen Wärmegrad erhitzt werden. Wird dagegen bei Leergang eine
erheblich gröſsere Menge kalter Luft in die Maschine eingeführt, so darf dieser Luft
nur sehr wenig Wärme zugeleitet werden, wenn der Druck nicht steigen soll.
Diese mehr oder weniger starke Erwärmung der Luft regelt ein unmittelbar vom
Luftdruck beeinfluſster Regulator, welcher ein Register, durch welches die aus der
Luftpumpe kommende Luft streichen muſs, entsprechend einstellt, so daſs die Luft
bald durch den Heizraum, bald ohne Erwärmung durch einen Vorraum geleitet wird.
Es sind also zwei zusammengehörige Einrichtungen, durch welche die gewünschte Wirkung
erreicht wird: die veränderliche Füllung der Luftpumpe und das vom Luftdruck
beeinfluſste Register.
Die Fig. 1 bis
3 Taf. 13
zeigen einen geschlossenen Motor dieses Systemes nebst den Armaturen einer Maschine
für gröſsere Kraftleistung.
Die Luft wird aus dem Kühlraum K durch das veränderlich
gesteuerte Ventil c eingesaugt in die von Kühlwasser
umgebene Luftpumpe (auch der Kolben ist gekühlt), welche hier passend mit dem
Treibcylinder zu einem einzigen Cylinder C vereinigt
ist. Die Luft gelangt durch die Klappe d in einen
Vorraum M und von hier je nach der Stellung des
Registers f entweder durch r1, den Heizraum H und r2 oder
direkt und unerhitzt zum Einlaſsventil a des Cylinders,
um von dort nach geschehener Expansion nach dem Kühlraum K zurückzukehren-
Die Einstellung des Registers f besorgt der Regulator
E, in welchem der Luftdruck des Heizraumes
einerseits und der Luftdruck des Kühlraumes andererseits auf einen nach dem
Verhältniſs der gewünschten Drucke getheilten Hebel einwirken, welcher sich bei
unrichtigem Verhältniſs dieser Drucke entweder nach der einen oder der anderen Seite
überlegt und dadurch bei Ueberwiegen des Druckes in H
die Erhitzung der eingepumpten Luft verhindert und das Umgekehrte bei Ueberwiegen
des Druckes in K veranlaſst. Das Gewicht am längeren
Hebelarme gleicht die Differenz des auf den Kolbenflächen lastenden atmosphärischen
Luftdruckes aus.
Weil bei Druckschwankungen Luft aus H nach M übertritt, so wird die Verbindung zwischen dem
unteren Theile von M und dem Register f durch ein von Wärmeschutzmasse umgebenes Rohr W vermittelt, während die etwa aus r1 zurücktretende,
bereits erhitzte Luft im oberen Theile von M
verbleibt.
Für die Ventile gibt Fig. 2 (Auslaſsventil b
Fig. 1) eine
Construction mit Wasserkühlung, welche höchste Betriebsdauer sichert und
Luftverluste verhindert.
Letztere könnten nur an der Stopfbüchse der Kolbenstange vorkommen, und um hier die
Reibung nicht unnöthig zu vermehren, ist oberhalb der Stopfbüchse ein
Flüssigkeitsbehälter eingeschaltet, welcher aus dem seitlich angebrachten, unter dem
Ueberdruck aus M stehenden Behälter O leicht gefüllt werden kann.
Als Heizraum kann jede Vorrichtung zum Dampfüberhitzen dienen. Die in Fig. 1 gegebene Anordnung
sucht eine zu starke Erhitzung bezieh. ein Erglühen der Wandungen des Heizraumes
durch Zumischen kalter Luft zu den Feuergasen zu verhindern.
Fig. 3 gibt
eine Ansicht der Steuerung, welche wohl etwas umständlich erscheint. Es ist nämlich
noch eine Vorrichtung zum Stillsetzen der Maschine beigefügt, welche durch dauerndes
Offenhalten der Ventile b und c und dauernden Schluſs des Ventiles a
erreicht wird, so daſs die Drucke in H und K unverändert bleiben und der Motor ohne Weiteres
wieder in Gang gesetzt werden kann.
Einfacher wäre letzteres durch ein in das von f nach a führende Rohr einzuschaltendes Absperrventil zu
erreichen. Würde man letzteres langsam schlieſsen, so würde der Widerstand der Luft
die Maschine alsbald bei gleichfalls unveränderten Drucken in H und K zum Stillstand
bringen. Auch würde dann bei Anwendung von zwei Cylindern ein Anlassen aus dem
Stande möglich sein.
Bei diesen Maschinen ist der Umsatz von Wärme in Arbeit bei jeder Beanspruchung ein
gleich günstiger wegen der unveränderten Höhe der Compression und Expansion nach der
adiabatischen Curve der permanenten Gase. Die Maschine verbraucht also Wärme nur der
Kraftleistung entsprechend.
Was die Maximalleistung dieser Motoren anbelangt, so ist dieselbe für offene
Maschinen natürlich gleich derjenigen der bisherigen offenen Motoren bei gleichen
Druck- und Wärmeverhältnissen. Erhöht man aber den Druck und erniedrigt die Wärme,
was bei den Motoren des neuen Systemes thunlich ist, so nimmt die Kraft der Maschine
durchaus nicht ab. So z.B. leistet eine offene Maschine bei 0at,5 Ueberdruck und 530° noch eben so viel Arbeit,
als eine Maschine von gleicher Dimension des Treibcylinders bei 2¼at Ueberdruck und 300°.
Geschlossene Maschinen leisten bei 6at,5 absolutem
höchsten Druck, 200° im Heizraum und 30° im Kühlraum das gröſste Maſs von Arbeit,
wenn sich die Drucke
im Heizraum und Kühlraum verhalten wie 1,77 : 1, was durch dementsprechende
Eintheilung des Hebels am Regulator E (Fig. 1) leicht zu
erreichen ist. Die geleistete Arbeit beträgt dann nominell bei einem Hubvolumen von
1cbm etwa 5750mk.
Rechnet man hiervon nur die Hälfte als effective Leistung, so bleiben effectiv etwa
2850mk, also etwa 38 bei 60
Umdrehungen in der Minute.
Textfig. 1 und 2
zeigen die Diagramme für volle Kraft und Leergang; defg
ist das Diagramm des Treibcylinders und abcd bezieh.
gbcd dasjenige der Luftpumpe. Die bei den
geschlossenen Maschinen vorkommenden Luftverluste werden durch eine in der Zeichnung
nicht angeführte Luftersatzpumpe ausgeglichen, welche in Thätigkeit tritt, sobald
der Druck im Kühlraum unter das festgesetzte Maſs sinkt.
Fig. 1., Bd. 268, S. 196
Fig. 2., Bd. 268, S. 196
Tafeln