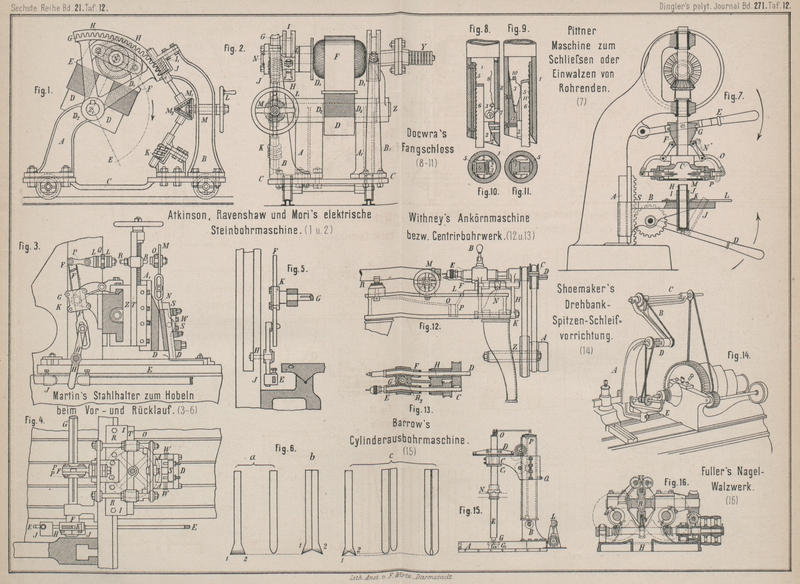| Titel: | A. Whitney's Ankörnmaschine (Centrirbohrwerk). |
| Autor: | Pr. |
| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 251 |
| Download: | XML |
A. Whitney's Ankörnmaschine (Centrirbohrwerk).
Mit Abbildungen auf Tafel
12.
Whitney's Ankörnmaschine (Centrirbohrwerk).
Die Körnergrübchen an Werkstücken, Wellen, Spindeln u. dgl., die zum Abdrehen
bestimmt sind, bequem anzubohren, dient die Maschine von A.
Whitney in Hartford, Connecticut, Amerika. Die
Eigenthümlichkeit dieser kleinen Bohrbank besteht nach dem Englischen Patente Nr.
1147 vom 25. Januar 1888 in dem um einen Bolzen K (Fig. 12)
schwingenden Spindelstocke H, in welchem zwei parallele
Spindeln lagern, von denen die eine C (Fig. 13) zum Bohren des
Körnerloches, die andere D zum Versenken oder Ausfräsen
des Kegelloches zum Einsatze für die Drehbankspitzen bestimmt ist. Der Antrieb
derselben erfolgt mittels zwei entsprechend versetzter Riemenrollen, die von einer
um den festen Zapfen Z umlaufenden Stufenscheibe A bethätigt werden, deren Durchmesser so bemessen sind,
daſs die Fräserspindel zum Versenken langsamer kreist als die Bohrerspindel. Ein
Schiebestift N im Spindelstocke legt sich in die
Bohrung einer festen Winkelplatte L, wodurch jedesmal
eine der beiden Spindeln genau in die Achse des Werkstückes gebracht und in dieser
Lage sichergestellt wird. Der Vorschub der Spindeln in der Achsrichtung erfolgt
durch eine Handkurbel B mittels eines
Zahnstangengetriebes G, das gleichzeitig in beide
Spindelhülsen E und F
eingreift und bei dessen Drehung eine gegensätzliche Verschiebung der Bohrwerkzeuge
bedingt, so daſs der eine Bohrer zurückgeht, wenn der andere vorrückt.
Das Werkstück wird durch eine selbstcentrirende Spannvorrichtung M genau in die Bohrerachse eingestellt und vermöge
eines Bockchens R genügend unterstützt. Das Kühlwasser
läuft durch das Bohr P aus dem trogförmigen Wangenboden
O in ein untergestelltes Gefäſs.
Mit dieser Maschine wird das Ankörnen vieler gleichartigen, kürzeren Drehstücke entschieden
beschleunigt. (Ueber Maschinen zum Ankörnen und Richten vgl. Ferris 1877 235 * 543, Richards 1886 262 * 112, Kendall und Gent 1887 266 *
362.)
Pr.
Tafeln