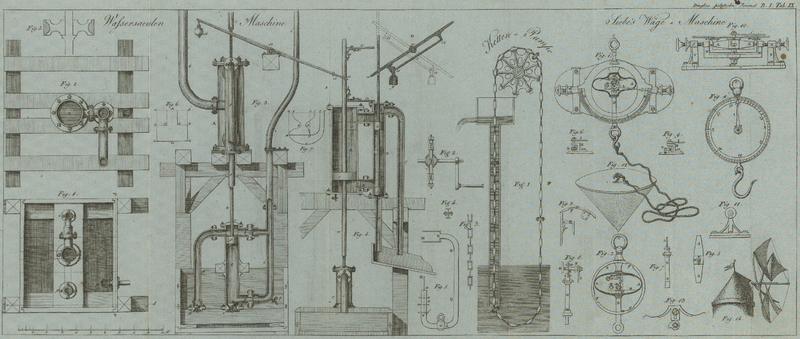| Titel: | Erklärung eines dem August Siebe in Nro. 6, Crownstreet, Soho, in der Grafschaft Middlesex, ertheilten Patentes auf eine verbesserte Wäge-Maschine. |
| Fundstelle: | Band 1, Jahrgang 1820, Nr. XLI., S. 415 |
| Download: | XML |
XLI.
Erklärung eines dem August Siebe in Nro. 6, Crownstreet, Soho, in der Grafschaft Middlesex, ertheilten Patentes auf eine verbesserte Wäge-MaschineAus dem Repertory
of Arts, Manufactures et Agriculture. Second Series. No. CCXIII.
Febr. 1820..
Mit Abbildungen. Tab. IX.
Siebe's Wäge-Maschine.
Ich Augustus Siebe erklaͤre,
daß meine Erfindung in folgender Beschreibung und Zeichnung deutlich dargestellt
ist: Meine verbesserte Waͤge-Maschine besteht naͤmlich aus
einem Haͤlter oder einem Gestelle von irgend einer schicklichen Form und
Groͤße, worin eine oder mehrere Federn liegen, welche eyfoͤrmig, an
der Spize und am Grunde verdickt, und allmaͤhlig gegen die Seiten hin
verduͤnnt sind; statt der ovalen Form koͤnnen die Federn auch auf
verschiedene andere Weise gebogen seyn, wenn sie nur die Wirkung einer Feder ohne
Ende hervorbringen, auf welcher meine Erfindung als leztem Grundsaze beruht. Diese
Feder muß an der oberen Seite an dem Henkel oder Griffe der Maschine (der nach
Belieben mit einer Scharniere versehen seyn kann oder nicht) und der durch den Rand
des Haͤlters oder Gestelles laͤuft, befestiget seyn; eben so muß sie
auch an der unteren Seite mit einer herabhaͤngenden Stange in Verbindung
stehen, welche an ihrem unteren Ende mit einem Haken oder Ringe versehen ist, um an
demselben ein bestimmtes Gewicht oder eine bekannte Kraft zu befestigen.
An dem oberen Ende dieser herabhaͤngenden Stange befindet sich ein Arm,
welcher mit einem Hebel in Verbindung steht, der an dem Mittelbaume befestigt ist.
Dieser Mittelbaum fuͤhrt einen Weiser oder Zeiger, welcher sich auf einem
Zifferblatte bewegt, und das Gewicht oder die Kraft, welche durch den Zug der
haͤngenden Stange hervorgebracht wird, und folglich auch die Seitenausdehnung
der Feder selbst anzeigt.
Statt des oben erwaͤhnten Hebels kann ich auch an der haͤngenden Stange
einen ZahnstockDer Uebersezer erlaubt sich diesen oberdeutschen Ausdruck, statt des
reineren, aber laͤngeren hochdeutschen: „gezaͤhnten
Kolbenstange.“
anbringen, der in ein Triebrad am Mittelbaume eingreift: durch den Zug an
der haͤngenden Stange wird dann der Zahnstock den Weiser oder Zeiger das
angewandte Gewicht anzuzeigen noͤthigen. Am unteren Ende oder an der Ferse
des Zahnstockes ist eine kleine Feder, um denselben stets auf das Triebrad einwirken
zu lassen, und die Hauptfeder oder Federn zu regeln oder zu verstaͤrken, was
in einigen Faͤllen noͤthig seyn duͤrfte. Ich stelle eine kleine
Feder, die der Hauptfeder entgegen wirkt, so daß sie dieselbe, wenn sie sich zu sehr
verlaͤngert, oder in ihrer Kraft nachlaͤßt, staͤrkt oder
stuͤzt.
Allein ich beschraͤnke mich nicht auf die in meiner Zeichnung dargestellte
besondere Form der Feder; da eine große Mannigfaltigkeit in den Formen derselben bei
der Anwendung statt hat, wenn man dadurch die Kraft regeln will. Das Zifferblatt muß
an der inneren Seite des Haͤlters oder Gestelles eingefalzt werden, wo
mehrere Ausschnitte zur Aufnahme der Ohren des Zifferblattes sind, die in dieselben
passen und in dem Falze sich drehen.
Diese Maschine laͤßt sich auch zur Bestimmung der Geschwindigkeit, mit welcher ein Schiff oder Both
in seinem Laufe sich fortbewegt, benuzen. Zu diesem Ende haͤnge ich die
Maschine in eine Unterlage, durch welche sich dieselbe nach jeder Richtung bewegen
kann, nemlich, fuͤr die verticale Bewegung der Unterlage dienen zwei
Baͤume mit Zapfen, und fuͤr die horizontale der Maschine eine
Centralstuͤze oder Achse, die an dem Haͤlter befestigt ist, und in
einen Schuh der Unterlage faͤllt. Nachdem dieses geschehen ist, bringt man
eine Leine an dem untern Ringe der haͤngenden Stange an, und an dem andern
Ende dieser Leine, welches in das Wasser faͤllt, einen flottenden
Koͤrper von konischer oder beliebiger Form, welcher einen Widerstand in dem
Wasser finden wird, der mit der Geschwindigkeit des Fahrzeuges in Verhaͤltniß
steht. Dieser Widerstand wirkt auf die Feder oder auf die Federn in der Maschine auf
die oben angezeigte Weise, und die Kraft oder das Gewicht, welches mit der
Geschwindigkeit der Bewegung des Fahrzeuges im Gleichgewichte steht, wird durch den
Weiser oder Zeiger auf dem Zifferblatte angezeigt, welches zu diesem Zwecke
besonders eingetheilt werden muß. Das Zifferblatt muß uͤberhaupt sowohl zur
Bestimmung des Gewichtes als der Kraft, wie auch zur Anzeige der Schnelligkeit eines
Fahrzeuges nach angestellten Versuchen eingetheilt werden: denn, da die
Elasticitaͤt und Kraft an den Federn sowohl, als das Gewicht und das
Schwimmen des flottenden Koͤrpers sehr verschieden ist, so laͤßt sich
keine Regel oder kein Maßstab im Allgemeinen bestimmen, wornach die Eintheilungen
auf dem Zifferblatte gemacht werden koͤnntenWir wollen hoffen, daß Hr. Siebe mit seiner Maschine wohl nicht die Geschwindigkeit
eines Schiffes bei hohler See bestimmen will, und koͤnnen nicht umhin
zu bemerken, daß eine etwas aͤhnliche Maschine zur Bestimmung der
Kraft eines Menschen, ein wahrer Mannsstaͤrke-Messer, (den wir
jedem Fabrikanten empfehlen, der starke Arme braucht, und die wahre
Staͤrke seiner Arbeiter mit der hoͤchsten Genauigkeit und
Bestimmtheit kennen lernen will) in dem trefflichen Dictionnaire des Sciences médicales beschrieben ist. (Anm. d. Uebers.).
Fig. 1.Tab. IX. im Originale. (Anm. d. Uebers.) stellt die Maschine in horizontaler Ansicht so dar, als ob man durch das
Zifferblatt in das Innere derselben saͤhe. In dieser Einrichtung ist sie
ausschließlich zur Bestimmung der Schnelligkeit des Laufes eines Fahrzeuges
gebaut.
Fig. 2 zeigt
sie als Waͤgemaschine: das Zifferblatt ist abgenommen, und man sieht die
innere Einrichtung derselben. A ist die Hauptfeder oder
die Hauptfedern von ovaler oder irgend einer andern endlosen Form. Dieselben
Buchstaben bezeichnen in jeder Figur denselben Theil. a ist die
Compensations- oder Ordnungsfeder. B die
Schnecke, welche diese Compensationsfeder gegen die Hauptfeder hebt oder zwingt. C der Griff oder Henkel, an welchem die Maschine
gehalten oder aufgehangen wird, mit oder ohne eine Spize bei C
Dieser Buchstabe fehlt im Originale bei Fig. 2, ist aber
bey Fig.
4. (Anm. d. Nebers.). D hie haͤngende Stange, an welcher das
Gewicht oder die Kraft angebracht wird. E der Arm an der
haͤngenden Stange verbunden mit dem Hebel F
Fehlt in Fig. 2, im Originale und muß dort fehlen, da hier die Maschine
mit einem Zahnstocke vorgerichtet ist. Auch in den uͤbrigen Figuren
ist er nicht deutlich. Es fehlen an Fig. 2 die
meisten hier angefuͤhrten Buchstaben. (Anm. d.
Uebers.) Ich habe sie zur besseren Verstaͤndlichung
ergaͤnzt. Dingler.. F der Hebel auf dem Mittelbaume oder auf der
Achse G. G der Mittelbaum
oder die Achse, die den Weiser oder Zeiger fuͤhrt, und von dem H gestuͤzt wird. I
der Weiser oder Zeiger, welcher sich auf dem Zifferblatte bewegt. H das
Zifferblatt mit seinen Eintheilungen. L der Zahnstok,
wie er in Fig. 2
angewandt ist, mit seiner Feder an der Ferse. M die
Feder an der Ferse, um den Zahnstock stets in das Treibrad eingreifen zu machen. N das Triebrad an dem Mittelbaume oder an der Achse,
welches den Zeiger fuͤhrt, statt des Hebels F
(Fig. 1)
gestuͤzt von dem Ohre H.
Fig. 3 ein
Theil des Haͤlters oder Gestells und Zifferblattes von der Seite gesehen, wo
o die Kante des Zifferblattes p zeigt, die Ohren, wodurch dasselbe in dem Rande des Haͤlters oder
Gestells befestigt wird, indem diese in die Ausschnitte q am Rande des Haͤlters oder Gestelles R fallen.
Fig. 4. Das
Zifferblatt von vorne gesehen. Es ist verschieden von jenem in Fig. 1, und fuͤr
Fig. 2
berechnet.
Fig. 5 zeigt
die Hauptfeder von oben und von unten in jener Form, die ich vorziehe. S ist der obere und untere Theil, woran die Henkel C und D an der Hauptfeder
angebracht sind. T bezeichnet den dickern Theil der
Feder.
Fig. 6 zeigt
das Triebrad N und das Ohr H
als abgenommen mit einem Theile des Zeigers oder Weisers I.
Fig. 7 stellt
die haͤngende Stange D und den Zahnstock L in Verbindung mit derselben, wie in Fig. 2, dar.
Fig. 8 zeigt
die Haͤngende Stange D in Verbindung mit dem Arme
E und dem Hebel F auf
dem Mittelbaume G, wie in Fig. 1, wo er den Zeiger
I dreht.
Fig. 9 stellt
den Hebel F auf der Achse oder auf dem Mittelbaume G, gestuͤzt von dem Ohre H, und einem Theil des Haͤlters oder Gestells R dar.
Fig. 10 ist
ein Durchschnitt der Maschine Fig. 1, und zeigt die Baͤume vv, die
Unterlage nn, wie sie an den Zapfen xx aufgehaͤngt sich schwingt, und die
Centralstuͤze y am Grunde des Haͤlters
oder Gestelles, welche in den Schuh
Z der Unterlage eingreift, und die Maschine horizontal
sich schwingen laͤßt.
Fig. 11. Das
Gestell mit den Tragbaͤumen V von einer seiner
Endseiten.
Fig. 12
stellt den flottenden Koͤrper dar.
Fig. 13. Die
Compensationsfeder um die Hauptfeder in gehoͤriger Spannung zu erhalten
fuͤr den Fall, daß sie durch Aenderung der Temperatur angegriffen
wuͤrde. Diese Compensationsfeder muß aus zwei oder mehreren Metallen von
ungleicher Dehnbarkeit gemacht werden.
Urkunde dessen etc.
Tafeln