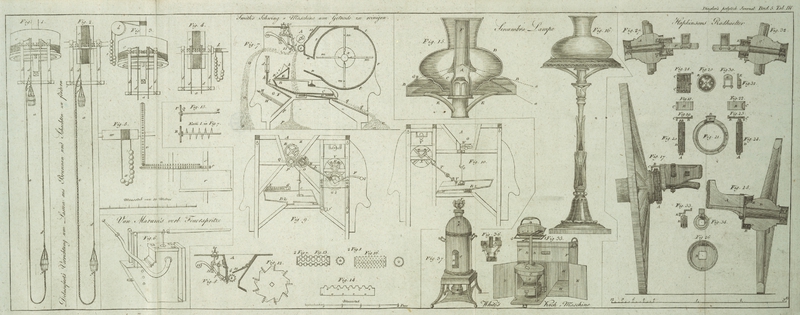| Titel: | Die Sinumbralampe. |
| Fundstelle: | Band 5, Jahrgang 1821, Nr. XXIX., S. 142 |
| Download: | XML |
XXIX.
Die Sinumbralampe.
Aus dem 19 Stuͤke (1820.) des Quarterly Journal of Science, Literature and the Arts.
Mit Abbildungen auf Tab. III.
Die Sinumbralampe.
Die franzoͤsische Lampe, die in ihren verschiedenen
Formen als Tisch- und Studierlampe so zwekmaͤßig und beliebt ist,
hatte doch einige auffallende Maͤngel, welchen unlaͤngst der Englaͤnder Parker gluͤklich abgeholfen hat. Der runde
Oelbehaͤlter wirst eine breite Schattenlinie gerade auf die Gesichter der um
einen Tisch sitzenden Personen. Der Lichtglanz, der auf den Tisch geworfen wird,
ohne durch ein milderndes, oder den Strahl brechendes Medium zu gehen, ist den Augen
sehr schaͤdlich, und zumal empfindlich, sobald der helle Schein der Flamme
unter dem Oelbehaͤltnisse, wenn man sich vorwaͤrts beugt, das Auge
trifft. Der dritte Nachtheil endlich, den alle aͤhnliche Lampen gemein haben,
besteht in der Verschwendung des Lichts, wo es ganz unnuͤz ist. Dem ersten
Mangel hat Parker durch eine neue Form des
Oelbehaͤlters und die Anwendung des mattgeschliffenen Glases als
Lichtvertheiler, abgeholfen. Diese beiden Verbesserungen verhindern alle Schatten,
daher der Name Sinumbra-Lampe. Dem zweiten
Nachtheile hilft insbesondre die gaͤnzliche Einschließung der Flamme in einen
Lichtvertheiler von matt geschliffenem Glase ab. Dieser bricht das Licht in
unzaͤhlige Strahlen, da das Glas beim Mattschleifen eine unendliche Menge
kleiner Bruͤche erhalten hat, welche bei mikroskopischer Betrachtung als eben
so viele kleine Sterne erscheinen, aus welchen das Licht, wie aus einem neuen
Mittelpunkte der Beleuchtung strahlt, wodurch ein sanftes Licht entsteht. Der sonst
vom Oelbehaͤlter geworfene Schatten wird auf diese Weise verhuͤtet.
Das lezte Erforderniß einer vollkommenen Lampe, ein starkes, angenehmes und
unmittelbar unter derselben gleich vertheiltes Licht zu geben, welches dergestalt
von der Flamme ausgeht, daß es einen Tisch erleuchtet, um welchen zehn Personen bequem sizen
koͤnnen, und zugleich den obern Theil des Zimmers hinlaͤnglich
erhellet, ist durch Parkers Vorrichtung sehr befriedigend erfuͤllt worden. In
dem Mittelpunkt des mattgeschliffenen Lichtvertheilers ist ein metallener Reflektor
vermittels metallener Federn auf dem Glas-Cylinder, nahe an der Flamme, oder
vielmehr uͤber deren Mittelpunkte angebracht, wodurch das helleste Licht auf
den Tisch geworfen wird, aber noch genug zur Erleuchtung des obern Raumes im Zimmer
uͤbrig bleibt. Durch diese Hilfsmittel gewinnt man die Lichtstaͤrke
von zwei franzoͤsischen Lampen, ohne groͤßern Oelaufwand, und ohne
irgend eine nachtheilige Wirkung auf das Auge. Nach beiliegender Abbildung wird die
Lampe leicht herzustellen sein. In A
Fig. 15.
Tab. III. ist der Mittelpunkt der Erleuchtung. B ist das
Oelbehaͤltniß, dessen obere und untre Flaͤche so gestaltet sind, daß
sie mit der Richtung der, aus dem Mittelpunkt der Flamme (A) nach a strahlenden Linien gleichfoͤrmig laufen. C der metallene Reflektor; D
der mattgeschliffene Lichtvertheiler, E die
Leitungsroͤhren des Oels zur Dille; F der
Glascylinder, G der Schraubenstoͤpsel auf der
Oeffnung zum Eingießen des Oeles.
Fig. 16.
zeigt die vollstaͤndige Lampe.
Tafeln