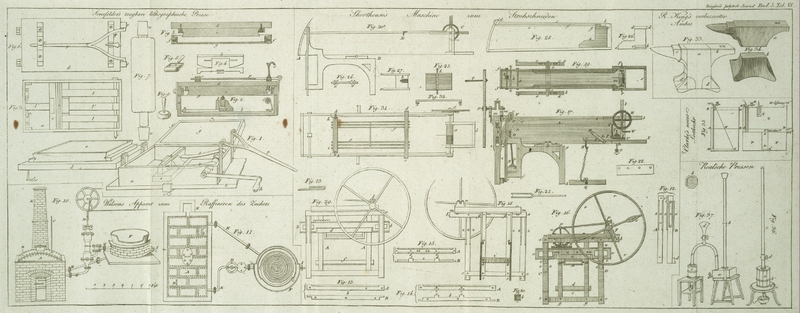| Titel: | Ueber Wilson's neues Verfahren beim Raffiniren des Zukers. |
| Fundstelle: | Band 5, Jahrgang 1821, Nr. XLVI., S. 262 |
| Download: | XML |
XLVI.
Ueber Wilson's neues Verfahren beim Raffiniren des ZukersWir haben uͤber
Wilson's Raffinerie bereits im 1. Hefte unseres
Journals S. 76. gesprochen; allein es war uns damals, wo wir die
Erklaͤrung seines Patentes uͤbersezten, noch kein Aufriß seiner
Heizungs-Anstalten bekannt, der hier zuerst geliefert wird. Anm. d.
Uebers..
Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. Jaͤnner 1821. S. 24. Frei uͤbersezt.
Mit Abbildungen auf Tab. VI.
Wilson's neues Verfahren beim Raffiniren des Zukers.
Die gewoͤhnlichen Feuerungs-Anstalten bei
Zuker-Raffinerien sind insofern mangelhaft, als durch unmittelbare Anwendung
des Feuers unter dem Kessel, der Syrup, und wohl gar das ganze Gebaͤude der
Raffinerie in Gefahr ist anzubrennen, wenn dieser in das Feuer
uͤberlaͤuft. Man hoffte diesem Nachtheile dadurch abhelfen zu
koͤnnen, daß man Metallroͤhren durch die Kessel leitete, in welchen
siedendes Wasser durchlief. Da aber der Syrup nicht bei jener Temperatur siedet, bei
welcher das Wasser kocht, so mußte dieses bis zu einem Grade erhizt werden, wo sein Druk
gefaͤhrlich werden konnte.
Herr Harris, Raffineur zu Liverpool, nahm Talg statt des
Wassers, kochte aber den Talg in einem offenen Kessel, in welchen er den Zukerkessel
mittelst dreier an einem Hebel befestigter Ketten einsenkte. Allein der geschmolzene
kochende Talg verbreitete solchen hoͤllischen Gestank in der ganzen
Raffinerie, und die Daͤmpfe davon schlugen sich so maͤchtig nieder,
daß Farbe und Geschmak des Zukers so gewaltig davon litt, daß Niemand diesen Zuker
kaufen wollte.
Herr Wilson bedient sich, um den Syrup zum Sieden zu
bringen, (des noch stinkenderen) Thranes, den er bis zu jenem Grade erhizt, wo der
Syrup siedet; er laͤßt ihn aber in wohl verschlossenen Roͤhren um den
Kessel laufen.
Sein Apparat besteht aus einem Kessel von starkem Bleche A (Fig.
10–11. Tab. VI.) welcher 9 Fuß lang, 3 Fuß breit, und 13 Fuß tief ist, und 4
Zentner Thran fassen kann. Dieser Kessel, untermauert mit einem gewoͤhnlichen
Ofen aus Baksteinen, steht durch kupferne Roͤhren E und G mit einem Zukerkessel F in Verbindung, welcher mit einem hoͤlzernen
Kranze umgeben ist, damit er seine Hize desto laͤnger behalte. Die
Roͤhre G windet sich in einer Spirallinie um den
Grund des Kessels, und endet sich in eine andere Entladungsroͤhre H, welche an dem entgegengesezten Ende in den Kessel
sich entleert. Eine Pumpe aus Gußeisen, D, die
uͤber der Roͤhre E angebracht ist, zieht
den Thran auf, und bringt ihn in die Durchlaufsroͤhren.
An der Deke des Kessels ist ein Queksilberthermometer B
angebracht mit Fahrenheit'schem Maßstabe zu 450 Graden. Diese Roͤhre taucht
in den Thran, um den Grad der Erhizung desselben anzuzeigen: steigt diese zu hoch,
so springt die Roͤhre, und zeigt dadurch, daß man das Feuer maͤßigen
mußMan koͤnnte wohl leicht einen anderen
Maßstab zu großer Erhizung, als ein Thermometer, das im Falle derselben
bricht, hier anwenden. A. d. Ueb.. Man faͤngt an, den
Thran bis aus 350° Fahrenh. (132 Réaumur)
zu erhizen, und zieht dann mittelst der Pumpe D
denselben in die um den Kessel sich windende Roͤhre, in welcher er immer
umherlaͤuft, bis er durch H wieder in den Kessel
zuruͤk gelangt. Da der Syrup bei 240° Fahrenh. (90° Réaumur) zu sieden anfaͤngt, so
laͤßt sich begreifen wie der Thran, dessen Hize um so vieles hoͤher
ist, so lang die Pumpe in Thaͤtigkeit bleibt, den Syrup im Sude erhalten muß,
und dieß zwar ohne alle Schwierigkeit und ohne alle Gefahr.
Man hat behauptet, daß der Syrup, wenn er bis auf einen gewissen Grad erhizt wird,
faͤhig wird sich selbst zu entzuͤnden. Herr Wilson hat uͤber diesen Punkt Erfahrungen angestellt, aus welchen
erhellt, daß der Syrup bei einer Temperatur von 344° Fahrenh. (129°
Réaumur) sich zersezt und Daͤmpfe
ausstoͤßt, welche sich erst bei 370, 386 und selbst 398° Fahrenh.
(139°, 145°, 150° Réaumur)
entzuͤnden. Was den Thran betrifft, den man gleichfalls fuͤr sehr
entzuͤndlich hielt, so versichert Herr Wilson, daß
er es erst bei 600° Fahrenh. (226° Réaumur) wird, einer Temperatur, die gar viel hoͤher ist,
als diejenige, welche man zum Sieden des Syrupes noͤthig hat. Herr Parkes hat erwiesen, daß zwar wirklich bei 350°
sich Daͤmpfe entwikeln, daß sie aber erst bei 590° (222° Réaumur) mit einer schwachen Flamme brennen, und
in 4 Minuten nur 8 Kubikzoll auf das Gallon (4 litres)
Thran betragen, waͤhrend sie bei 620° Fahrenh. (233 Réaumur) in einer Minute auf 32 Kubikzoll steigen
und sich dann von selbst entzuͤndenDieser Gegenstand veranlaßte einen merkwuͤrdigen Rechtsstreit,
woruͤber im Maiheft 1820 in Tillochs
Philosophical Magazine
ein
ausfuͤhrlicher Bericht erstattet ist, wovon wir hier in Kuͤrze
das Wesentliche mittheilen. Eine nach diesen Grundsaͤzen betriebene
Zukerfabrike brannte ab, welche bei der Phoͤnixgesellschaft mit 8000
Pfund verassekurirt war, deren Verguͤtung die Gesellschaft aus dem
Grunde verweigerte, weil statt der gewoͤhnlichen Feuerung die Heizung
durch heißes Oel geschah. Das Verfahren, die Zukergebende
Fluͤssigkeit durch heißes Oel zu erhizen, hatten Sachkenner fast
allgemein fuͤr sicherer und gefahrloser gehalten, wogegen aber neuere
Erfahrungen zu sprechen schienen, besonders wenn, wie in diesem Falle, Thran
angewandt wurde. Um diese Frage auf sachgemaͤße Gruͤnde zu
entscheiden, vernahm der Richter mehrere gelehrte und praktische Chemiker,
worunter sich die H. H. Brande, Accum, Faraday, Samuel
Parkes, W. Allen, Cooper, Bostok, Phillips, Daniell, Ackin, Wilson
und A. befanden. Zuerst suchte Wilson, Erfinder
des neuen Verfahrens zu zeigen, daß das Oelbad sich durch mindere Gefahr
auszeichne. Bei der freien Feuerung ließe sich die Hize nicht
gleichmaͤßig temperiren: es koche daher der aufgeloͤste Zuker
bei 245° F., und entwikle schon bei 344° brennbares Gas, der
Thran aber erst bei 600. Der bekannte Chemiker Parkes bestaͤttigte dieß im Allgemeinen. „Ich
mischte,“ sagte er, „fuͤnf Unzen Zuker mit
dem zum Aufloͤsen desselben erforderlichen Wasser; diese
Aufloͤsung siedete bei 230°, und diese Temperatur dauerte
eine Zeitlang fort, bis das Thermometer nach und nach auf 340°
stieg, wobei sich ein Gas entwikelte, das mit einer starken und
dauernden Flamme brannte, zumal nachdem die Temperatur sich endlich zu
370° erhoben hatte. Der Thran dagegen, besonders der alte, gibt
erst bei 590° ein brennbares und zwar, auch nicht permanent
brennbares Gas. (Als man ihn fragte, was man unter permanent brennbarem
Gase verstehe, antwortete er, es sey in solches, das nach dem
Zuruͤkziehen des anzuͤndenden Lichts zu brennen
aufhoͤre). Erst bei 600° kocht das Oel und stoͤßt
fortbrennende Daͤmpfe aus.“ – W. Brande sagte, daß er bei der Kuͤrze der
Zeit nur wenige Untersuchungen uͤber diesen Fall habe
anstellen koͤnnen, die ihn aber ebenfalls die groͤßere
Gefahrlosigkeit des Oelbades in den Zukerraffinerien zu beweisen schienen.
Er habe Zuker in einem Oelbade gekocht, und die Temperatur genau bemerkt:
der Zuker sey schon zwischen 300 bis 400° verbrannt; waͤhrend
der Thran keinen Dampf ausgestoßen, der sich durch brennendes Papier hatte
entzuͤnden lassen. Erst bei etwa 600° habe der Thran einen
brennenden Dampf gegeben. – Accum
unterschied den frischen von dem alten Thran. Der frische gebe nach seinen
Versuchen erst bei 600° brennbare Daͤmpfe; der aͤltere
fruͤher, doch auch erst bei 560°. Der Zuker brenne aber schon
bei 350°, und es muͤße daher eine Entzuͤndung auf jeden
Fall eher vom Zuker ausgehen, als von dem Oelbade, dessen Temperatur in
diesem Falle nie zur Siedehize hatte steigen koͤnnen. Dagegen bringe
der in andern Fabriken oft uͤberkochende Zuker große Gefahr, indem
dieser Koͤrper hoͤchst brennbare Gase gebe. – Allen hielt den Unterschied von frischem und
altem Thran hier nicht fuͤr sehr bedeutend, gab uͤbrigens aber
ebenfalls dem neuen Verfahren das beßte Zeugniß. Mit weniger Abweichung
sprachen die Chemiker Barry, Sylvester, Cooper
u.a. uͤber die Brenn- und Siedepunkte des Thrans und
Zukers.Dagegen aber stellte der Anwald der Phoͤnixgesellschaft mehrere
gelehrte Chemiker und Technologen auf, welche das Oelbad fuͤr
Feuergefaͤhrlicher hielten, als das unmittelbare Erhizen des Zukers.
Faraday Esq., chemischer Operateur an der
Royal-Institution behauptete, daß der Thran schon bei 340° F.
brennbare Daͤmpfe und zwar von betraͤchtlichem spezifischen
Gewicht ausstosse. (Accum hatte alle brennbare
Daͤmpfe und Gase ohne Ausnahme fuͤr leichter als die
atmosphaͤrische Luft erklaͤrt), und daß ein mehrmal gekochter
oder durch Roͤhren getriebener Thran immer entzuͤndlicher
werde, und sogar Explosionen veranlasse. – Richard Phillips sagte, daß das fixe Oel in der Hize leicht ein
fluͤchtiges Oel entwikle, und daß nach seinen Versuchen dabei eine
Zersezung und Wasserbildung vorgehe, weshalb das Oelbad
sehr gefaͤhrlich sey. – Dr. Bostock, Arzt und Lector der Chemie an Guyhospital statuirte eine
Entzuͤndung des Thrans bei 360 bis 460° und hielt ebenfalls
das Oelbad fuͤr sehr feuergefaͤhrlich. – Arthur Aikin ließ sich besonders
ausfuͤhrlich uͤber die Eigenschaften des Walfischoͤls
aus. Er sagte: „diese Fettigkeit, sey im frischen Zustande
zaͤh und klebrig, indem sie viel thierischen Leim enthalte; wenn
man sie aber erhize, so zerseze sie sich, und gebe ein sehr brennbares
und fluͤchtiges Oel. Diese Fluͤchtigkeit werde durch
Destillation nach und nach so vermehrt, daß wenn man das Oel auf die
Hand gieße, dasselbe verdunste wie Weingeist. Bei der Zersezung des
Walfischoͤls in der Hize seze sich am Boden des Gefaͤßes
eine kohlige Masse ab, worin die Hize sich weit starker anhaͤufe,
als durch das Thermometer in der Maͤßigkeit angezeigt
wuͤrde. Der Thran gebe uͤberhaupt ein sehr
veraͤnderliches und daher gefaͤhrliches
Oelbad.“ Mehrere Andere sprachen in aͤhnlichem
Sinne.Nach diesen widersprechenden Aussagen ausgezeichneter Chemiker befragte der
Vormann der Geschwornen den Hrn. Faraday
insbesondere uͤber die von ihm geaͤußerte Gefahr der Explosion
des mehrmals gekochten Oels, worauf die Antwort erfolgte, daß dazu
allerdings der Zutritt der atmosphaͤrischen Luft noͤthig sey,
und diese Explosion sich nicht mit der Pulverentzuͤndung vergleichen
lasse. Uebrigens sey auch die Explosion des eingeschlossenen erhizten Oels
mehr einer Zersezung und ploͤzlichen Ausdehnung in Gasarten als einer
Verbrennung zuzuschreiben. Solche Explosionen wollten darauf Parkes, Brande und Phillips beim Oelbade nach ihren Beobachtungen nicht gelten
lassen.Nachdem null der Sollicitator-General bei der Uebersicht der Sache die
Verschiedenheit der wissenschaftlichen Angaben bezeichnet, und der Lord
Oberrichter es beklagt hatte, wie nach mehrtaͤgiger Abhoͤrung
der beruͤhmtesten Chemiker die Eigenschaften einer sehr gemeinen
Substanz noch in der Art ungewiß geblieben waren, daß tiefe Tage keineswegs
zum Triumphe, sondern zur Beschaͤmung der Wissenschaften dienen
koͤnnten, (das muͤndliche Verfahren dauerte zwei Tage), so
entschied die Jury, nach halbstuͤndiger Berathung, daß von der
Phoͤnixgesellschaft die Assecuranzgelder zu zahlen. Unter den
Entscheidungs-Gruͤnden befindet sich der, daß allerdings das
Oelbad einen Vorzug vor der unmittelbaren Erhizung, auch in Hinsicht der
Feuergefahrlosigkeit habe, daß diese richterliche Entscheidung in Beziehung
minderer Gefahr bei solcher Heizungsart richtig folglich auch rechtlich war,
hat, wie wir oben sahen, die spaͤtere Erfahrung bewahrt. Es
waͤre zu wuͤnschen, daß in Deutschland bei solchen streitigen
Kunst- und Gewerbsgegenstaͤnden vor dem richterlichen
Gutachten und Spruche die Gutachten der unparteiischen
Sachverstaͤndigen eingeholt, und nach diesen die Urtheile
gefaͤllt wuͤrden, denn in den meisten Faͤllen solcher
Art mangeln dem Richter die noͤthige chemische- und technische
Kenntnisse um eine sachgemaͤße Entscheidung zu fallen, von der doch
das ganze zeitliche Wohl so manches rechtlichen Buͤrgers
abhaͤngt. D..
Durch diese Versuche ist die Sicherheit so wie der Gewinn bei Wilson's Verfahren
erwiesen, wenn anders das Werk mit der noͤthigen Vorsicht geleitet wird.
Erklaͤrung der Figuren.
Fig. 10.
Seitenaufriß. Fig.
11. Grundriß des Apparates zum Zukersieden und Verdampfen der
Fluͤssigkeiten mittelst umherlaufenden siedenden Thranes.
A laͤnglicher Kessel aus starkem Bleche, den
Kesseln bei Dampfmaschinen aͤhnlich. Er ruht in einem gewoͤhnlichen
Baksteinofen mittlerer Groͤße, und ist ohne alle Leitungsroͤhren, um
geradezu die Wirkung des Feuers aufnehmen zu koͤnnen. Seine Groͤße
haͤngt von der Menge Oeles ab, das man erhizen, oder von der Menge
Fluͤssigkeit, die man verduͤnsten will; je groͤßer seine
Oberflaͤche, desto weniger wird man Brennmaterials brauchen. Man fand reinen
Thran hierzu tauglicher als irgend ein anderes Heizungsmittel, und braucht nicht
mehr davon als noͤthig ist, um den Boden des Kessels 6–8 Zoll hoch zu
bedeken.
B das Thermometer oben am Kessel, dessen Roͤhre
in den Thran eintaucht.
C eine kleine Rohre, welche sich mit ihrem unteren Ende
in den Kessel oͤffnet. Sie hat eine lange Roͤhre aufgesezt, das
Dampfloch (èvent à vapeur) genannt, und
steht dadurch in Verbindung mit der Atmosphaͤre. Diese Roͤhre hat
dreifachen Zwek: 1) die in dem Kessel enthaltene Luft beim Beginnen der Operation
hinauszulassen, um allen Druk zu vermeiden; 2) eine freie Verbindung mit der aͤußeren Luft zu
unterhalten, damit die Pumpe wirken koͤnne. 3) Die Daͤmpfe des Thranes
abzuleiten, die in dem Inneren der Raffinerie einen uͤblen Geruch verbreiten
und den Zuker verderben koͤnnten.
D die Pumpe aus Gußeisen, deren Staͤmpel mit
Metall beschlagen ist, wie jener Brown's Nr. 166. dieses Bulletins, April 1818. S.
122. Diese Pumpe, welche durch die Zugroͤhre E
mit dem Kessel in Verbindung steht, wird durch ein Pferd oder durch irgend eine
andere Kraft getrieben.
F ein kupferner Kessel, an dessen Grunde sich eine
Roͤhre, welche eine Fortsezung von G ist,
schlangenfoͤrmig umher windet, und an ihrem Ende mit dem Kessel durch die
Abzugsroͤhre H in Verbindung steht. Durch diese
in den Syrup untergetauchten Roͤhren laͤuft der erhizte Thran umher,
der stets durch die Pumpe aufgezogen wird. Dieser Kessel ruht auf Baksteinen, und
hat einen hoͤlzernen Aufsaz um die Hize zu erhalten.
I Hahn zum Abziehen des Syrupes, wenn dieser
hinlaͤnglich gekocht ist.
K Schornstein des Ofens.
Tafeln